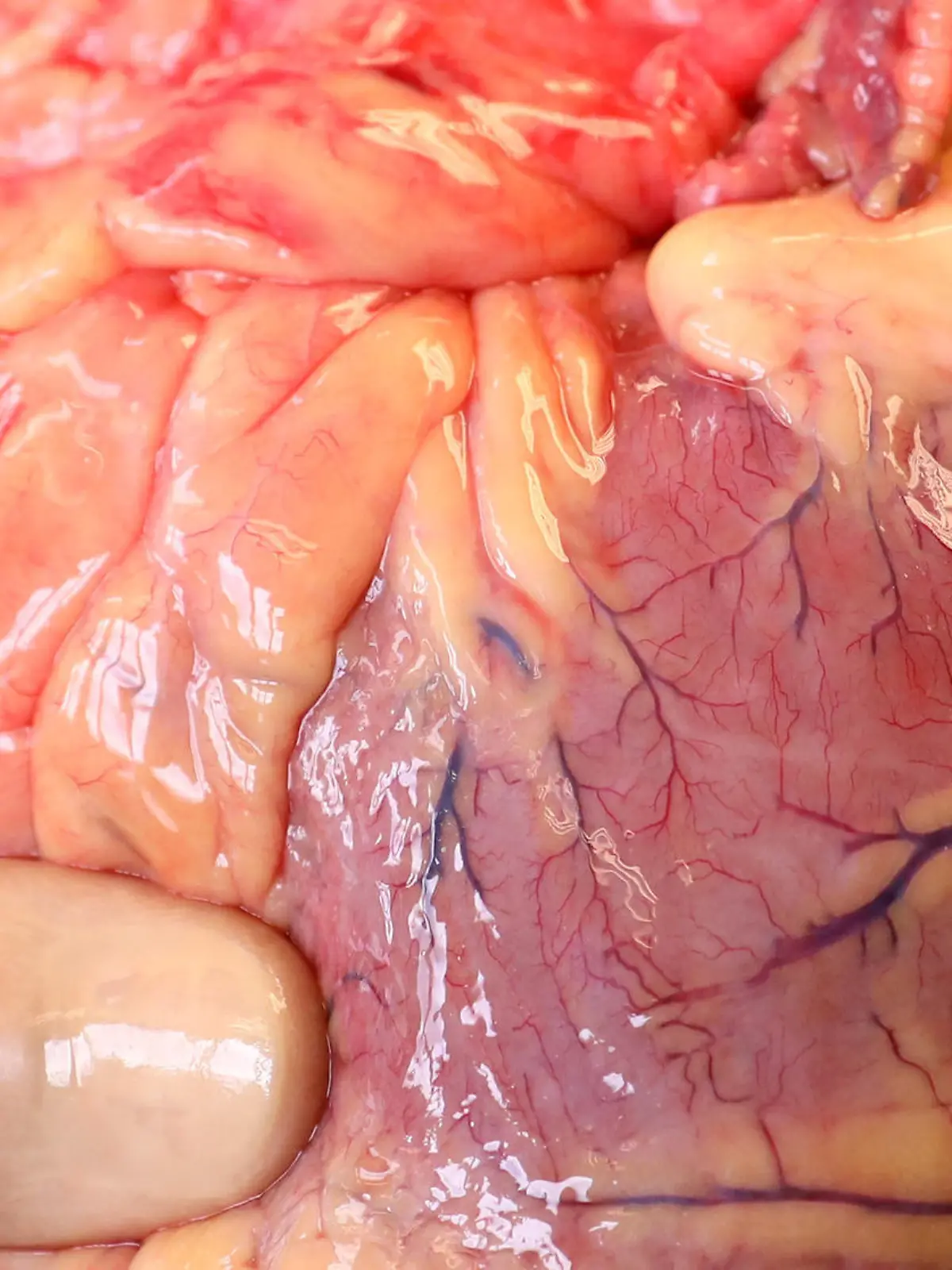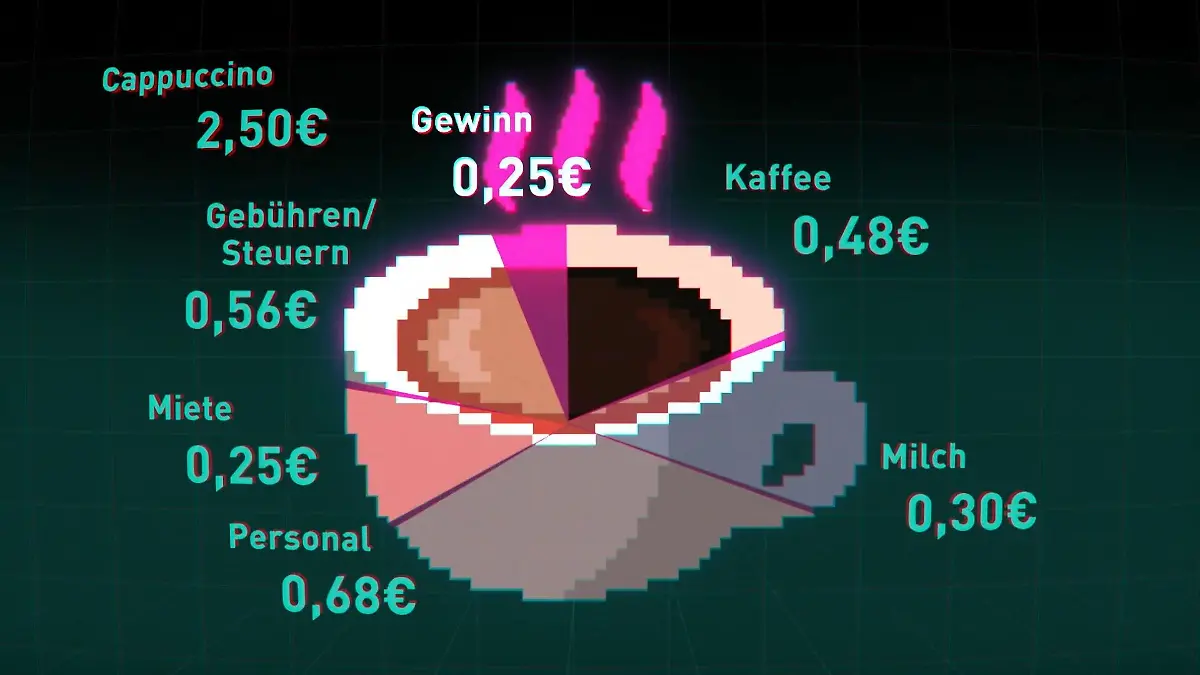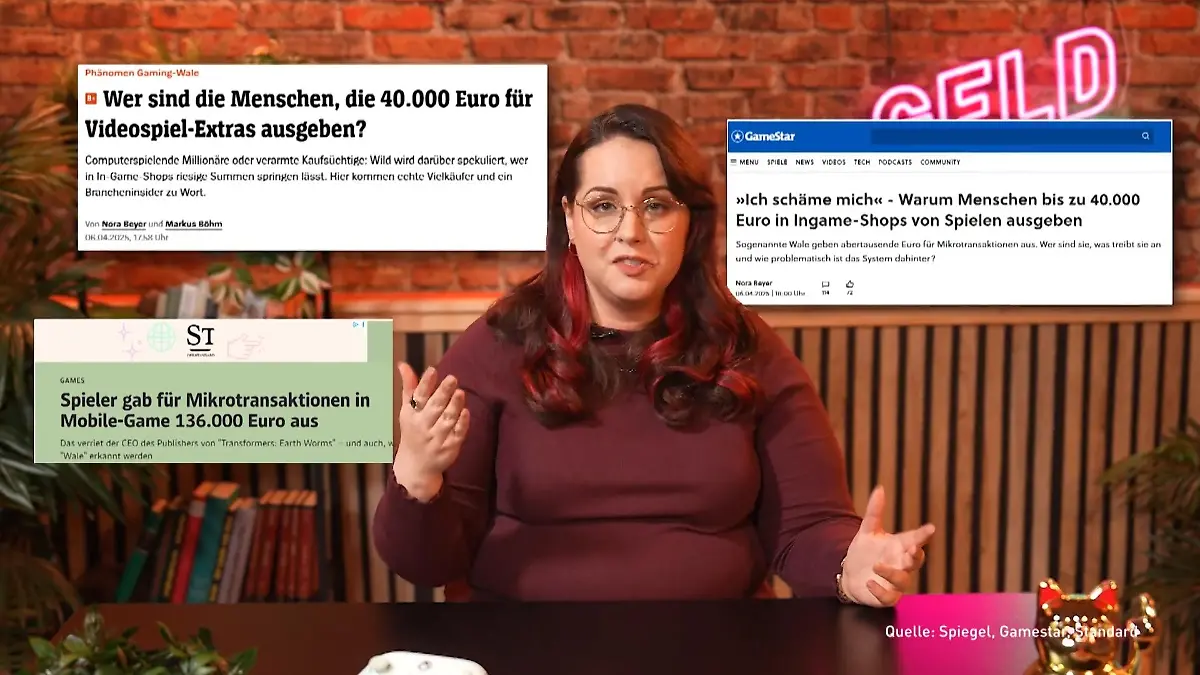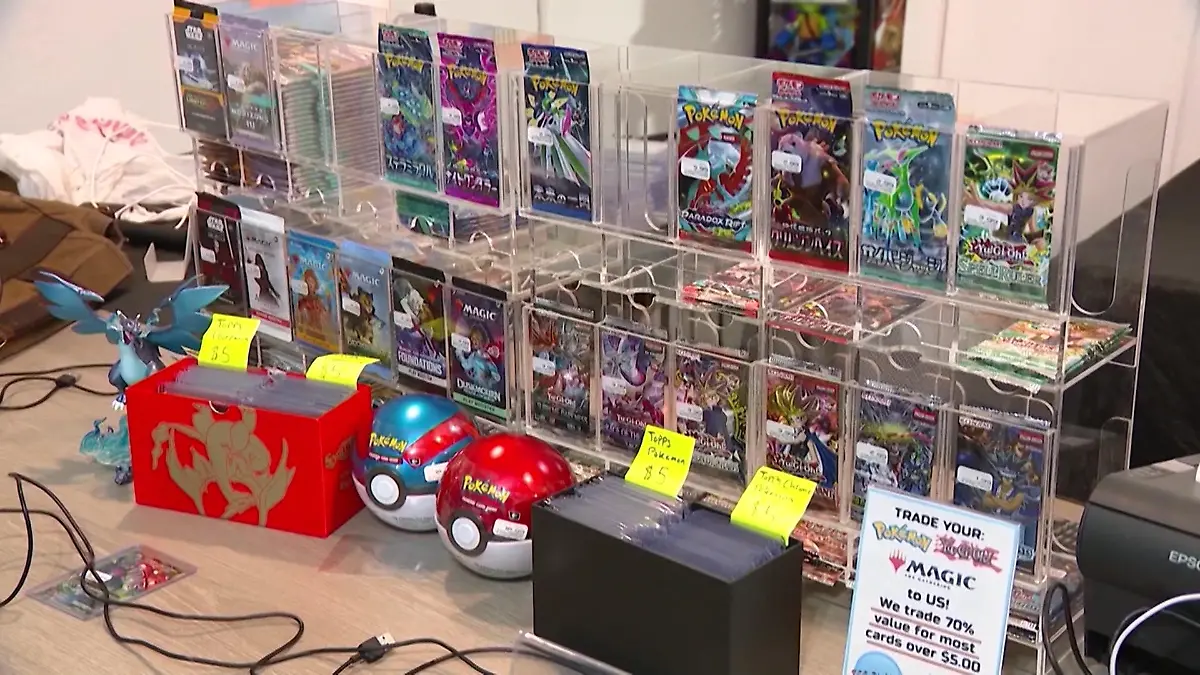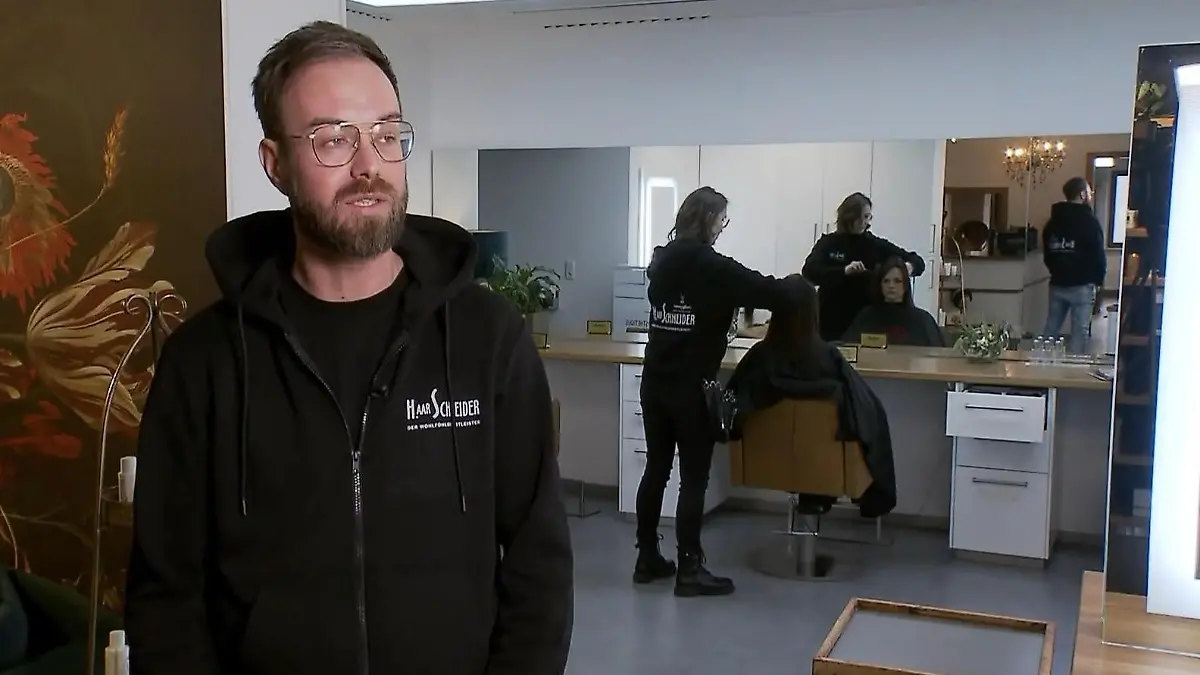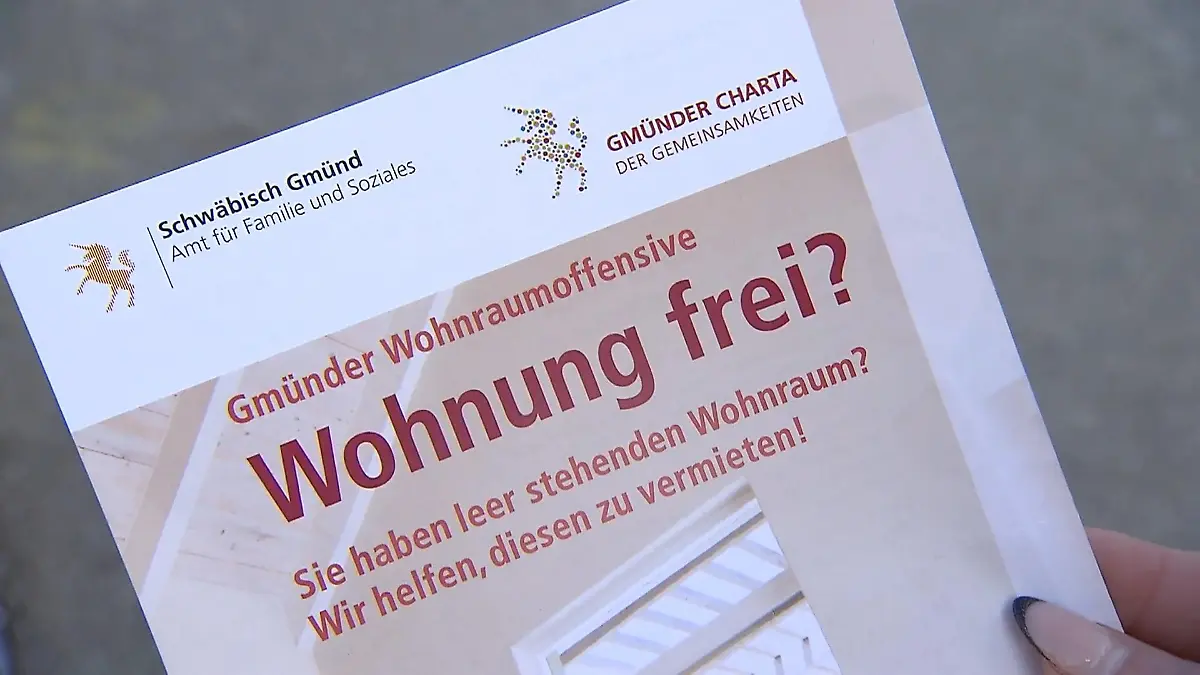Alles easy?Die fünf wichtigsten Fragen und Antworten zur elektronischen Patientenakte
Schluss mit dem Papierkram!
Am 29. April startet die elektronischen Patientenakte, kurz ePA. Sie soll Millionen Menschen eine bessere Behandlung und mehr Transparenz ermöglichen. Patienten können dann beispielsweise von überall Einblicke in ihren Medikationsplan erhalten oder online den letzten Befund checken. Wie das genau funktionieren soll? Wir beantworten die fünf wichtigsten Fragen zur ePA.
Warum wird die ePA überhaupt eingeführt?
Bislang sind Patienten, Ärzte, Apotheken und Krankenhäuser kaum vernetzt. Bei Behandlungen, die zum Beispiel beim Hausarzt durchgeführt werden, wird der Befund in das Computersystem der entsprechenden Praxis eingetragen. Muss der Patient in der Folge von einem anderen Facharzt behandelt werden, bleiben oft wichtige Informationen zur Medikation und bisherigen Behandlungen auf der Strecke. Mehrfachbehandlungen und unerwünschte Arzneimittelwechselwirkungen können die Folge sein.
Genau hier soll die ePA ansetzen. Sie digitalisiert und verbindet bisher teils auf Papier oder in nur einem System festgehaltene Informationen und soll so den zielgerichteten Austausch wichtiger Informationen erleichtern. Dafür vernetzt sie Patienten mit Ärzten, Apotheken und Krankenhäusern. Diese können dann Hand in Hand arbeiten, was eine bestmögliche Behandlung des Patienten ermöglichen soll.
Wobei unterstützt die ePA?
Behandelnde Ärzte sind jetzt verpflichtet – wenn der Patient dem nicht widerspricht –, die elektronische Akte auszufüllen. Im ersten Schritt wird der digital gestützte Medikationsprozess (dgMP) eingeführt. Dadurch erhalten Versicherte eine digitale Übersicht aller einzunehmenden Medikamente. Ärzte können so besser nachvollziehen, welche Medikamente eingenommen werden und weitere Medikationen darauf abstimmen.
Darüber hinaus sind Ärzte künftig verpflichtet, sämtliche Befunde aus Untersuchungen und Behandlungen sowie wichtige Briefe in der ePA zu speichern. Patienten sollen so auch die Möglichkeit bekommen, selbst in die Befunde reinlesen zu können. Weitere Funktionen sollen schrittweise eingeführt werden.
Lese-Tipp: RTL erklärt: Das müsst ihr über das E-Rezept wissen
Versicherte können über die App ihrer Krankenkasse auf die ePA zugreifen und die Daten verwalten. Dabei soll es auch möglich sein, Stellvertreter wie einen nahen Angehörigen in der App zu hinterlegen, der ebenfalls Zugriff auf die Daten bekommen soll.

Kann ich einzelnen Eintragungen widersprechen?
Nicht immer möchte man, dass der Hausarzt oder andere Einrichtungen sämtliche Befunde lesen können. Patienten sollen daher einzelnen Eintragungen widersprechen können. Dafür reicht ein mündlicher Hinweis beim jeweiligen Arzt.
Was ist, wenn ich die ePA nicht nutzen möchte?
Die ePA ist für Versicherte freiwillig. Eine Nutzung ist also nicht verpflichtend. Wer die ePA nicht nutzen möchte, muss bei seiner Krankenkasse der ePA widersprechen.
Lese-Tipp: Wegen Ärztemangel auf dem Land: In diesem Bus werden Zähne gezogen
Wie sicher ist die ePA?
Hacker des Chaos Computer Clubs (CCC) haben noch vor der Startphase der ePA eine Sicherheitslücke entdeckt. In diesem Zusammenhang warnten die IT-Spezialisten vor einer Sicherheitslücke, die eine Gefahr für die Daten von mehr als 70 Millionen Versicherten darstellen könnte.
Bei X postete Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hierzu: „Die ePA bringen wir erst dann ausgerollt, wenn alle Hackerangriffe, auch des CCC, technisch unmöglich gemacht worden sind.“
Lese-Tipp: Das solltet ihr über das E-Rezept wissen
Laut dem Bundesgesundheitsministerium sollen die Daten Ende-zu-Ende verschlüsselt sein, sodass nur der Versicherte und Berechtige die Inhalte der ePA lesen können. So kann beispielsweise die Krankenkasse selbst nicht auf die Inhalte der Akte zugreifen. (ude)