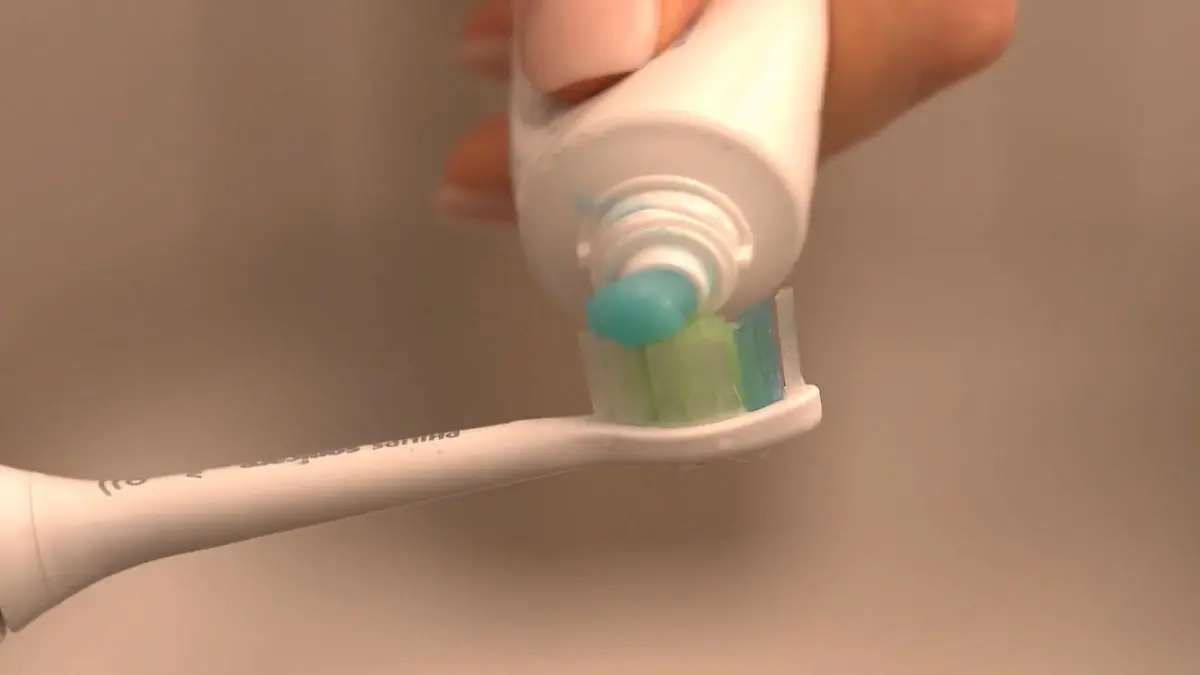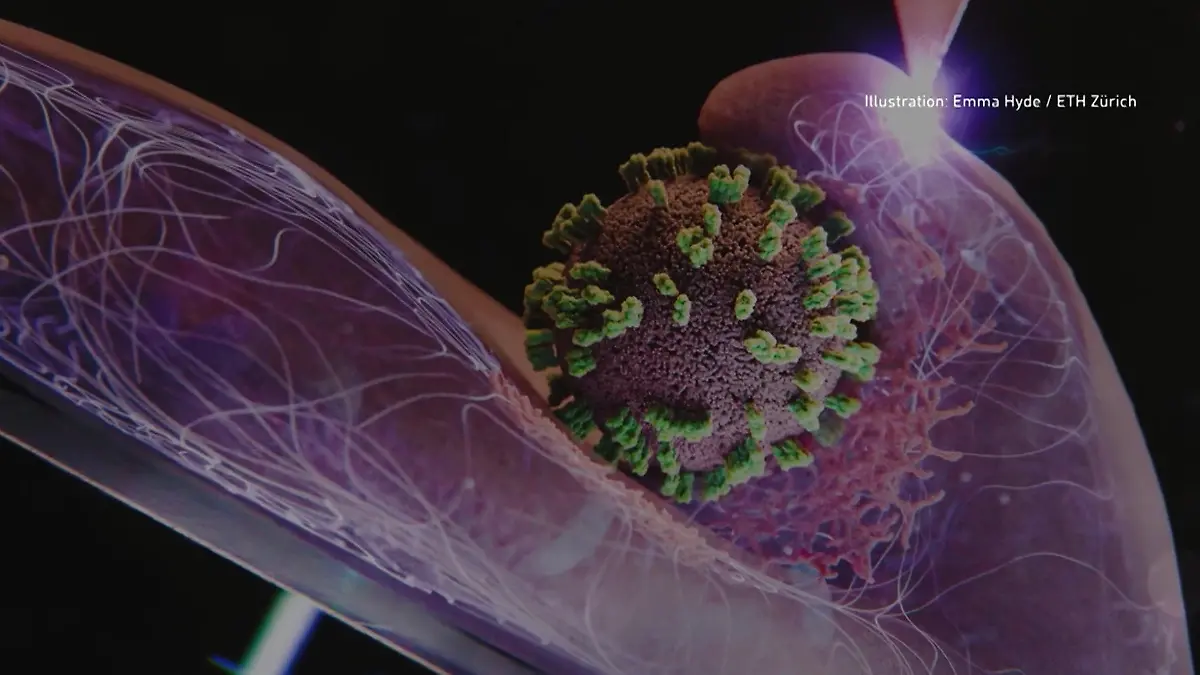Expertin erklärt, wieso Zusammenhalt wichtig istGerade jetzt! Warum Solidarität gesund ist
Sich gegenseitig helfen, unterstützen, zusammenhalten und füreinander da sein: All das drückt das Wort Solidarität aus. Nur selten hat man die Menschheit so solidarisch erlebt wie aktuell: Seit Russlands Präsident Wladimir Putin vor rund einer Woche die Ukraine angegriffen hat, steht ein Großteil der Welt solidarisch hinter dem Land, in dem so viele unschuldige Menschen zur Zeit unglaubliches Leid durchmachen müssen. Vereint zusammenstehen, dasselbe Ziel verfolgen: Das tut uns und unserer Psyche aus verschiedenen Gründen gut. Welche das sind, sehen Sie im Video.
Familienberaterin Ruth Marquardt erklärt zudem, was dieser Zusammenhalt für Betroffene bedeutet.
Solidarität schweißt uns als Gesellschaft zusammen
Wenn wir Menschen zusammenhalten, hält das nicht nur unsere Gesellschaft zusammen, sondern jeder einzelne profitiert davon: Es geht uns sowohl körperlich als auch psychisch besser, wenn wir anderen Menschen helfen. Kein Wunder also, dass Radiostationen zeitgleich das legendäre Friedenslied „Give Peace a Chance“ („Gib dem Frieden eine Chance“) von John Lennon spielen, Kirchenglocken gleichzeitig läuten, Leute in vielen Städten auf die Straße gehen und demonstrieren, spenden, was das Zeug hält oder sogar Kunstwerke auf Autobahnbrücken malen. Die meisten Menschen vereint im aktuellen Zeitgeschehen vor allem eines: Sie positionieren sich klar gegen Krieg.
Verschiedene Studien zeigen: Egal in welcher Form – Solidarität wirkt positiv. Es vermittelt ein Gefühl von Stärke und verdrängt die Angst. Ein internationales Forschungsteam konnte beispielsweise mithilfe eines MRT feststellen, dass großzügige Handlungen wie Schenken oder Spenden Glücksgefühle in unserem Hirn auslösen. Und noch besser: Es vermittelt eine wichtige Botschaft an alle Betroffenen.
Lese-Tipp: So überwältigend ist die Anteilnahme und Hilfe in Deutschland
"Alleine sind wir schwach, aber zusammen sind wir eine Macht“

Aktuell sind das vor allem die ukrainischen Bürger, die angegriffen werden, kämpfen und sogar aus ihrem gewohnten Lebensumfeld fliehen müssen. Wenn wir uns mit ihnen solidarisch zeigen, habe das eine Wirkung auf alle Menschen weltweit, erklärt Familienberaterin Ruth Marquardt im Interview mit RTL: „Wenn wir Friedenslieder spielen – das hören wir auch von Betroffenen, von Menschen, die in der Kriegssituation selbst stehen – dann freuen die sich, dann geht denen das Herz auf, weil sie merken: Sie sind nicht alleine, sie bekommen Unterstützung.“ Dadurch nähre man die Hoffnung, die im Augenblick das Wichtigste ist, um weiter durchzuhalten, ganz nach dem Motto: „Alleine sind wir schwach, aber zusammen sind wir eine Macht.“
Lese-Tipp: Junge Männer aus EU-Staaten ziehen freiwillig in den Krieg
Dass uns Bilder, wo wir Hilfsbereitschaft sehen oder Menschen, die sich umarmen, berühren, sei laut Marquardt ganz wichtig, denn: „Die persönliche Berührtheit ist ja das, was am Ende die Kraft haben kann, einen solchen Krieg auch zu beenden“
Charaktereigenschaft oder erlernt? So werden wir solidarisch
Aber wie kommt es eigentlich dazu, dass wir solidarisch sind? Ist das eine Charaktereigenschaft, mit der wir geboren werden oder lernen wir das im Laufe unseres Lebens? „Ein Stück weit bringen wir das als Babys mit, wir sind angewiesen auf Menschen, so kommen wir schon auf die Welt.“ Trotz allem durchleben wir Phasen in unserer Entwicklung, wo wir zunächst auch einmal Autonomie lernen müssen. Dass wir dann schon mal neidisch, ärgerlich und wütend sind, Abstand brauchen, uns durchsetzen wollen und ganz egoistisch sind, gehöre dazu und sei auch Teil unserer Persönlichkeit, so die psychologische Beraterin.
Ansonsten ist unser ganz nahes Umfeld maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir solidarisch werden, zum Beispiel wenn wir uns bei unseren Eltern abschauen, wie sie mit gewissen Dingen umgehen und wir dies dann anschließend imitieren. Oder aber wir schauen im Kindergarten, in der Schule oder im Sportverein: Gibt es hier Solidarität? Da könne man schon in jungen Jahren einiges lernen, was sich wiederum einprägt, erklärt Marquardt.
Wenn wir uns abschotten, fühlen wir uns allein

Dass wir Menschen jetzt diese weltweite Solidarität sehen, sei eine riesige Chance, massenhaft Synapsen im Gehirn miteinander zu verschalten, um noch mehr Empathie und Mitgefühl zu erlernen als bisher.
Doch was ist, wenn ich mich lieber zurückziehen möchte? Ist das dann falsch oder ungesund? „Es kommt ganz drauf an.“ Man müsse dabei zwei Arten des Abschottens voneinander unterscheiden: Die einen ziehen sich zum Beispiel zurück, um Kraft zu tanken, um sich auf sich selbst zu konzentrieren, um zu meditieren oder sich sogar für eine Zeit von allen Nachrichten abzuschotten – um dann jedoch nach vorne zu gehen und zu helfen. Und dann gibt es wiederum diejenigen, die den Kopf in den Sand stecken und von all dem nichts mitbekommen wollen. „Das ist tatsächlich fatal und schade, denn wenn wir uns auf uns alleine verlassen müssen, dann schwächt uns das. Wir brauchen Solidarität und Mitgefühl, weil es uns stärkt, weil es positive Botenstoffe ausschüttet.“
Daher gelte noch einmal mehr: Wir müssen zusammenstehen trotz Krise, trotz Krieg. (sli/vdü)
Helfen Sie mit!
Helfen Sie Familien in der Ukraine! Der RTL-Spendenmarathon garantiert: Jeder Cent kommt an Alle Infos und Spendenmöglichkeiten hier!