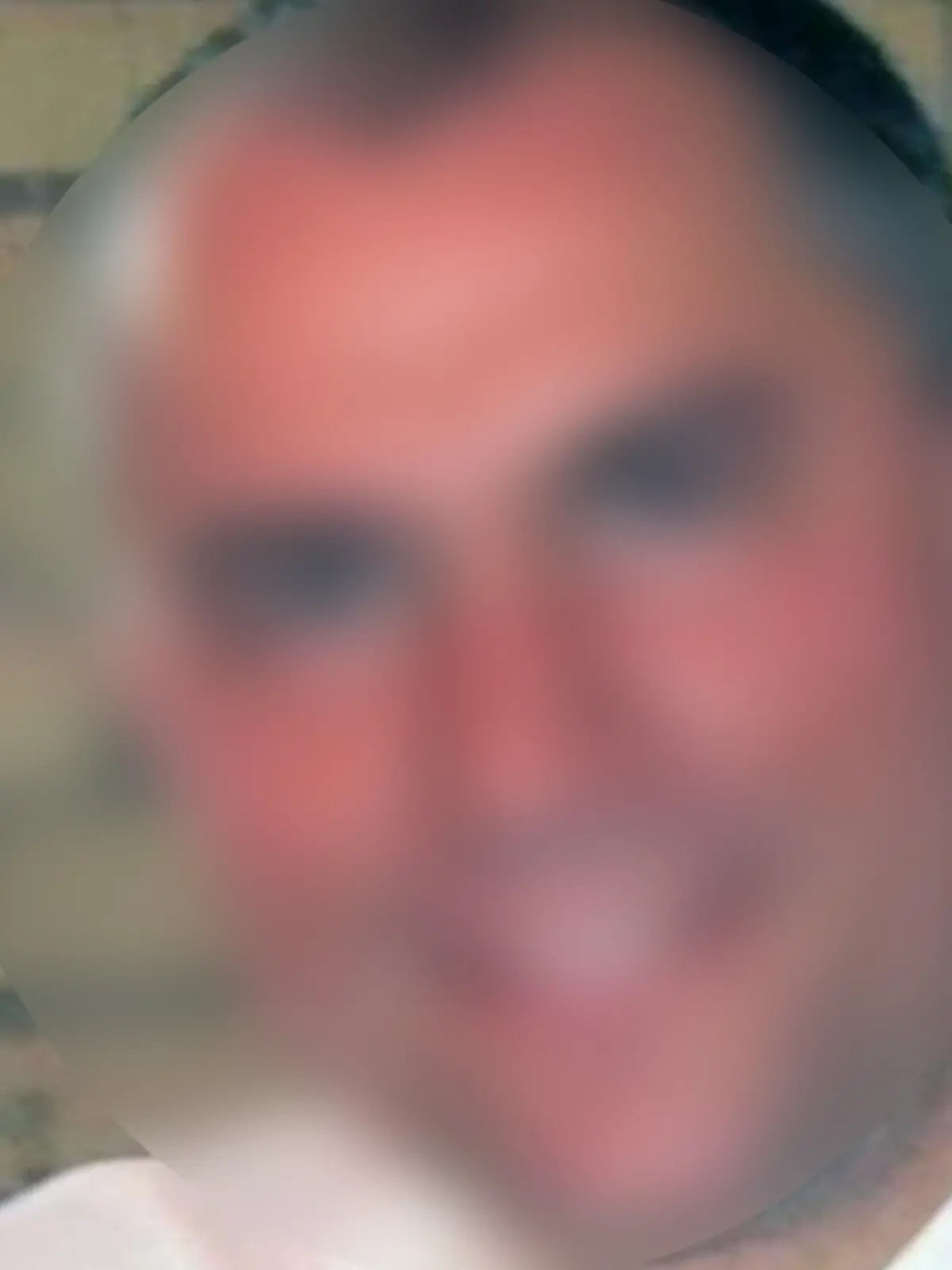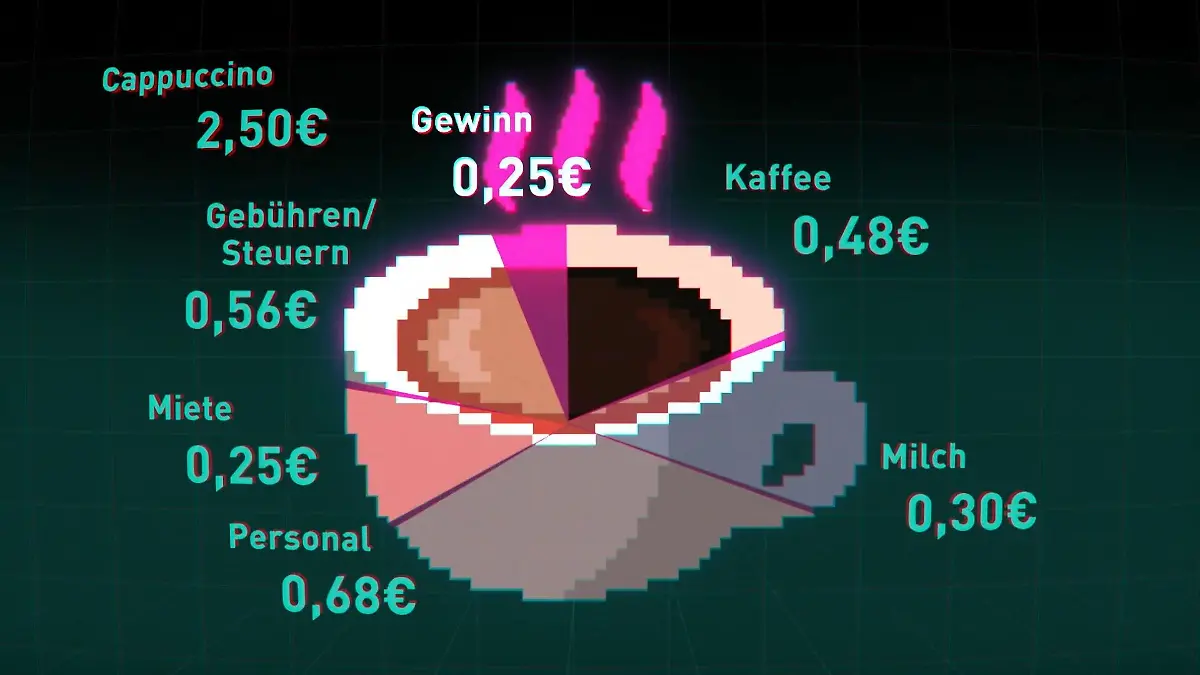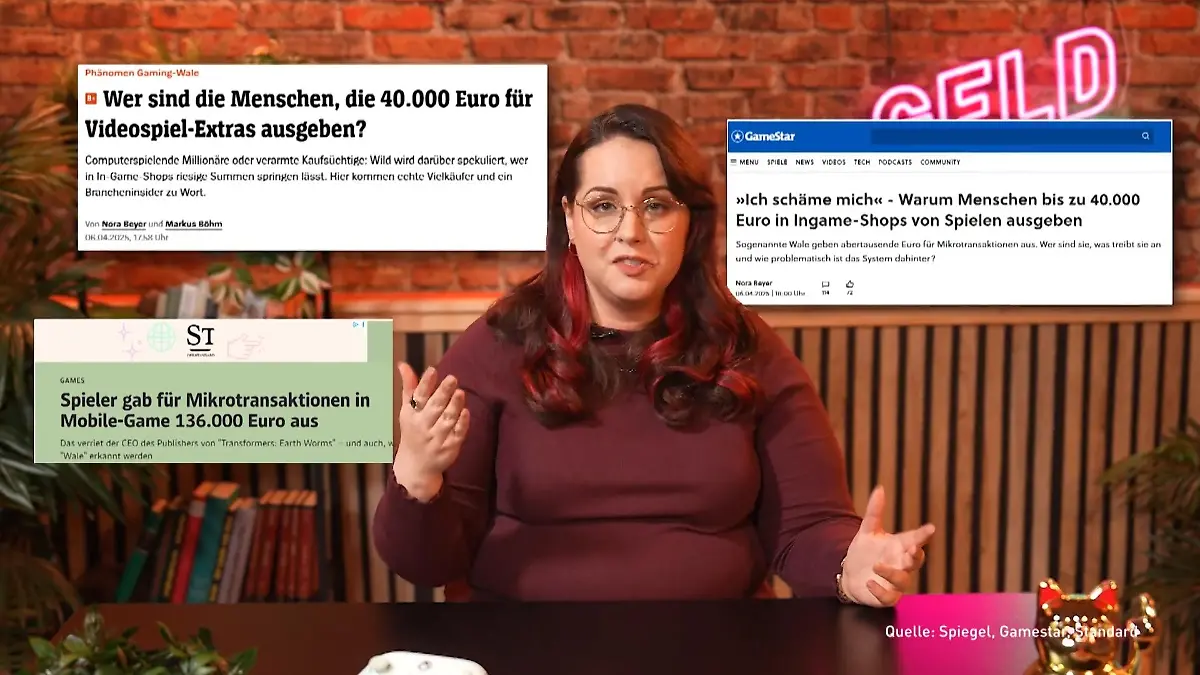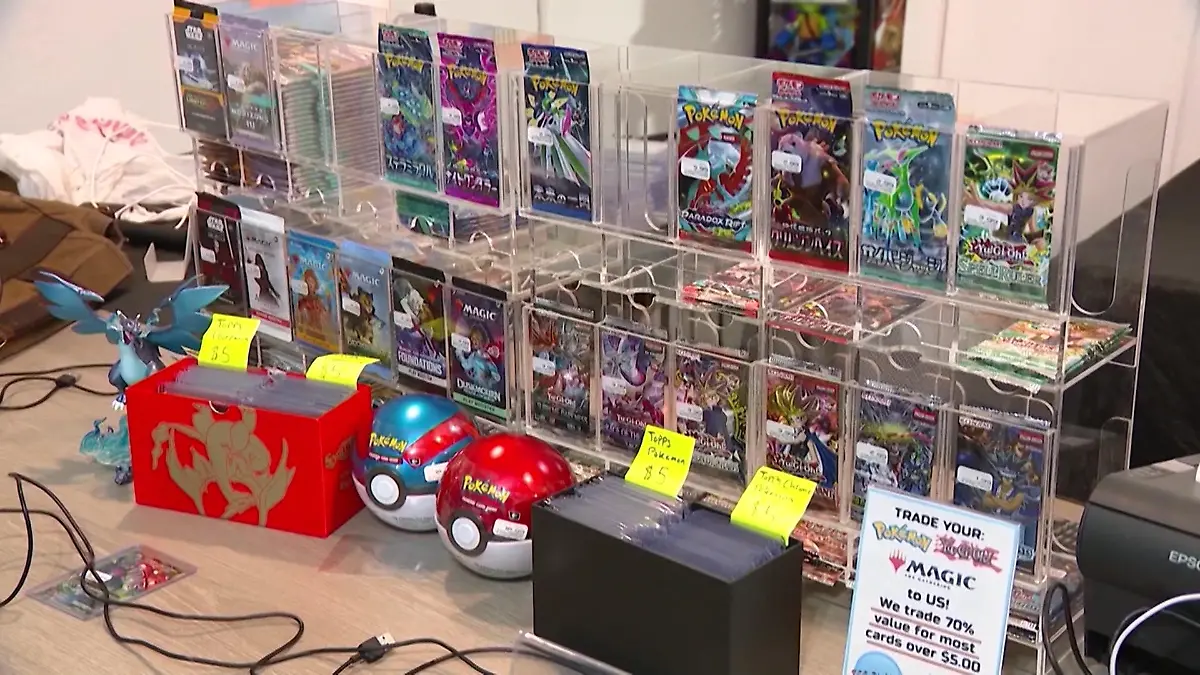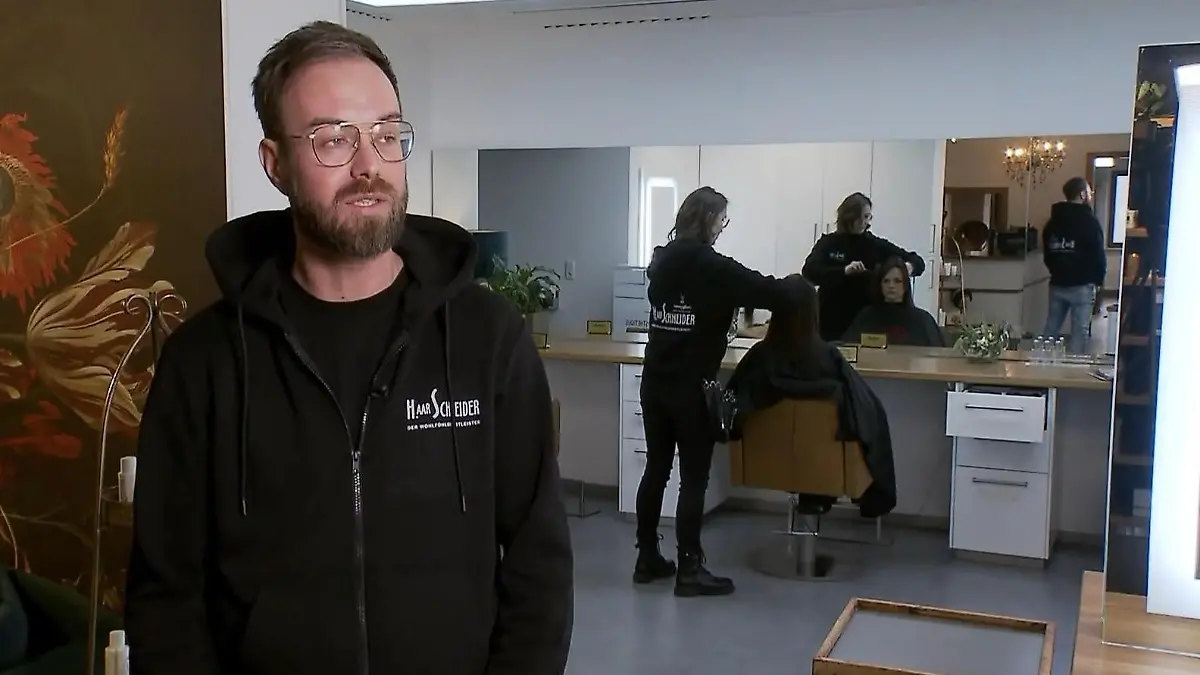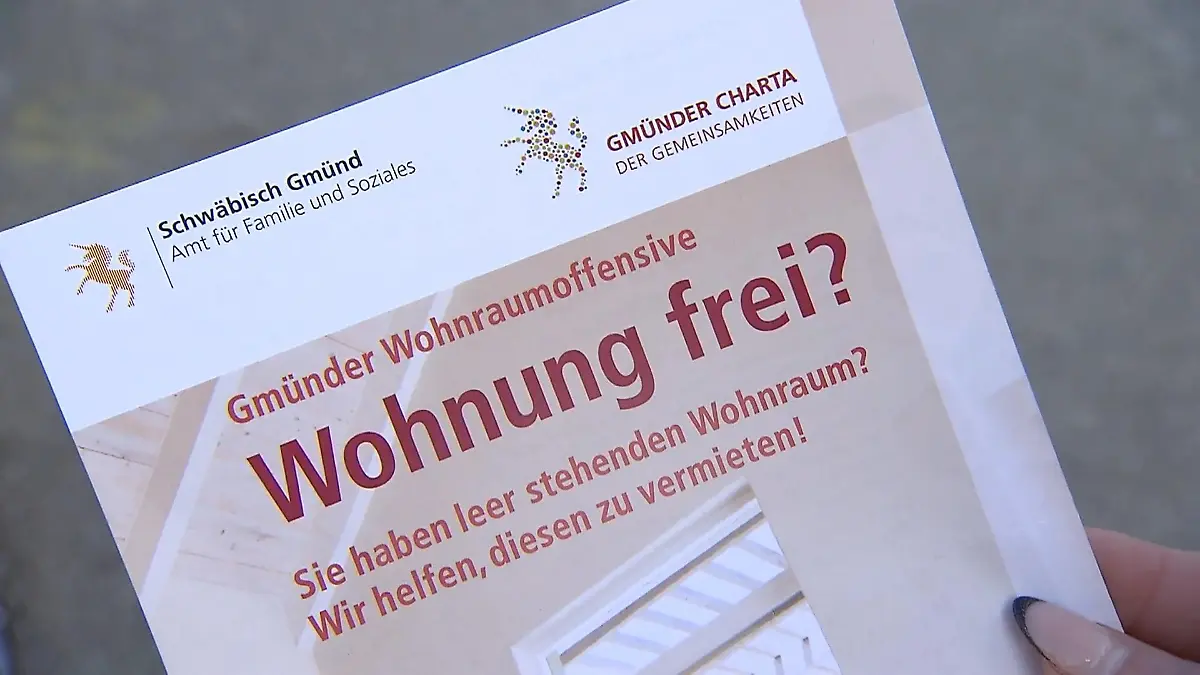Nicht immer nur meckern, Deutschland!Früher war alles besser? Als ob! Fünf Beispiele, die das Gegenteil beweisen

Kritisieren - das können wir Deutschen besonders gut!
Keine Frage, es gibt auch nach wie vor genug Gründe dafür. Aber Veränderung kann auch Angst machen. So viel, dass uns unser Gehirn austrickst und uns vormacht, dass früher alles besser war. Dabei blendet es negative Erinnerungen schlichtweg aus. Tatsächlich ist – nicht immer, aber oft – das Gegenteil der Fall: Insbesondere hier in Deutschland hat sich im Vergleich zu früher eine Menge gebessert. Hier sind fünf Beispiele!
Rosarote Brille? Deshalb malen wir uns die Vergangenheit schön
Wie fies: Wenn es um Erinnerungen geht, manipulieren wir uns gerne mal selbst. „Je länger eine Erinnerung zurückliegt, desto ungenauer wird sie“, erklärt Kognitionspsychologe Prof. Lars Schwabe im Hamburger Abendblatt. Seiner Meinung nach steckt hinter dem Eindruck, früher sei alles besser gewesen, auch ein banaler Mechanismus: „Der Schmerz von heute tut immer mehr weh als der von gestern“. Sprich: Wir malen uns die Vergangenheit unbewusst schön, um uns eine Art Zuflucht vor der anstrengenden Gegenwart genehmigen zu können – und vor der ungewissen Zukunft, die offenbar nichts Gutes verheißt.
Aber ist sie denn wirklich so schlimm? Sicher, es gibt viele Bereiche im Leben, in denen wir als Gesellschaft noch einen langen Weg vor uns haben. Doch manchmal lohnt es sich, in die Statistik zu schauen, wie weit wir schon gekommen sind – denn insbesondere hier in Deutschland meckern wir oft auf hohem Niveau.
1. Grundrechte und Sicherheit
Für uns Deutsche ist vieles selbstverständlich, was anderswo mit Gefahren für Leib und Seele verbunden ist (und hierzulange lange genug war). Zum Beispiel freie Meinungsäußerung oder Versammlungsfreiheit. Im Index des World Justice Project stehen wir, was Faktoren wie Sicherheit, Zivilgerichtsbarkeit, Freiheits- und Gleichheitsrechte angeht, auf Platz fünf von insgesamt 140 Staaten. Und wir nähern uns in der Skala immer weiter dem Optimalzustand (1,0) an – aktuell hat Deutschland einen Score von 0,83. Davor liegen nur die skandinavischen Länder.
Lese-Tipp: Das sind die sechs glücklichsten Regionen Deutschlands
2. Steigende Lebenserwartung bei Geburt
Die Lebenserwartung bei Geburt ist unabhängig von der Altersstruktur und Bevölkerungsgröße, sie fasst die Sterblichkeit über alle Altersjahre hinweg in einem Wert zusammen. Und hier geht es in Deutschland laut dem Statistischen Bundesamt seit 1950 stetig bergauf: Lag die durchschnittlich zu erwartende Lebensdauer eines neugeborenen Kindes 1950 noch bei 64,6 Jahren bei Männern und 68,5 bei Frauen, sind es heutzutage (aktuellster Stand: 2022) 78,3 Jahre bei Männern und 83,2 bei Frauen – also knapp 14 beziehungsweise 15 Jahre mehr. Im Jahr 2040 könnte die Lebenserwartung laut Prognosen bereits bei 81,2 (Männer) und 85,4 (Frauen) liegen.
Einer der wichtigsten Gründe dafür ist der medizinische Fortschritt, insbesondere in Sachen Vorsorge. Nur durch die drei Jahre der Corona-Pandemie ging der Wert um 0,6 Jahre nach unten. In den ostdeutschen Bundesländern ist die Lebenserwartung aber von 2021 auf 2022 bereits wieder angestiegen.
Und auch bei der Säuglingssterblichkeit hat sich einiges getan: Starben 1970 noch im Schnitt 23,4 von 1.000 lebendgeborenen Babys, waren es 2022 nur noch fünf.
Lese-Tipp: Neun Elternsätze von früher, die heute undenkbar und oft sogar strafbar wären
3. Immer weniger Verkehrstote
Wird es in Deutschland jemals ein Autobahn-Verkehrslimit geben? Fest steht immerhin eines: Sei Jahrzehnten geht die Zahl der Verkehrstoten immer weiter zurück. Waren es 1970 noch 20.000, lag die Zahl 2023 nur noch bei 2.839. Dazwischen lag die Einführung von Maßnahmen, an die wir uns heute längst gewöhnt haben: etwa die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 km/h auf Landstraßen (1972), die Einführung der Helmpflicht (1976) und das Alkohol-Limit von 0,5 Promille (2001). Im Zeitraum von 2021 bis 2030 will die Regierung durch ihr Verkehrssicherheitsprogramm die Zahl der Verkehrstoten insgesamt um 40 Prozent reduzieren.
Lese-Tipp: Theoretische Führerscheinprüfung: Würdet ihr noch bestehen?
4. Rückläufiger Alkoholkonsum
Übermäßiger Alkoholkonsum und die Sucht danach sind nach wie vor zweifellos ein riesiges Problem und fordern jedes Jahr Zehntausende Todesopfer. Good news gibt es dennoch: Seit Jahrzehnten wird in Deutschland immer weniger Alkohol getrunken. Waren es 2003 noch im Schnitt 147 Liter pro Jahr und Kopf, konsumierten wir 2023 nur noch 115,3 Liter. Betrachtet man den reinen Alkohol, lag der Verbrauch laut Statista im Jahr 1980 noch auf dem Höchstwert von 15,1 Litern - 2021 waren wir bei zehn Litern pro Jahr und Kopf angelangt.
Besonders die jüngere Generation scheint sich immer weniger aus Alkohol zu machen: 1970 tranken laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) noch 70 Prozent der 18- bis 25-Jährigen mindestens einmal in der Woche - ein Wert, der über die Jahre immer weiter abnahm und 2021 schließlich bei 21 Prozent lag.
Lese-Tipp: Spektakuläre Ergebnisse! Macht ein Wunder-Gel Alkohol bald unschädlich?
5. Mehr Rechte für Frauen
Ja, es ist noch ein weiter Weg, was den Status von Frauen in der Gesellschaft angeht – Sexismus und der Gender Pay Gap sind nur zwei der Stichworte. Trotzdem lohnt sich ein Blick auf das, was wir uns schon alles erkämpft haben! Angefangen vom Frauenwahlrecht (1918) über das Recht, als Ehefrau ohne Erlaubnis des Mannes ein eigenes Konto zu eröffnen (1968) bis hin zur Verschärfung des Strafgesetzes im Hinblick auf sexuelle Übergriffe 2016 („Nein heißt nein!”): So vieles, was heute selbstverständlich ist, war früher anders. Und definitiv schlechter.
Lese-Tipp: Meilensteine des Feminismus - das ist in den letzten 100 Jahren passiert