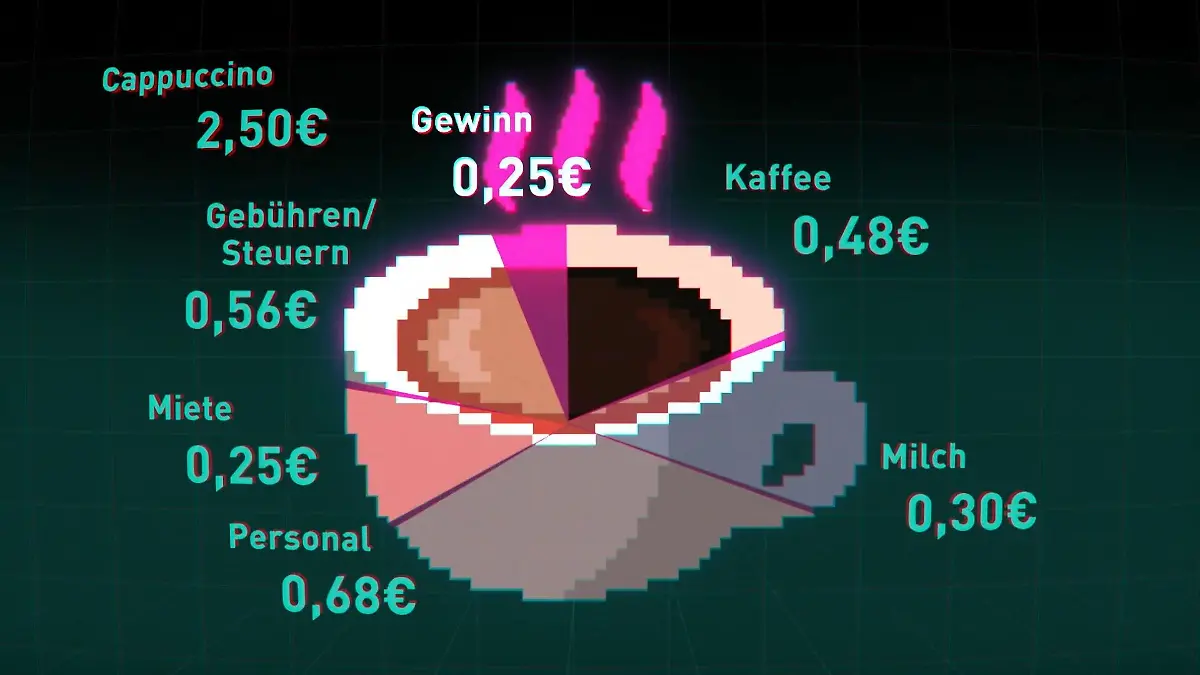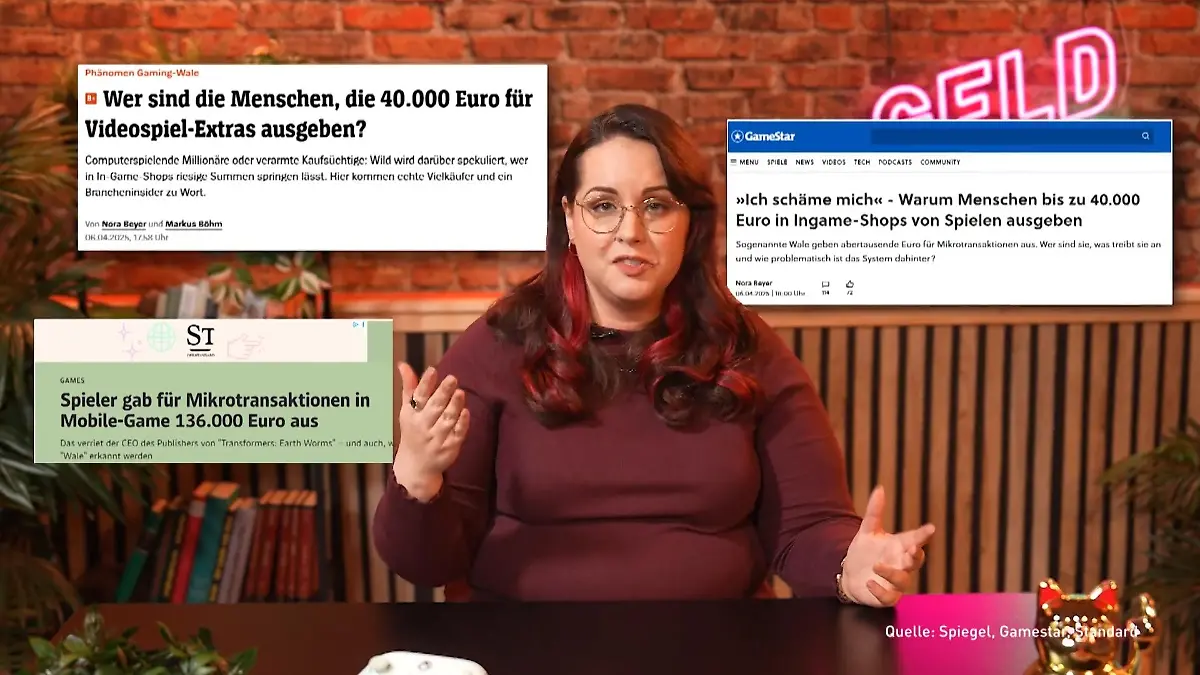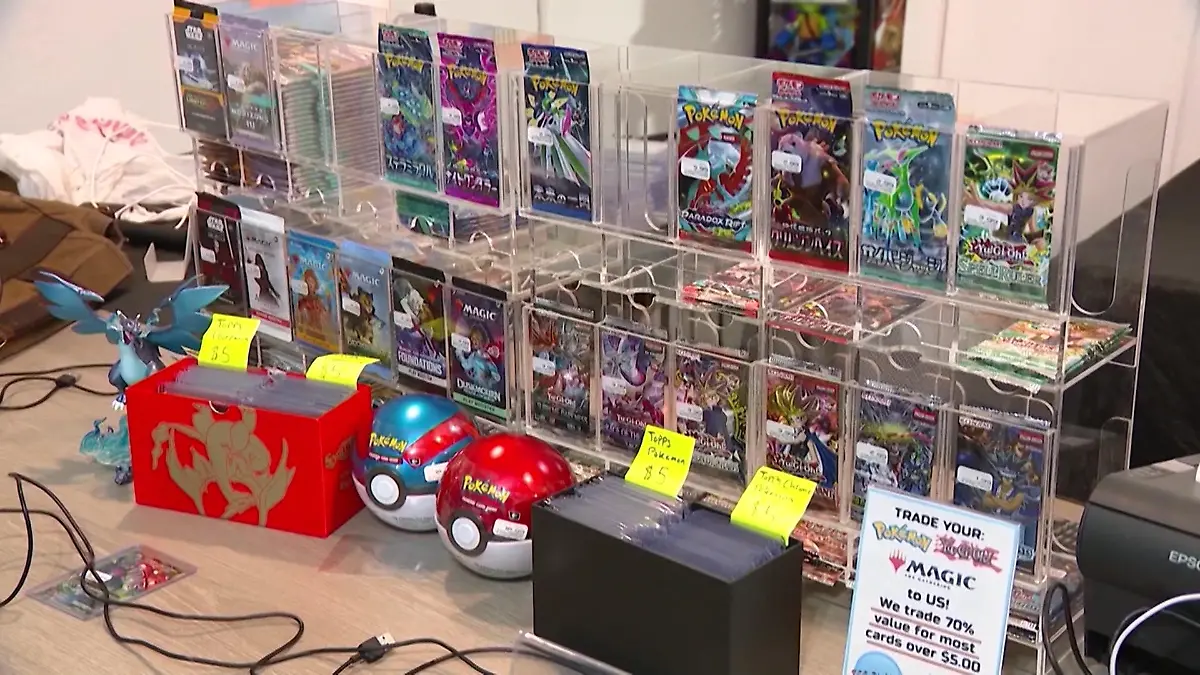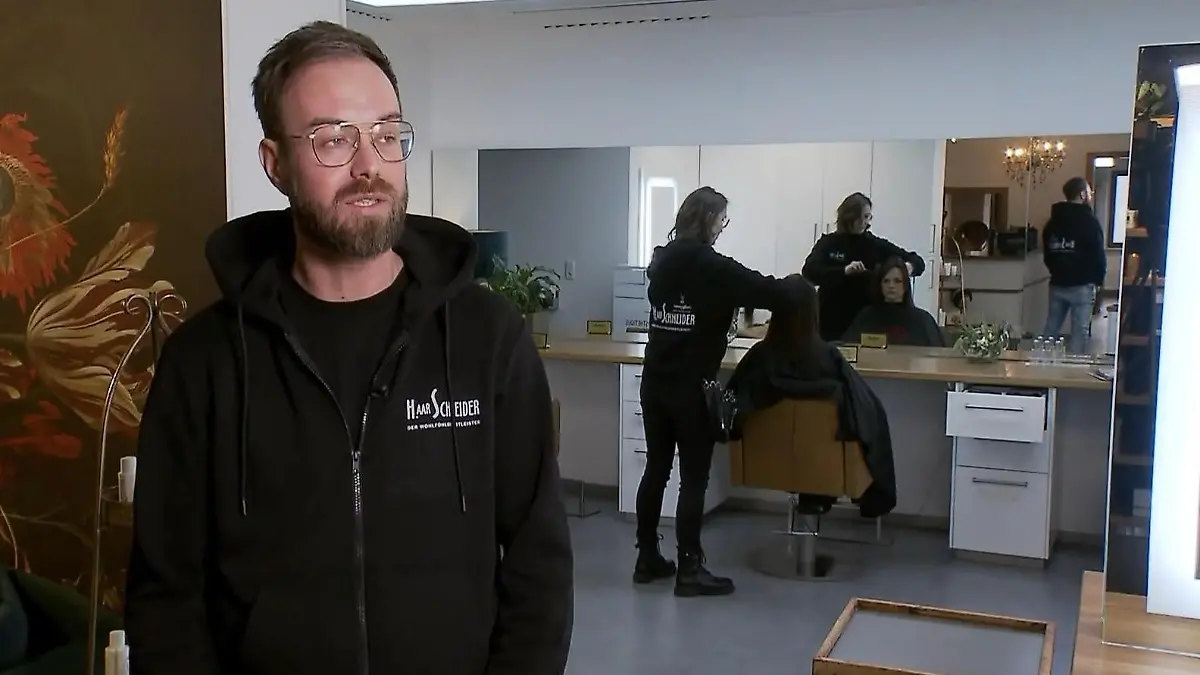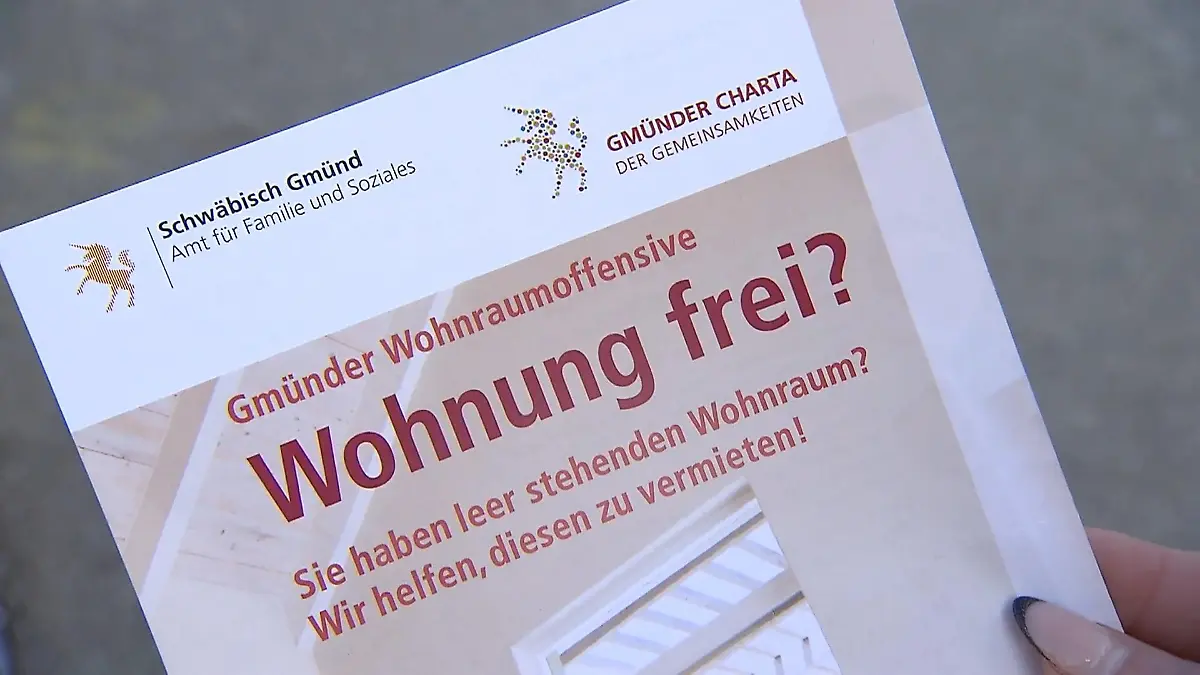Kein Wind, keine Sonne, kein Strom Worum geht es bei der Dunkelflaute und droht sie uns wirklich?
Müssen wir uns vor einem Stromausfall im Winter fürchten?
Die Erneuerbaren Energien boomen – ihr Anteil am Strommarkt wächst und wächst. Vor allem dank des Ausbaus von Wind- und Solar-Energie. Diese beiden klimafreundlichen Energien haben aber eine Schwäche: Sie sind nicht immer konstant in gleichem Maße verfügbar. Was ist, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht durch die Wolken scheint? Dann haben wir eine Dunkelflaute. Und was passiert dann?
Wenn das Wetter die Stromproduktion stoppt
Besonders im Winter gibt es immer wieder andauernde ruhige Wetterphasen, in denen kaum Wind weht und sich Hochnebel über unser Land legt. Dann gerät die Stromerzeugung bei Wind und Sonne ins Stocken. Je mehr wir uns also auf die Energie aus Sonne und Wind verlassen, umso abhängiger sind wir von den äußeren Bedingungen. Die bisher längste erfasste Dunkelflaute dauerte fast zwei Wochen, das war im Januar 2017.
Dennoch gab es bisher keine Stromausfälle. Andere Energien haben den Mangel behoben. Nun sind wir aber aus der Atomkraft ausgestiegen und wir planen auch den Ausstieg aus der Kohleverbrennung. Wie sichern wir dann unsere Stromversorgung?
Lese-Tipp: Welche Gefahren Nebel und Hochnebel jetzt mit sich bringen
So sichern wir unsere Stromversorgung

Da wir unser Leben derzeit mehr und mehr elektrifizieren, denken wir nur an E-Autos und die Transformation unserer Wirtschaft auf grüne Energien, brauchen wir in Zukunft Unsummen an Strom.
Damit wir nicht im Dunkeln sitzen, gibt es eine Kraftwerksstrategie der Bundesregierung. Die sieht vor, dass neue Gaskraftwerke gebaut werden sollen, die dann kurzfristig einspringen, wenn Wind und Sonne nicht genügend Energie liefern. Sie werden Back-up-Kraftwerke genannt. Außerdem soll die Umstellung auf klimafreundlicheren Wasserstoff gefördert werden.
Derzeit nutzen wir den Strom vor allem abends. Klar, wir kommen vom Arbeiten nach Hause, kochen, werfen die Waschmaschine an, laden gegebenenfalls das E-Auto. Die Stromspitzen beim Verbrauch sind also eindeutig abends. In Zukunft wird es wichtig, hier ein kluges Strommanagement zu haben. Digitalisierte Haushalte ermöglichen durch eine intelligente Netzsteuerung einen gleichmäßigen Stromverbrauch. Der Fachbegriff lautet hier Lastensteuerung. Das heißt: Unsere Waschmaschine springt irgendwann automatisch mittags an, wenn wir gar nicht zuhause sein. Das Auto wird nachts geladen.
Lese-Tipp: Home-Batterien: Wie wir unseren eigenen grünen Strom speichern und nutzen können
Wir werden den Strom künftig speichern müssen
Weitere Schritte zur Sicherung der Stromversorgung umfassen den Ausbau der Netze und die Verstärkung der Batteriespeicher. Wir müssen den Strom zwischenspeichern. Dann können wir auf die Energie zugreifen, wenn wir sie brauchen. Das geht mit großen Batterien, aber auch mit Pumpspeicheranlagen.
Und zuletzt leben wir mitten in Europa. Es gibt einen funktionierenden europäischen Stromverbund. So können wir durch importierten Strom aus dem Ausland mögliche Lücken schließen.
Übrigens haben wir in Deutschland bei der letzten Dunkeflaute im November mögliche Stromausfälle auch vermieden, weil neben konventionelle Kraftwerken auch weitere Erneuerbare Energien einsprangen. Dies waren Biomasse und Wasserkraft, die nach Auskunft der „VDI-Gesellschaft Energie und Umwelt“ etwa 10 bis 15 Prozent des Bedarfs deckten.
Lese-Tipp: Energiegewinnung mit Wasser: So funktioniert ein Pumpspeicherkraftwerk