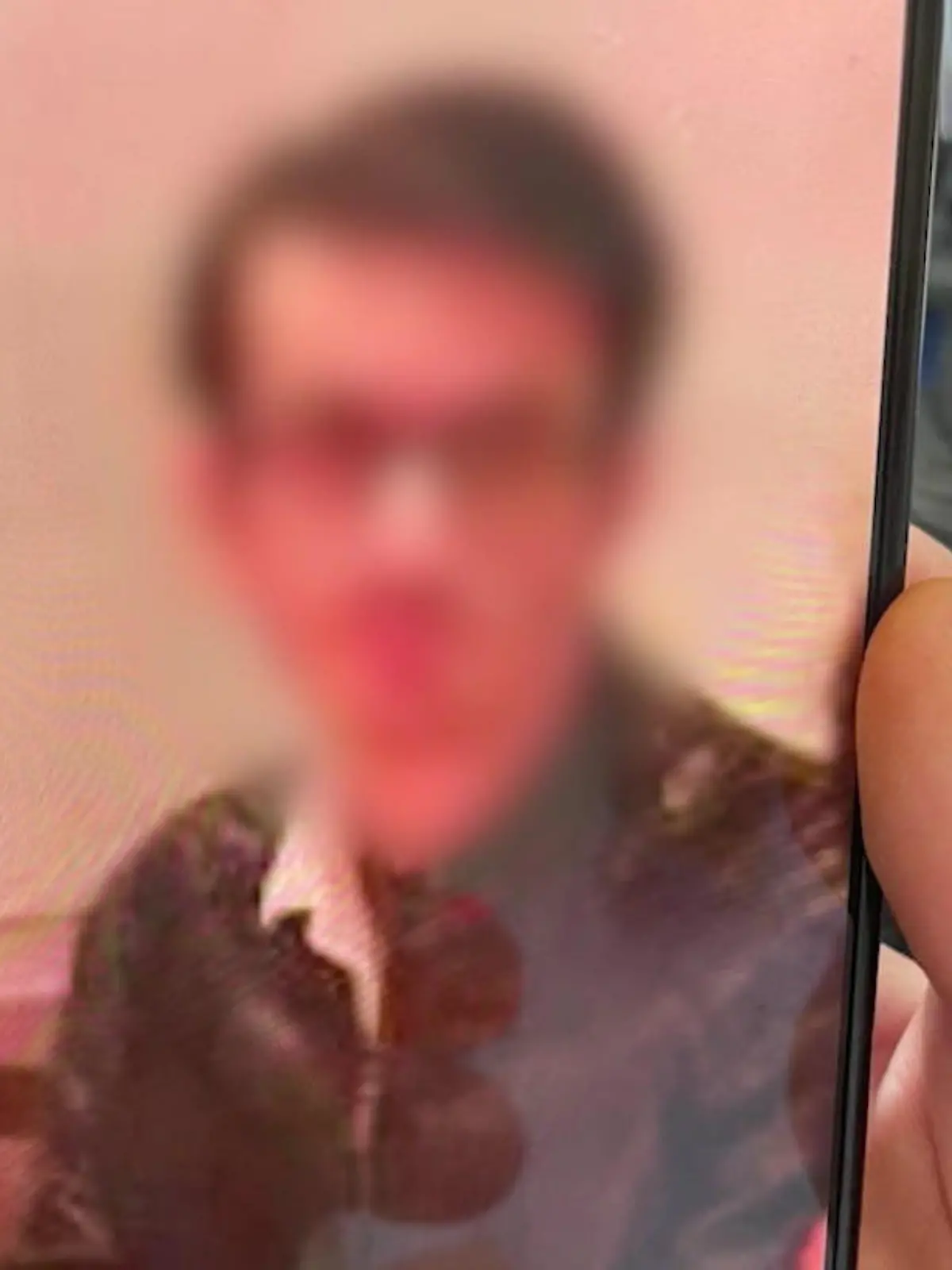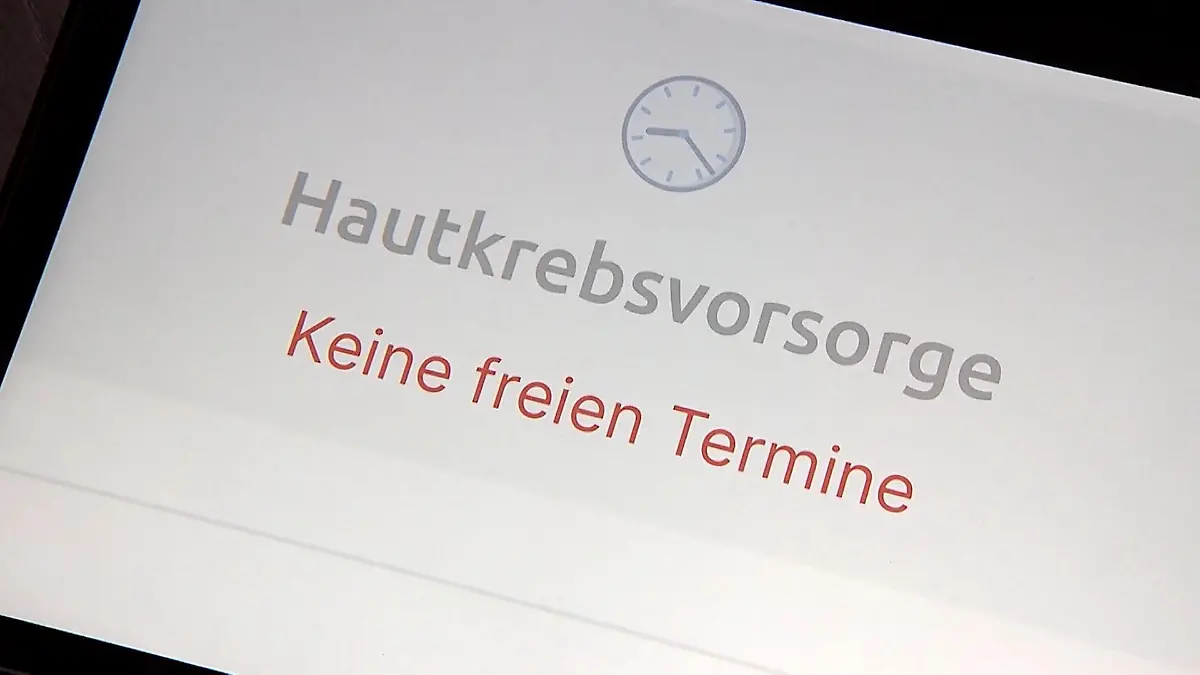Esoterik und Wissenschaft vereintNeue klinische Studie: Macht Waldbaden gesund oder ist das Aberglaube?
Beim Waldbaden verweilen Menschen bewusst im Wald, tauchen in die Waldatmosphäre ein und nehmen Kontakt zu den Bäumen auf. Der erhoffte Zweck: seelische und körperliche Gesundheit. Doch ist der medizinische Nutzen vom sogenannten Waldbaden tatsächlich nachweisbar? Diese Frage hat sich auch ein Verbund von Wissenschaftlern – unter anderem der Berliner Charité – gestellt und führt derzeit im Sachsenwald bei Hamburg eine klinische Studie durch. Teilnehmen kann fast jeder.
Wie diese „Klinische Waldtherapie“ (KWT) aussieht, erfahren Sie im Video.
Waldbaden als Wundermittel

Die Verfechter der KWT sind sich sicher: Waldbaden hilft. Als direkte Effekte dieser Therapiemethode werden unter anderem ein optimierter Blutdruck, reduzierter Stresshormonspiegel und eine bessere Konzentration genannt. Und sogar die Anzahl und Aktivität von krebs- und tumorbekämpfenden Lymphozyten im Blut soll sich erhöhen, sowie die Aufnahme der sogenannten Phytonzide verbessert werden.
„Das sind bioaktive Pflanzenstoffe, die jede Pflanze eigentlich produziert und ausströmt“, erklärt Waldtherapeutin Kirsten Lütgen im RTL Nord-Interview. Diese pflanzlichen Stoffe sollen ganz natürlich antiviral, antibakteriell und enzündungshemmend wirken und beim Waldbaden über Haut und Atmung aufgenommen werden. Führt man die KWT regelmäßig einen längeren Zeitraum durch, würden sogar noch spätere – sogenannte indirekte medizinische – Effekte hinzukommen wie zum Beispiel eine geringere Wahrscheinlichkeit Depressionen, Herz- und Lungenerkrankungen zu erleiden.
Diese physiologischen Effekte werden aber nicht von der gesamten Wissenschaft als gesichert anerkannt. So heißt es in einer wissenschaftlichen Arbeit von Prof. Angela Schuh von der Münchner Universität: „Für die Sekundärprävention sowie für die Therapie von chronischen Erkrankungen besteht bislang keine Evidenz.“ Besonders die positiven psychischen Effekte werden aber auch in der Arbeit von Schuh bestätigt.
Waldbaden soll Geld sparen - für alle
„Klinische Waldtherapie ist ein effizientes, evidenzbasiertes Heilverfahren mit präventiver und therapeutischer Wirkung.“ So definiert die International Nature and Forest Therapy Alliance (INFTA) die KWT auf der eigenen Website. Die INFTA belegt dies durch eine internationale Evaluierung unter mehr als 120 Experten aus 20 Ländern, die 2017 durchgeführt und zwei Jahre später veröffentlicht wurde – allerdings unter der Führung der INFTA.
In anderen Ländern wie Südkorea und Japan habe die KWT sich bereits im öffentlichen Gesundheitskonzept etabliert – und sogar wirtschaftliche Erfolge erzielt, führt die INFTA weiter aus. „In Südkorea wurden die finanziellen Vorteile für den Steuerzahler allein 2013 auf über 1,4 Mrd. USD geschätzt. Neuere Schätzungen gehen von fast 2 Mrd. USD pro Jahr aus!“, lautet es auf der Website.
Berliner Charité ist Forschungspartner

Und der Nutzen der KWT soll wissenschaftlich weiter erforscht werden. „Die meisten wissenschaftlichen Erkenntnisse stammen bisher aus Asien und nicht Europa“, erklärt die Präsidentin der INFTA, Suzan Joachim, im Gespräch mit RTL Nord. „Deshalb wollen wir nun Ergebnisse in Deutschland sammeln.“ Das Ziel der Studie: Auch in Deutschland sollen Ärzte die KWT als Kassenleistung verschreiben können.
Dafür führt die INFTA derzeit eine klinische Studie unter anderem im Sachsenwald bei Hamburg durch. Als wissenschaftlicher Partner ist die Berliner Charité dabei – finanziert wird die Studie durch das deutsche Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.
Jeder Bürger aus Hamburg und Umgebung zwischen 18 und 90 Jahren kann dabei an bis zu drei Sitzungen der KWT kostenlos teilnehmen. Dafür sollte man allerdings ausreichend mobil sein, derzeit an keiner anderen klinischen Studie teilnehmen und keine schwerwiegenden psychischen, akute oder chronische Erkrankungen aufweisen. Ausgenommen sind zudem Schwangere sowie derzeit stillende Mütter.