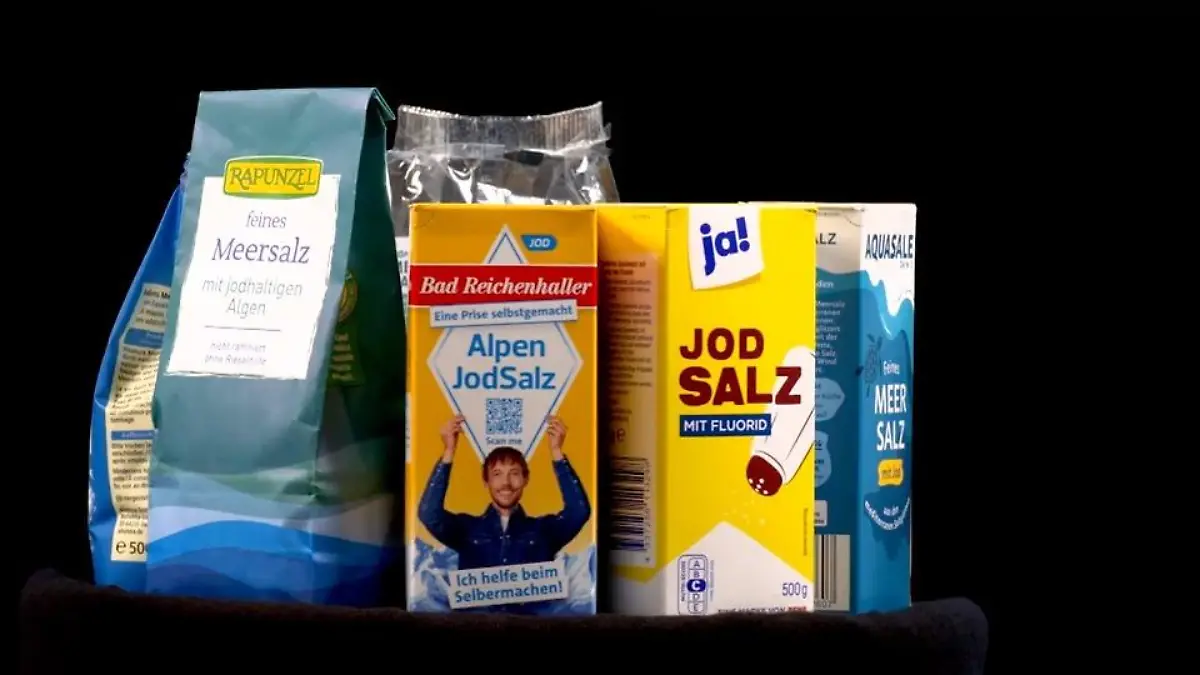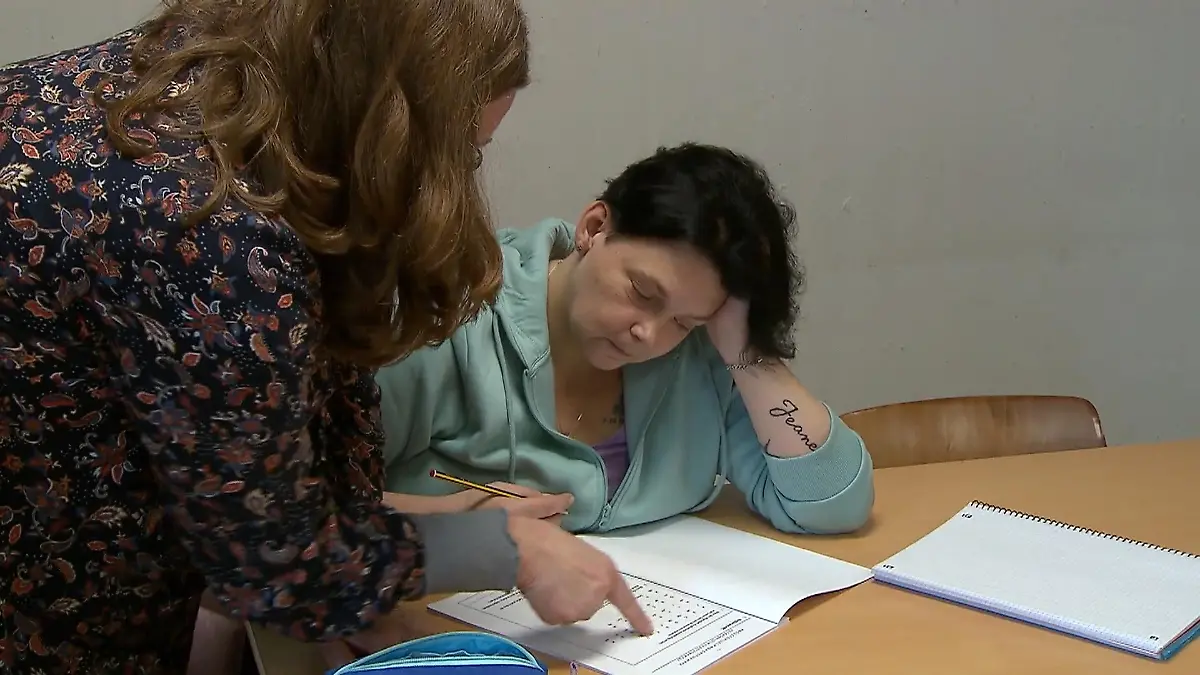Tipps, wie es besser funktioniertPsychologe erklärt: Warum Kinder ein „Nein” so schlecht verstehen

Aber ich hatte doch „Nein” gesagt!?
Kinder mögen ein ganz bestimmtes Elternwort nicht so gerne: das „Nein”! Trotzdem ist es wichtig, Grenzen zu setzen. Doch manchmal gelingt das besser, wenn wir unsere Botschaft positiv formulieren, wie Psychologe Michael Thiel weiß.
Mit der Gießkanne das Sofa gießen? Nein, nicht!
Kinder wollen die Welt erforschen und lernen - alles wird angefasst und ausprobiert. Wo Kinder leben, herrscht deshalb immer mehr oder weniger Chaos. Aber nicht alles, was erforscht werden kann, darf auch erforscht werden. Deshalb müssen Eltern auch öfter einmal „Nein“ sagen: Mit der Gießkanne das Sofa gießen? Nein, nicht! Mit Fingerfarbe etwas Schönes auf Mamas neues Kleid malen? Nein, auch nicht! Auf das Balkongeländer klettern? Nein, absolut nein!
Lese-Tipp: Eure Kinder sind bei Mama bockiger? Expertin verrät, wie ihr das ändern könnt
Aber Eltern kennen das - und verzweifeln oft daran: Irgendwie will der Nachwuchs das Wort „Nein“ oft nicht so recht verstehen. Vor allem kleinere Kinder tun oft sogar genau das, was mit „nicht“ gerade verboten wurde. Das liegt aber nicht daran, dass sie ein „Nein“ oder „Nicht“ nicht verstehen wollen, sondern daran, dass sie es schlechter verstehen als eine positive Botschaft.
Im Video: In dieser Familie gibt es keine Regeln
Ein „Nein” löst eine Abwehrreaktion aus - und ist schwieriger zu verstehen
Der Psychologe Michael Thiel erklärt das Phänomen auf Anfrage von RTL: „Ein Nein löst automatisch eine Abwehrreaktion aus. Selbst wir Erwachsenen fühlen uns dann in unserer Entscheidungsfreiheit eingeschränkt und tun gerne genau das Gegenteil von dem, was gefordert wird.“
Eine positive Motivation können wir leichter akzeptieren als ein Verbot, denn ein Nein werde von Menschen - ob groß oder klein - oft als Ablehnung der eigenen Person empfunden, so Thiel.
Ein weiterer Grund: „Negative Anweisungen sind schwerer zu verarbeiten als positive. Wenn man zum Beispiel sagt ‚Nicht laufen‘, muss das Gehirn die Handlung ‚laufen‘ erst bildhaft darstellen und dann verneinen, was mehr geistige Ressourcen beansprucht als eine direkte Anweisung wie ‚Stehen bleiben‘“, erklärt der Experte.
Wenn Eltern zu oft „Nein” oder „nicht” sagen
Ein „Nein” nicht zu verstehen, kann in manchen Situationen lebensgefährlich sein! Aber wenn Eltern mit eindringlicher Stimme vor einer Gefahr warnen, dann wird das „Nein“ oder „Nicht“ - zumindest wenn die Kinder älter sind - auch verstanden. Warum das so ist? „Das Kind lernt ab dem sechsten Lebensmonat, die verschiedenen Arten von Nein zu erfühlen“, erklärt uns Thiel. „Es lernt, zwischen einer echten Gefahr und einem einfachen Nein zu unterscheiden.”
Lese-Tipp: Geschrei, Getobe, keine Manieren - darf ich fremde Kinder maßregeln?
Wichtig beim Nein-Sagen, so der Experte: Wenn die Eltern zu oft „Nein” sagen, verliert es seine Bedeutung. Die Kinder verstehen das „Nein” dann als Spiel und sagen selbst zu allem „Nein”. Außerdem würden Kinder das „Nein“ differenzieren, wenn sie die Erfahrung gemacht haben, dass die Eltern nicht konsequent sind: „Zum Beispiel sagt Mama ‘Nein’ zum Eis, Papa aber ‘Ja’, oder die Eltern geben nach Quengeln doch nach“.
Wie ist es bei euch?
Die Ergebnisse der Umfrage sind nicht repräsentativ.
So entwickelt sich das Verständnis der Kinder
Grundsätzlich lernen Kinder erst allmählich, verschiedene Arten von Verboten zu verstehen und zu unterscheiden. Dies hängt von ihrem Alter und Entwicklungsstand ab:
Kleinkinder und Vorschulkinder: Kleinkinder haben oft Schwierigkeiten, zwischen verschiedenen Arten von „Nein“ zu unterscheiden. Für sie ist ein „Nein“ oft absolut und sie können nicht abschätzen, welche Folgen ein Verstoß haben kann. Das lernt man erst durch Erfahrung.
Schulkinder: Ältere Kinder beginnen besser zu verstehen, dass „Nein” nicht gleich „Nein” ist. Sie können besser erkennen, dass ein „Nein“ in gefährlichen Situationen - zum Beispiel „Nicht auf die Straße rennen!“ - ernster zu nehmen ist als ein „Nein“ in weniger gefährlichen Situationen - zum Beispiel „Nicht mit den Schuhen ins Haus!“
Wichtig in der Entwicklung sind Erfahrungen und Konsequenzen: Denn Kinder lernen durch Erfahrungen und die Konsequenzen ihres Handelns. Durch konsequente und klare Kommunikation und das Erleben natürlicher Konsequenzen lernen sie, welche „Neins“ absolut sind - und welche verhandelbar.
Lese-Tipp: Streit vor den Kindern: DAS solltet ihr auf jeden Fall vermeiden!
Wie Kinder ein „Nein” besser verstehen können
Doch mit welchen Formulierungen und Tricks können Eltern das Problem umgehen? Dazu gibt der Experte allen Eltern folgende Empfehlungen:
Grundsätzlich gilt: Auf Augenhöhe sprechen! Ein „Nein“ sollte möglichst auf der Höhe des Kindes ausgesprochen werden, damit es sich nicht automatisch von oben herab zurechtgewiesen fühlt. So kann man sich seiner Aufmerksamkeit sicher sein. Das bedeutet: In die Hocke gehen und so mit dem Kind sprechen.
Ein „Nein“ benötigt Zeit: Ein beiläufiges „Nein - lass das!“ führt eher zu einem „Jetzt erst recht“ als zu einem Gehorsam. Besser ist es, dem Kind zu erklären, WARUM es etwas nicht darf. Gut ist es auch, dies anschaulich zu erklären.
Weniger ist mehr: In der Reizüberflutung, in der wir leben, geht ein beiläufiges Nein eher unter. Wenige, aber klare und konsequente Neins können vom kindlichen Gehirn besser verarbeitet werden als eine Kaskade von Neins.
Positiv formulieren: Statt „Nicht rennen!“ sagen: „Bitte geh langsam!“
Alternativen anbieten: Statt etwas zu verbieten, eine alternative Handlung anbieten. „Nein, du kannst nicht noch ein Eis haben, davon bekommst du Bauchschmerzen. Aber ich kann dir einen Apfel schneiden.“
Das „Nein” sollte vorhersehbar und widerspruchsfrei sein: Die Kinder wissen, was sie erwartet.
Belohnungssystem: Positive Verstärkung für erwünschtes Verhalten kann wirksam sein. Lob und Belohnungen für das Einhalten von Regeln motivieren Kinder.