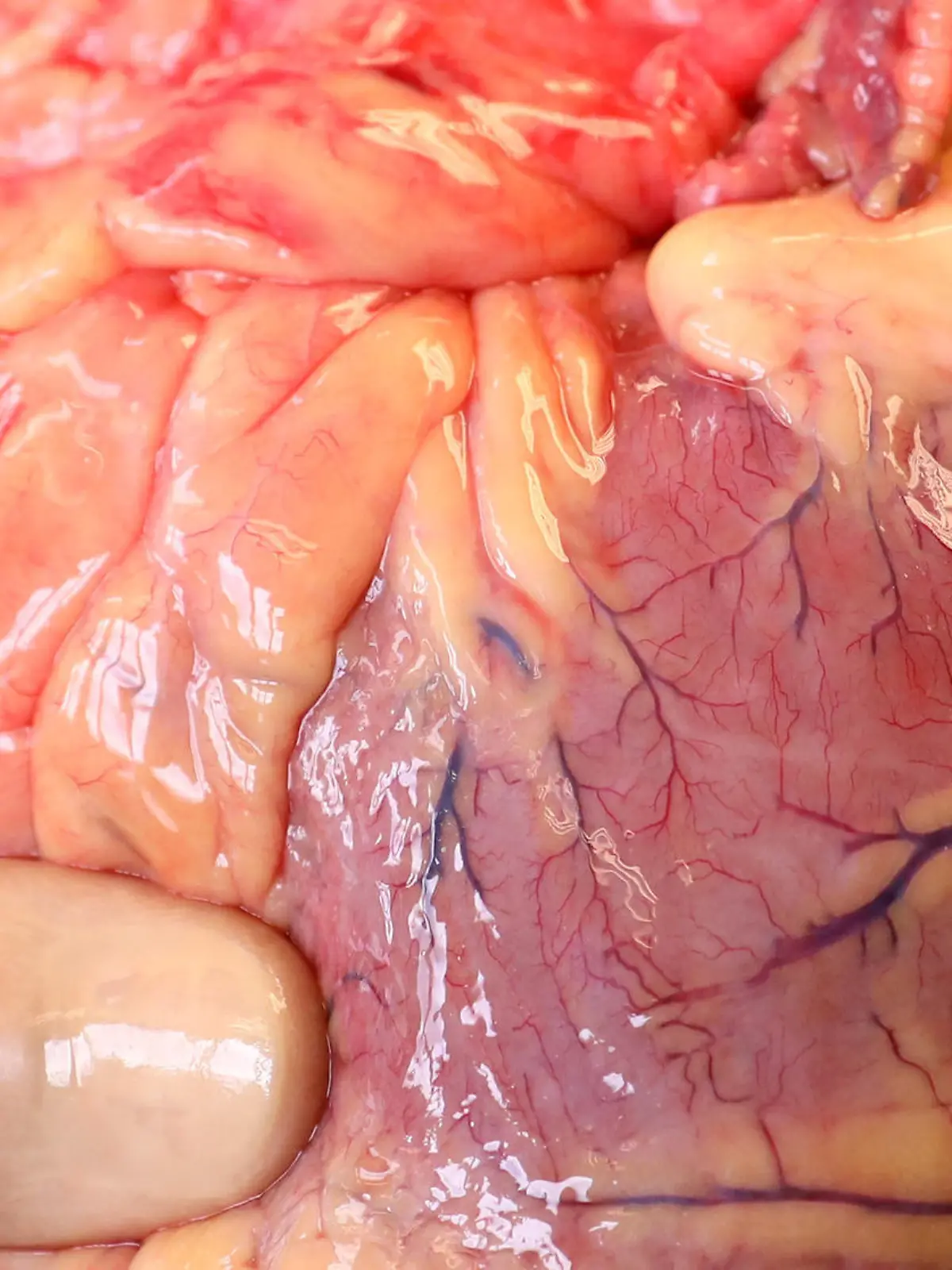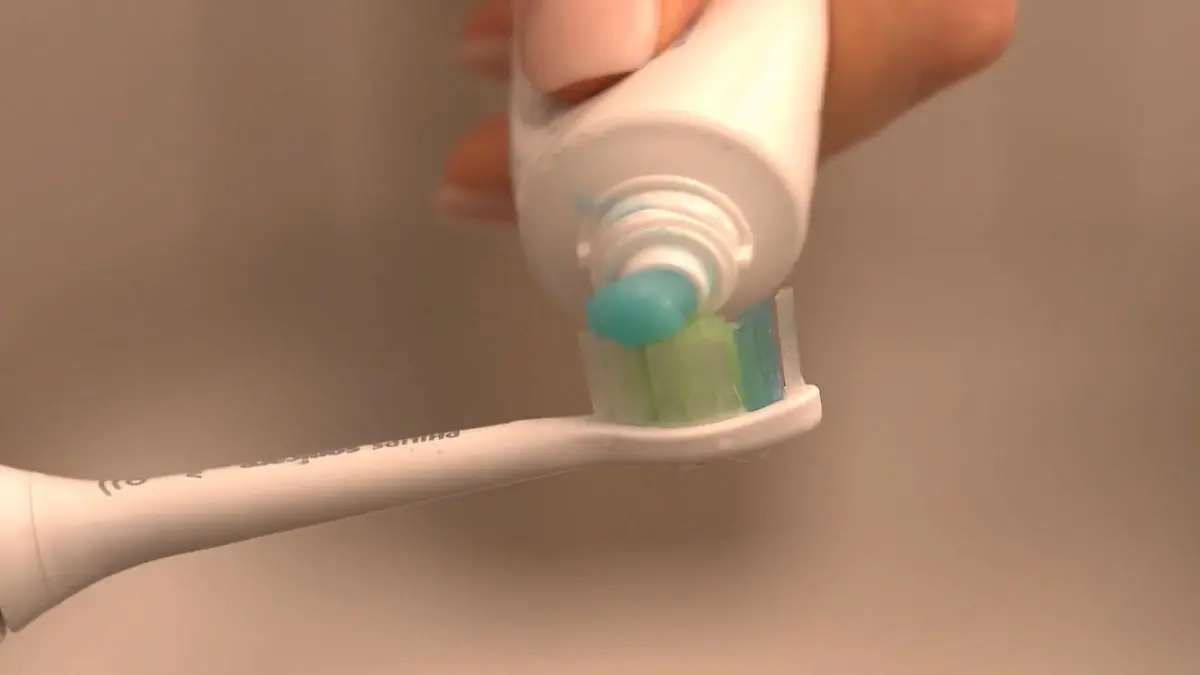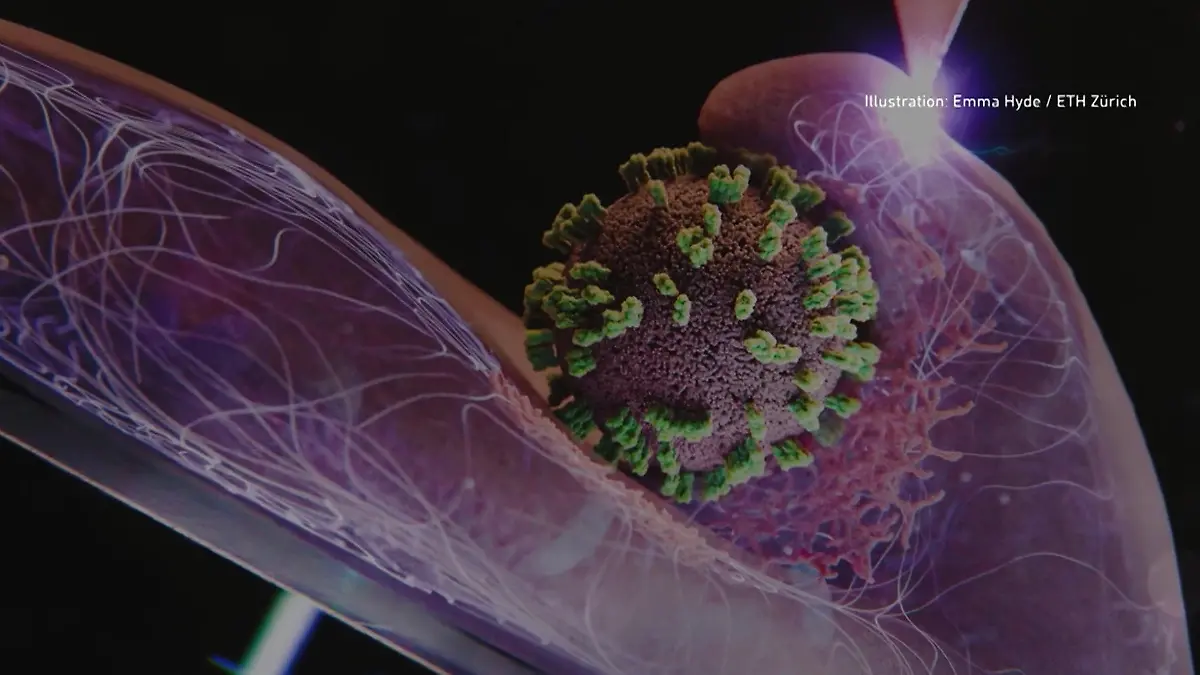Es fängt oft schleichend anNur besorgt oder Hypochonder? Macht den Experten-Test!

„Ist das normal – oder bin ich schwer krank?“
Wann wird die normale Sorge um die eigene Gesundheit zum hypochondrischen Verhalten? Kann jeder krankhaft hypochondrisch werden? Und was hat Dr. Google damit zu tun? Wir haben Diplom-Psychologe Michael Thiel gefragt! Mit seinem Selbsttest könnt ihr euch selbst überprüfen!
Sechs von 100 Menschen leiden an einer leichten Form der Hypochondrie
Wer kennt das nicht: Irgendwo zwickt es komisch, zieht, drückt, kribbelt oder tut weh. Für einen kurzen Moment sind wir beunruhigt - aber wenn das Gefühl schnell vorübergeht, vergessen wir es auch wieder schnell. Erst wenn es anhält und unseren Alltag einschränkt oder wir uns gleichzeitig krank fühlen, machen wir uns ernsthaft Sorgen. Doch ab wann ist das „einmal zu viel“ der Weg in die Hypochondrie?
In Deutschland leiden etwa sechs von 100 Menschen an einer leichten Form der Hypochondrie. Bei etwa einem von 100 Betroffenen sind die Ängste behandlungsbedürftig und beeinträchtigen den Alltag und das Wohlbefinden, heißt es auf der Website der Helios Kliniken Deutschland.
Lese-Tipp: Paradox! Studie findet heraus: Hypochonder sterben früher
Im Video: Diagnose Hypochondrie - so lebt Sina mit der Angst vor Krankheiten
Am Ende leidet auch das direkte Umfeld massiv
„Es fängt oft schleichend an“, weiß Diplom-Psychologe Michael Thiel, „man entdeckt Wehwehchen beliebiger Art, überhaupt Symptome auf der Haut oder Unwohlsein und dann gehen die Gedanken nicht mehr von diesem vermeidlichen Symptom einer Krankheit weg“. So gehe es weiter, bis später, vom morgendlichen Körpercheck bis zur permanenten Selbstbeobachtung, kein Moment mehr frei bleibe von Angst vor unklaren Symptomen, so der Experte.
Ein Teufelskreis aus Selbstbeobachtung und Überzeugung von schwerwiegenden Krankheiten entsteht: „Am Ende wird auch die Familie mit rein und in Mitleidenschaft gezogen.“
Diese Kriterien gelten laut ICD 11:
In der neuen Version der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD11) wird die hypochondrische Störung unter der Bezeichnung „Krankheitsangststörung“ geführt und damit jetzt, anders als im ICD10, als Zwangsstörung kategorisiert.
Als Diagnosekriterien sind dort definiert:
Exzessive Furcht vor einer oder mehreren ernsthaften Krankheiten, die auf eine gründliche ärztliche Untersuchung oder wiederholte ärztliche Beratung nicht angemessen reagiert
Die Krankheitsangst verursacht klinisch bedeutsames Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen
Die Krankheitsangst dauert mindestens sechs Monate an
Exzessive Furcht vor einer oder mehreren ernsthaften Krankheiten, die auf eine gründliche ärztliche Untersuchung oder wiederholte ärztliche Beratung nicht angemessen reagiert
Die Krankheitsangst verursacht klinisch bedeutsames Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen
Die Krankheitsangst dauert mindestens sechs Monate an
→ Macht hier den großen Selbst-Test: Nur besorgt - oder schon Hypochonder?
Wann bei Angehörigen die Alarmglocken schrillen sollten
Spätestens, wenn das tägliche Leben nur noch von vermeintlichen Krankheitssymptomen und Angst vor schweren Krankheiten bestimmt wird, sollten beim Betroffenen selbst oder seinen Angehörigen die Alarmglocken schrillen. „Die Lebensqualität wird eingeschränkt“, erklärt der Psychologe. „Es gibt nur noch dieses eine Thema und es gibt auch keine Chance mehr, den oder diejenige mit logischem Verstand zu erreichen. Der Hypochonder fühlt sich nur dann ernst genommen, wenn ihm bestätigt wird: ‚Oh ja, das könnte wirklich etwas ganz Schlimmes sein‘.“
Und das wiederum setze noch mehr Ängste in ihm oder ihr frei – ein Teufelskreis.
Frühkindliche Erfahrungen prägen - und Dr. Google fördert die Hypochondrie
Welche Faktoren begünstigen Hypochondrie - und hat „Dr. Google“ das Problem verschärft?
Frühkindliche Erfahrungen ebnen oft den Weg in die Hypochondrie, sagt der Psychologe. „Wir wissen, dass es in der Kindheit und Jugend der Betroffenen oft emotional stark belastende Ereignisse gab, die den normalen Umgang mit körperlichen Beschwerden erschwert oder gar unmöglich gemacht haben.“ Auch überängstliche Eltern oder ein von Stress geprägtes Umfeld tragen dazu bei. Kleine Krankheitsanzeichen werden dramatisiert, ein einfacher Schnupfen als bedrohlich empfunden.
Diese Unfähigkeit, normale Beschwerden einzuschätzen, kann dann zu einem ständigen Gefühl der Bedrohung führen.
Und natürlich lieben Hypochonder „Dr. Google“! „Sie recherchieren und tun und tun und sitzen vielleicht stundenlang vor dem PC und glauben ‚Dr. Google‘ mehr als einem echten Arzt“, weiß Thiel. „Und werden bei Dr. Google natürlich die Dinge selektiv wahrnehmen und Gründe suchen, die für eine Erkrankung sprechen und nicht gegen eine Erkrankung.“
Stimmt ab!
Die Ergebnisse der Umfrage sind nicht repräsentativ!
So wird eine Hypochondrie therapiert
Experten für hypochondrische Erkrankungen sind psychologische oder ärztliche Psychotherapeuten, die sich auf kognitive Verhaltenstherapie spezialisiert haben. „Dabei geht es darum, die Zwangsgedanken, die diesen hypochondrischen Symptomen zugrunde liegen, erst einmal aufzudecken und ihnen dann gesunde Gedanken entgegenzusetzen“, erklärt Thiel die Vorgehensweise. So sollen die Zwangsgedanken Schritt für Schritt reduziert werden. „Und damit letztlich auch die Lebensqualität wieder verbessert werden.“
Für die Angehörigen gilt dabei, so der Experte: Übertriebene Fürsorge und auch Schonung von hypochondrisch Erkrankten schaden mehr, als sie helfen.
„Also immer wieder ganz klar auch sagen: ‚Nein, ich sehe deine Symptome realistisch anders‘. Nicht das Spiel des Hypochonders mitspielen, nur um Ruhe zu haben!“
Lese-Tipp: Hilfe, mein Mann ist ein Hypochonder!
Hier finden Betroffene oder Angehörige Hilfe!
Erste Anlaufstelle ist der Hausarzt oder der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116117 oder im Internet unter 116117.de.
Die gute Nachricht: Die Erfolgsquote einer Therapie ist relativ hoch. Sie gelingt aber nur, wenn sich der Betroffene in seiner Krankheit vom Therapeuten wirklich aufgehoben und ernst genommen fühlt. In schweren Fällen können vorübergehend auch Psychopharmaka eingesetzt werden, in der Regel reicht aber eine Verhaltenstherapie aus.
Wichtig ist möglichst frühzeitiges Eingreifen - und eine genaue Diagnose. „Denn manchmal ist diese Hypochondrie nur Teil einer anderen psychischen Störung, etwa einer Depression oder einer Angststörung“, sagt Psychologe Thiel. „Das muss man richtig diagnostizieren, um eventuell auch die andere Erkrankung mitzubehandeln.“
Leben, Liebe, Lifestyle - auf RTL.de findest du alles, was deinen Alltag leichter, besser und schöner macht. Mach uns zu deiner Startseite, um mehr als andere zu wissen!