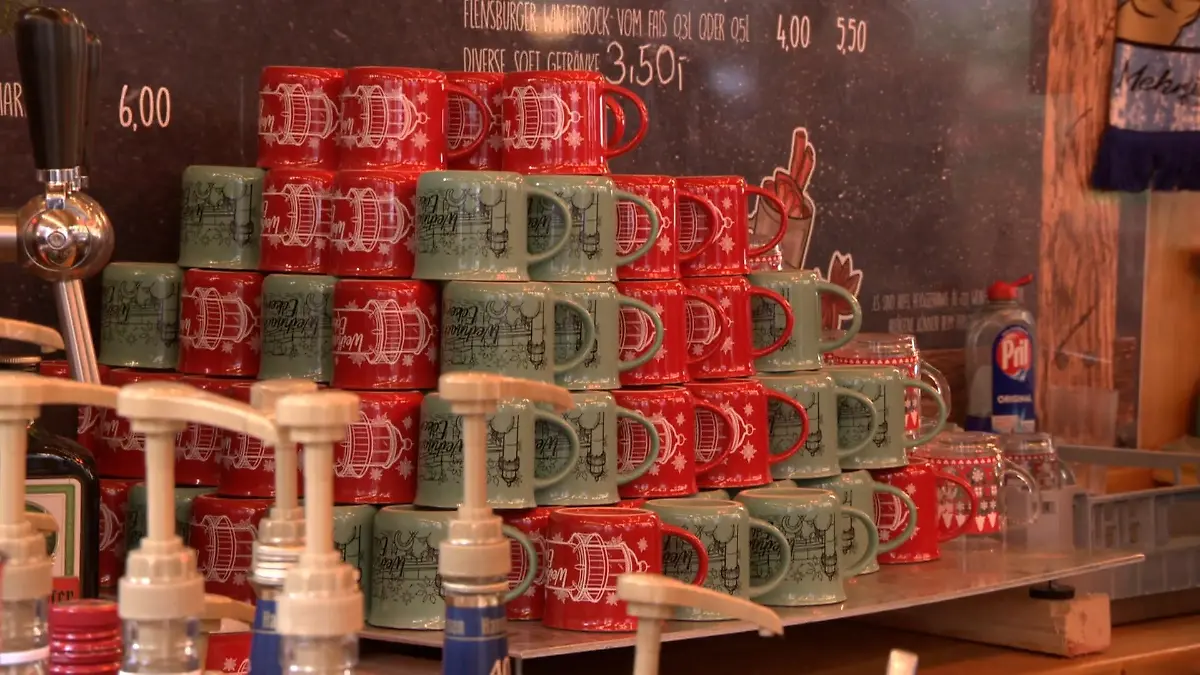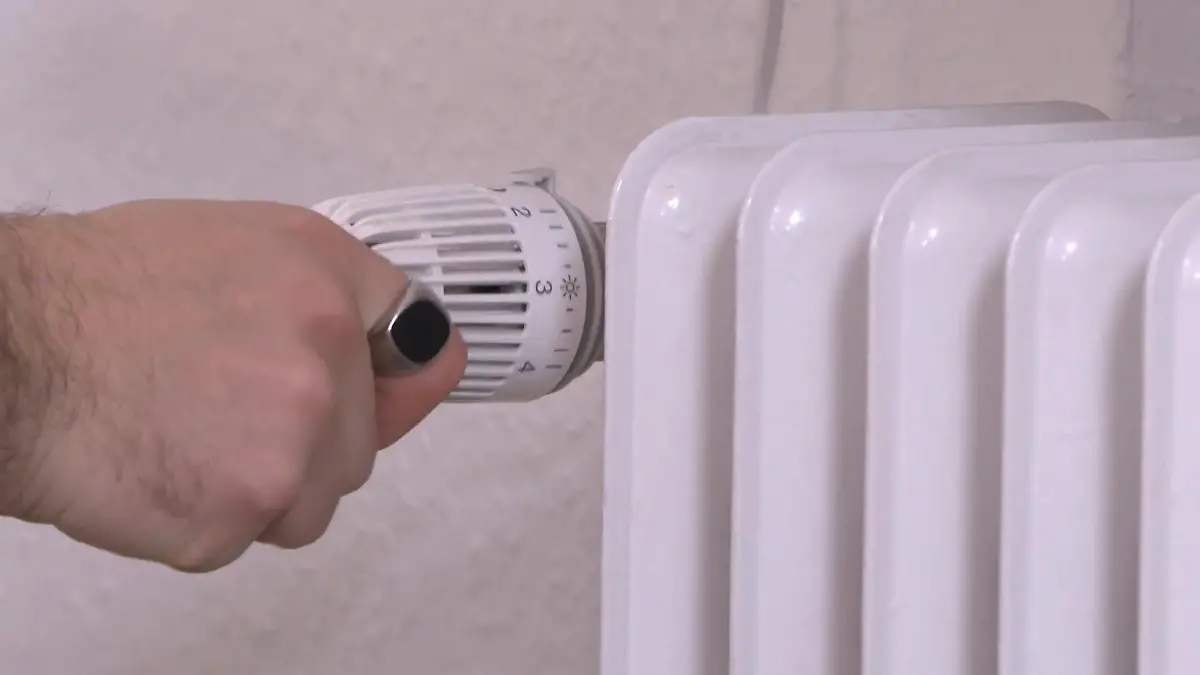Sie putzt uns von innenSchon gewusst, was die Milz genau kann?
Die Milz ist für unseren Körper wie eine Reinigungskraft.
So klein unsere Milz auch ist, so wichtig sind dennoch ihre Zuständigkeiten. Welche wichtigen Aufgaben sie in unserem Körper übernimmt und was es für Folgen hat, wenn man sie aus dem Körper herausnehmen muss, erfahrt ihr hier. Außerdem seht ihr oben im Video, unter welchen Umständen das Organ operativ entfernt werden sollte.
Welche Schmerzen auf Probleme mit der Milz hindeuten können
Jeder Mensch weiß, warum er eine Lunge, ein Herz und einen Magen hat. Doch nur die wenigsten wissen, warum sie unter dem Rippenbogen versteckt ein kleines Organ namens Milz haben, das neben seinen präsenteren und bekannteren Kollegen ein regelrechtes Schattendasein führt.
Allgemeinmediziner und Medizinjournalist Dr. Christoph Specht erklärt im RTL-Interview, wann ihr in Sachen Milz-Probleme einen Arzt aufsuchen solltet: „Man merkt eigentlich nur, dass mit der eigenen Milz etwas nicht stimmt, wenn sie größer wird. Dann kann die Milz wehtun, weil die sogenannte Milzkapsel gedehnt wird.“
Und weiter: „Wer Schmerzen unter der linken Rippe verspürt, der sollte abklären lassen, ob die Milz angeschwollen ist und die Schmerzen daher rühren.“ Dann sei klar, dass etwas nicht stimmt. „Die Milz gilt außerdem als besonders widerstandsfähig und kann außer nach einem Unfall nicht so einfach reißen“, erklärt der Experte. Kurzum: „Dieses Organ hält wirklich viel aus.“
Lese-Tipp: Mann (35) hat zwei Jahre lang Bauchweh – der Grund dafür schockiert seine Ärzte
Milz: Wofür das Organ zuständig ist
Doch welche Aufgaben hat die Milz eigentlich?
Die Milz – auch Splen oder Lien genannt – gehört zu unserem Lymphsystem, das eine sagenhafte Gesamtstrecke von 100.000 Kilometern in unserem gesamten Körper einnimmt. Das Lymphsystem kommt unter anderem dann zum Tragen, wenn sich Eindringlinge im Körper breitmachen, die von unserem Immunsystem bekämpft werden müssen. Denn in der Lymphe bewegen sich die körpereigenen Abwehrzellen.
Ganz grob sieht die Milz aus wie eine große Kaffeebohne. Sie ist etwa faustgroß, elf Zentimeter lang, sieben Zentimeter breit und vier Zentimeter dick. Normalerweise wiegt sie zwischen 150 und 200 Gramm. Sie besteht aus einem roten und einem weißen Gewebe – der roten und der weißen Pulpa.
Die Milz liegt im Oberbauch auf der linken Seite, unter dem Zwerchfell. Von außen ist sie nicht ertastbar, denn sie ist durch den Rippenbogen geschützt. Außerdem ist die Milz sehr gut durchblutet: So wird das komplette Blut in unserem Körper täglich etwa 500-mal durch sie hindurch gepumpt. Zuständig dafür ist die Milzschlagader.
Lese-Tipp: Gesundheitslexikon: Splenomegalie (Milzvergrößerung)
Die Aufgaben der Milz
Sind wir noch Kinder, ist unsere Milz vor allem damit beschäftigt, rote Blutkörperchen herzustellen, an die sich der aufgenommene Sauerstoff heften kann. Werden wir älter, übernimmt fortan das Knochenmark die Herstellung der roten Blutkörperchen und die Milz kümmert sich um die folgenden Aufgaben:
Die Milz ist ein Teil des Blutkreislaufes. Hierbei filtert die rote Pulpa, die man sich wie ein großes Bindegewebsnetz vorstellen kann, alle alten Blutzellen und Blutplättchen aus dem Blut heraus. In diesem Prozess recycelt sie gleichzeitig das in den roten Blutkörperchen enthaltene Eisen und baut schlussendlich die alten Blutzellen sowie beispielsweise auch kleine Blutgerinnsel ab.
Stärkung des Immunsystems
Die Milz ist wichtig für die Stärkung des Immunsystems.
Die weiße Pulpa ist an der Bildung und Speicherung von Lymphozyten beteiligt. Diese Untergruppe der weißen Blutkörperchen ist wichtig für die Abwehr von Krankheitserregern. Schlägt unser Körper Alarm, da er von Bakterien oder Viren angegriffen wird, strömen von der Milz unzählige Lymphozyten aus und bahnen sich über die Lymphe ihren Weg zu den Eindringlingen.
Zudem bildet die Milz die sogenannten Makrophagen – das sind Fresszellen, die körperfremde Stoffe – beispielsweise Viren oder Bakterien – erkennen und diese beseitigen. Vereinfacht gesagt, stärkt die Milz mit ihrer Arbeit also unser Immunsystem.
Lese-Tipp: Junge klagt über Bauchschmerzen! Ärzte entdecken Ladekabel in seinem Magen
Die Milz: Unser Energie-Speicher im Körper
Außerdem speichert die Milz eine gewisse Menge an Blut, die in Notfallsituationen an den Körper abgegeben werden kann – zum Beispiel, wenn wir innere Blutungen haben oder extrem angestrengt sind.
Lese-Tipp: Nach Organspende: Fünffachvater Hendrik Verst kämpft sich zurück ins Leben
Milz muss entfernt werden? Was dann passiert!
Doch auch ein Leben ohne Milz ist grundsätzlich möglich.
Wird sie operativ im Zuge einer Splenektomie entfernt, übernehmen teilweise andere Organe die Aufgaben der Milz. Zum Beispiel ist das Knochenmark für die Produktion der roten Blutkörperchen verantwortlich und die Lymphknoten für das Bekämpfen von Krankheitserregern. Ein operatives Entfernen ist dann wichtig, wenn beispielsweise eine Ruptur, also ein Riss der Milz als Unfallfolge, vorliegt.
Da die Milz so gut durchblutet ist, kann dies ohne OP schwerwiegende Folgen wie innere Blutungen haben.
Aber durch das Entfernen des Organs steigt gleichzeitig auch die Anfälligkeit für eine Blutvergiftung sowie das Infektionsrisiko – auch die Immunabwehr ist beeinträchtigt. Trotzdem gibt es in Deutschland jährlich etwa 8.000 Fälle, in denen die Milz entfernt wird.
Wichtig sind in diesen Fällen vorbeugende Impfungen, die Infektionen verringern und schwere Krankheitsverläufe vermeiden. Zu diesen Schutzimpfungen zählen Streptococcus pneumoniae (häufiger Erreger von Lungenentzündung), Haemophilus influenzae (verantwortlich für verschiedene Erkrankungen) und Meningokokken (Erreger von Hirnhautentzündung). (mjä)