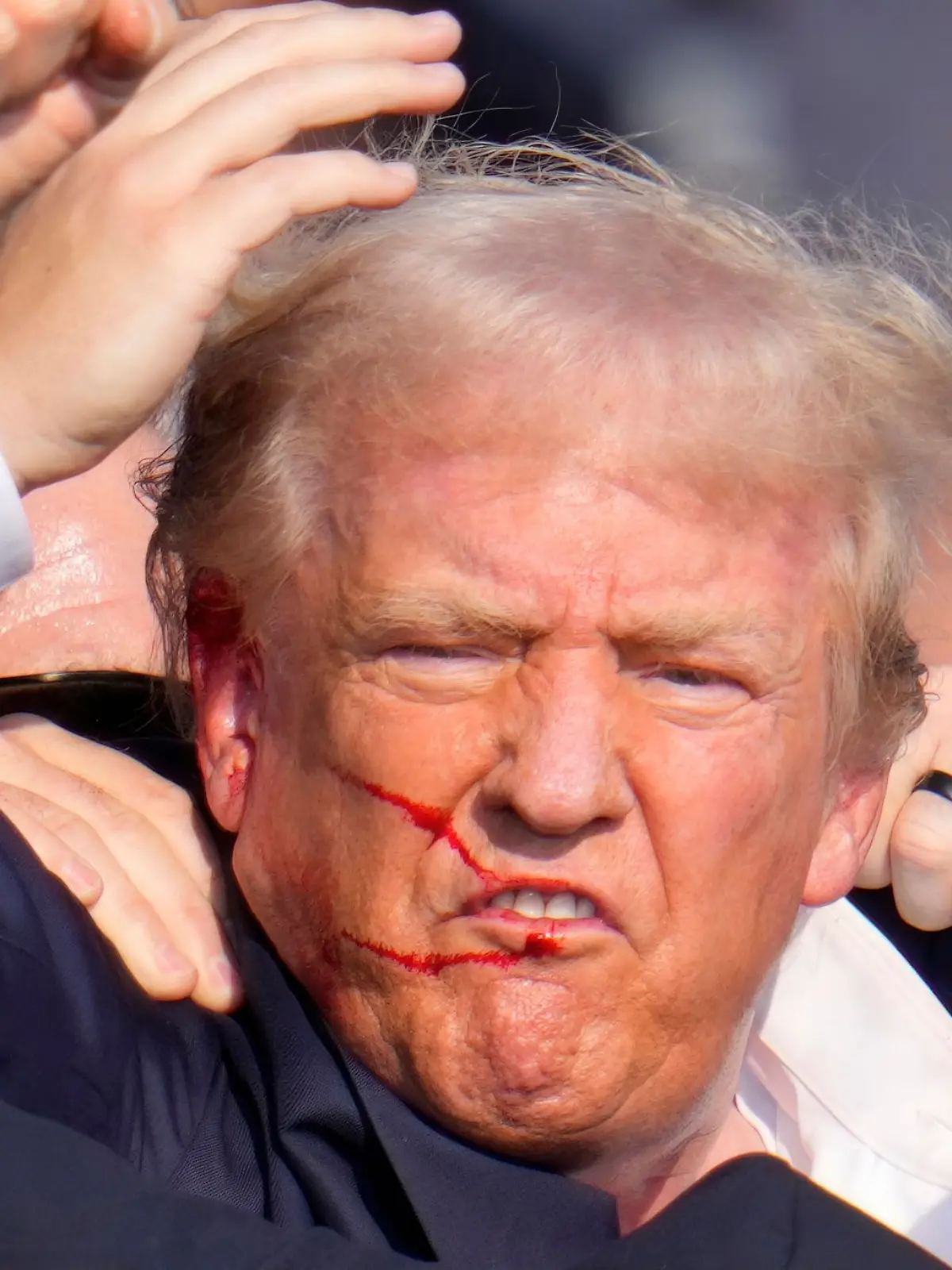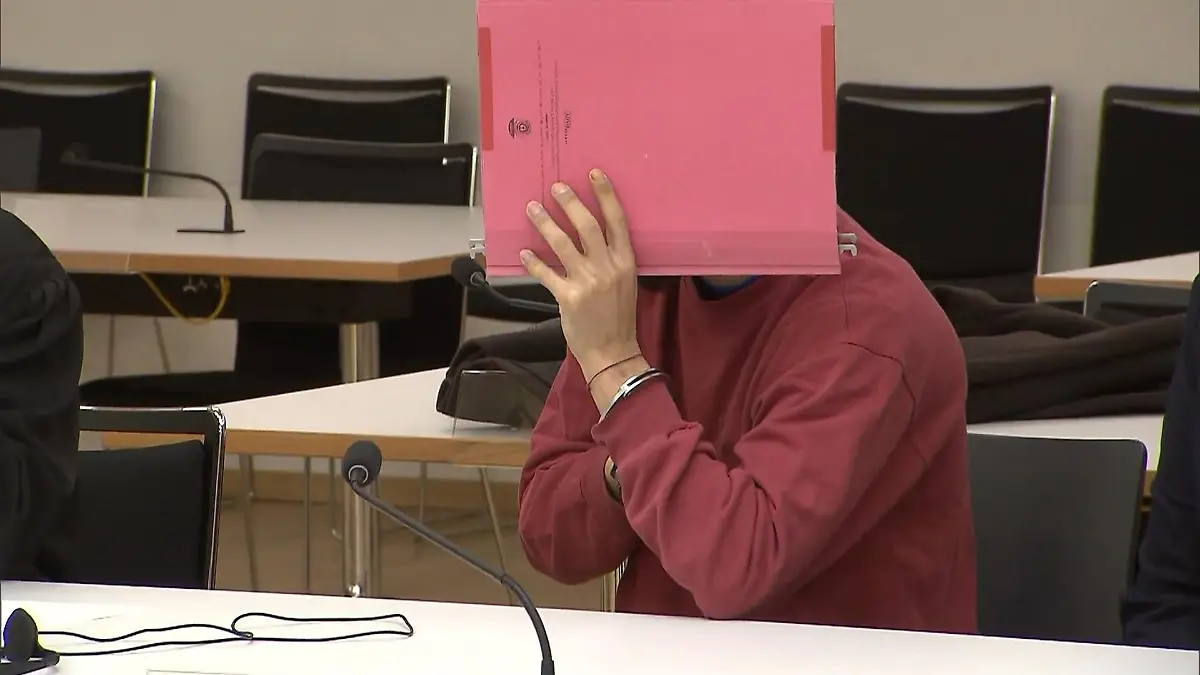Vertrauensstudie 2022 der Bepanthen-Kinderförderung in Berlin vorgestelltNeue Jugendstudie zeigt: Kontrolle ist gut, Vertrauen wird schlechter
Eine Studie hat das Vertrauen von Sechs- bis 16-Jährigen in sich selbst, die Zukunft und Institutionen untersucht. Dabei glauben rund zwei Drittel der Befragten, dass man den meisten Menschen nicht vertrauen kann. Außerdem unterstellt ein Drittel der Kinder und Jugendlichen klassischen Nachrichtenmedien, bewusst falsche Informationen zu verbreiten. Die Leiter der Studie sehen vor allem zwei Faktoren ursächlich für den Vertrauensverlust. Was die Jugendlichen selbst sagen, zeigen wir im Video.
Jugendliche unterstellen Falschinformationen
71,6 Prozent der Jugendlichen haben mit diesem Artikel ein Problem. Denn sie vertrauen Journalisten nicht. So das Ergebnis eine Studie der Bepanthen-Kinderförderung, bei der über 1.500 Kinder befragt wurden. Da ich aber Journalist bin, bedeutet das, dass fast drei von vier Befragten nicht darauf vertrauen, dass die Informationen hier stimmen. 37,9 Prozent der Jugendlichen glauben sogar, dass Medien gezielt Falschinformationen streuen.
Mein Beteuern, dass ich niemals absichtlich falsche Informationen streuen würde und die Zahlen der Studie aus der zuverlässigsten Quelle, nämlich von den Leitern der Studie selbst habe, dürfte bei den Skeptikern nur wenig bringen. Deshalb gibt es die Ergebnisse hier für jeden zum Nachprüfen.
Kinder und Jugendliche lassen sich vor allem von ihren Eltern beeinflussen
Denn es lohnt sich, die Studie genauer zu betrachten. Die Ergebnisse sind nicht immer überraschend, aber doch erschreckend. Schließlich ist keine gute Voraussetzung für unser Zusammenleben, wenn zwei Drittel der Kinder und Jugendlichen glauben, dass man anderen Menschen eher nicht vertrauen kann. Und es ist auch kein gutes Zeichen, wenn nur jeder fünfte Befragte an eine optimistische Zukunft für die Gesellschaft glaubt.
Wo Vertrauen fehlt, da ist Platz für alternativen Wahrheiten (was einfach nur eine andere Formulierung für „Lügen“ ist). Beeinflusst wird das vor allem durch zwei Faktoren, erklärt Studienleiter Prof. Holger Ziegler von der Universität Bielefeld: „Die Vertrauensstudie 2022 zeigt, dass die Anfälligkeit zur Verschwörungsneigung schon bei einem Drittel der Jugendlichen ausgeprägt ist und Eltern einen wesentlichen Einfluss auf diese Entwicklung bei ihren Kindern haben.“
Heißt: Wenn schon Eltern Verschwörungen wittern, überträgt sich das oft auf die Kinder. Der zweite Faktor ist der soziokönomische Status. Jugendliche aus Familien mit wenig Geld neigen deutlich stärker dazu, anfällig für Verschwörungen zu sein, so das Ergebnis der Studie.
Jugendliche sorgen sich um Klima und Umwelt
Bleibt die Frage: Wie lässt sich das Vertrauen wiederherstellen?
Helfen könnte zum einen, sich mit den Ängsten der Jugendlichen auseinanderzusetzen. Bei den 12- bis 16-Jährigen steht der Klimawandel auf Rang eins des Angst-Rankings, gefolgt von Umweltverschmutzung. Trotzdem fühlen sich beispielsweise auch viele Teilnehmer der Fridays-For-Future-Demonstrationen zu wenig beachtet oder ernst genommen. Außerdem sollten Eltern das Gespräch mit ihren Kindern suchen. Die Studie zeigt: Werden Kinder nur selten nach ihrer Meinung gefragt, verstärkt das ihre Verschwörungsneigung.
Eine Erfahrung die Bernd Siggelkow von der Kinderhilfsorgansation „Die Arche“ teilt. Auch er war heute Teil der Präsentation der Studie, um sie mit seiner praktischen Erfahrung in seiner Arbeit mit hilfsbedürftigen Kindern, in seiner Arbeit als Pastor und auch als sechsfacher Vater zu unterstützen. Seiner Meinung nach fehlen vor allem dauerhafte Ansprechpartner:
„Jedes Kind fragt jeden neuen Mitarbeiter, der in unsere Einrichtung kommt oder jede Mitarbeiterin, die gleiche Frage: Sie fragen immer: „Wie lange bleibst du? Kann ich mich auf dich verlassen? Kann ich meine Sorgen an dich weitergeben?“
Seine Forderung: Vertrauenspersonen in öffentlichen Einrichtungen, insbesondere auch in Schulen. Denn sowohl Eltern und auch Lehrer sind häufig einfach damit überfordert, der Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin zu sein, den Kinder und Jugendliche so dringend brauchen.