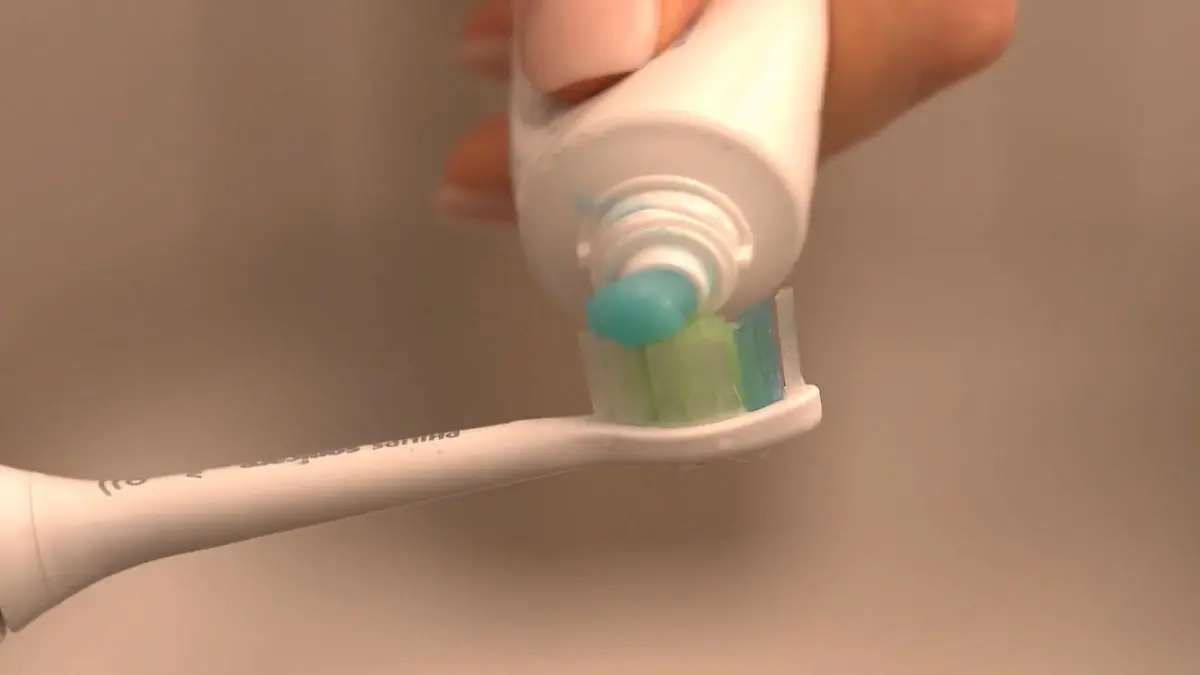Essen UND Trinken sind tabu!Trockenfasten: So funktioniert die extremste Form des Fastens und das sind die Risiken
Beim Trockenfasten handelt es sich um die extremste Form des Fastens. Dabei wird nicht nur auf feste Nahrung verzichtet, wie es bei den meisten Fastenarten der Fall ist, sondern auch auf Flüssigkeit. Die Idee dahinter: Der komplette Verzicht auf Essen und Getränke soll nicht nur den Gewichtsverlust beschleunigen, sondern auch die Selbstheilungskräfte des Körpers auf ein Maximum pushen. Die Yoga-Meisterin Sophie Partik hat jüngst über ihre durchweg positiven Erfahrungen beim Trockenfasten berichtet. RTL-Ernährungsexpertin Nora Rieder erklärt, was genau das Trockenfasten im Körper bewirkt.
Trockenfasten ist nicht gleich Trockenfasten
Auch wenn das Trockenfasten in Deutschland wenig bekannt ist, ist die Fastenart nicht neu. Viele Kulturen weltweit praktizieren sie seit Generationen als Reinigungsritual. Der Grundgedanke dahinter: Wenn wenn der Körper nicht mit Verdauungsprozessen beschäftigt ist, kann er sich voll und ganz auf die Regeneration des Körpers konzentrieren. Russland zählt zu den wenigen Ländern, in denen das Trockenfasten auch heute noch regelmäßig praktiziert wird.
Es wird zwischen mildem und absolutem Trockenfasten unterschieden. Während beim milden Trockenfasten geduscht und die Zähne geputzt werden dürfen, wobei der Körper über die Haut Wasser aufnimmt, ist dies beim strengen oder absoluten Trockenfasten nicht erlaubt.
Das passiert beim Trockenfasten im Körper
Die Idee hinter dem „No Water"-Trend: Durchs Trockenfasten soll der Körper von Krankheitskeimen befreit werden, der Körper entsäuert und die Symptome vieler chronischer Krankheiten sollen sich bessern. Der Grund für die vielen positiven Effekte und die Stärkung des Immunsystems liegt ihrer Meinung nach in der Trockenlegung des Körpers: Viele Bakterien und Viren benötigen Wasser, um sich zu vermehren. Steht dies nicht zur Verfügung, sterben sie ab, so die Theorie.
Die Wasserkritiker bezeichnen Wasser aus dem Wasserhahn als „totes Wasser“, das dem Körper aufgrund von Verunreinigungen durch die Landwirtschaft oder verschiedene Rohrsystem schaden kann. Demgegenüber versorge das „lebendige Wasser“ aus Obst und Gemüse den Körper mit allen wichtigen Nährstoffen, Vitaminen und Mineralstoffen. Flüssigkeit wird beim Trockenfasten daher ausschließlich über Früchte, Gemüse und Säfte aufgenommen, auch Kokoswasser ist erlaubt.
Manche glauben auch an die Theorie, dass kranke Zellen, Bakterien und Viren absterben, wenn der Körper trockengelegt wird.
RTL-Ernährungsexpertin Nora Rieder erklärt: „Es gibt viele verschiedene Fastenmethoden. Ihnen allen liegt der Gedanke einer Entlastung und Reinigung des Körpers zugrunde. Außerdem hilft Fasten beim Abnehmen: Wenn dem Körper keine Energie in Form von Nahrung zugeführt wird, greift es zunächst auf die gespeicherten Kohlenhydrate und Eiweiße zurück, bis er nach spätestens drei bis vier Tagen die Fettdepots angreift.“ Mit dem Ergebnis, dass die Speckröllchen verschwänden. Weiterer positiver Nebeneffekt: „Der Blutdruck sinkt und die Blutgefäße werden entlastet, sodass auch das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen sinkt. Wenn wir unserem Körper jedoch kein Wasser oder insgesamt nur wenig Flüssigkeit zuführen, droht eine Dehydration des Körpers“, so Rieder.
Trockenfasten birgt große Gesundheitsrisiken
Auch wenn das Trockenfasten viele positive Aspekte hat und unter anderem den Verzehr von frischen, unverarbeiteten Lebensmitteln wie Obst und Gemüse empfiehlt, gilt: Um die positiven Effekte des Fastens zu erzielen, müssen Sie nicht Trockenfasten. Im Gegenteil: „Der Verzicht auf Wasser über mehrere Tage oder sogar Wochen kann dem Körper massiv schaden“, warnt die Ernährungsexpertin. Wasser werde für alle Stoffwechselvorgänge im Körper benötigt: „Unser Blut besteht zu etwa 90% aus Wasser und wird vom Herz durch alle Teile unseres Körpers gepumpt. Dabei transportiert es Vitamine, Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate und andere Nährstoffe in die einzelnen Zellen“, erläutert Rieder. Genauso würden Stoffwechselendprodukte und Giftstoffe zurücktransportiert und über die Nieren ausgeschieden. Daher sei unser Körper auf die Zufuhr von Wasser angewiesen.
Wer das Trockenfasten dennoch ausprobieren möchte, muss seinen Körper schonend auf den kompletten Nahrungsverzicht vorbereiten. Reduzieren Sie die Nahrungszufuhr in der Woche vor Fastenbeginn langsam. Trinken sollten Sie jedoch reichlich. Ein guter Indikator für Ihren Trinkstatus ist die Farbe des Urins: je heller dieser ist, umso besser sind sie mit Flüssigkeit versorgt.
Wichtig: Starten Sie langsam und nur dann, wenn sie gesund sind. Fasten Sie zunächst nicht länger als 24 Stunden – also einen Tag – pro Monat und schauen Sie, wie Sie sich fühlen. Die größte Gefahr stellt die Austrocknung des Körpers (Dehydration) dar. Daher sollten Sie auch auf übermäßigen Sport, Saunabesuche und ähnliches während des Trockenfastens verzichten. So äußert sich eine Dehydration:
Kopfschmerzen
niedriger Blutdruck
Konzentrationsprobleme
Kreislaufbeschwerden
Herzrasen
Stellen Sie eines dieser Symptome bei sich fest, sollten Sie das Trockenfasten sofort abbrechen und einen Arzt aufsuchen, sollten sich die Symptome nicht bessern.
Alternativ könnten Sie auch mehrere Tage in Folge für jeweils zwölf bis 16 Stunden trockenfasten. In den übrigen Stunden sollten Sie aber definitiv Wasser zu sich nehmen, um einer Dehydration entgegenzuwirken. Ansonsten riskieren Sie ernste gesundheitliche Folgen. Wenn Sie länger als drei Tage trockenfasten möchten, sollten Sie unbedingt im Vorfeld Ihren Hausarzt konsultieren – das gilt übrigens bei jeder Art des Fastens, die über einen längeren Zeitraum durchgeführt werden soll.
Für diese Personengruppen eignet sich (Trocken-)Fasten NICHT!
Grundsätzlich sollten nur gesunde Menschen fasten. Folgende Personengruppen sollten nicht oder nur unter ärztlicher Kontrolle fasten:
Menschen mit Untergewicht
Senioren
Schwangere und Stillende
Kinder und Teenager
Menschen mit chronischen Krankheiten, die regelmäßig Medikamente einnehmen müssen
Für alle anderen verspricht das Fasten – über einen begrenzten Zeitraum und gegebenenfalls unter ärztlicher Kontrolle - viele positive Effekte:
bessere Immunabwehr und damit weniger Erkrankungen
effizienter Gewichtsverlust
gesteigerte Fettverbrennung
Stabilisierung des Blutdrucks
verbesserte Blutzuckerwerte
Aber: Wer seinem Körper etwas Gutes tun möchte, sollte eine weniger radikale Form des Fastens als das Trockenfasten wählen. Die positiven Auswirkungen von Intervallfasten oder Heilfasten sind belegt und die Vorgaben moderat. Damit sind diese Methoden gerade für Menschen, die das erste Mal fasten, leichter umzusetzen.
Die richtige Vorbereitung ist alles - auch beim Fasten

Zu Beginn jeder Form des Fastens ist eine Darmreinigung sinnvoll. Dadurch wird der Darm entlastet und vollständig geleert, wodurch das Hungergefühl beim Fasten geringer ist und der Nahrungsverzicht folglich leichter ist.
Generell sollten Sie das Fasten in einer Zeitspanne durchführen, in der Sie wenig Stress haben – daher empfiehlt sich die Urlaubszeit. Während des Fastens sollten Sie Anstrengungen durch schwere körperliche Arbeit vermeiden, um die durch das Fasten angekurbelte Regeneration des Körpers zu unterstützen.
Aufbauphase: So finden Sie in Ihren normalen Essrhythmus zurück!
Wenn Sie die Fastenphase beenden wollen, sollten Sie genauso langsam vorgehen wie zu Beginn des Fastens. Für das sogenannte Fastenbrechen sollten Sie mindestens zwei Tage einplanen. Als einfache Faustregel können Sie sich merken: Die Aufbauphase beim Fastenbrechen sollte etwa ein Drittel der Fastenzeit dauern.
Starten Sie zunächst mit der Zufuhr von Säften und integrieren Sie dann andere stark wasserhaltige Lebensmittel wie Gemüse und Obst in Ihre Ernährung. Am zweiten Tag können gekochtes Gemüse und geringe Mengen an Vollkornprodukten, wie beispielsweise Haferflocken, den Darm durch die enthaltenen Ballaststoffe wieder in Schwung bringen. Auch zu leichten Milchprodukten Joghurt und Quark, aber auch zu leichterverdaulichen Lebensmitteln wie Reis und Kartoffeln können Sie greifen. Wenn Sie Ihren Körper wieder an feste Nahrung gewöhnt haben und die Verdauung wieder in Schwung gekommen ist, steht der gewohnten Ernährung in Ihrem eigenen Essrhythmus nichts im Wege.