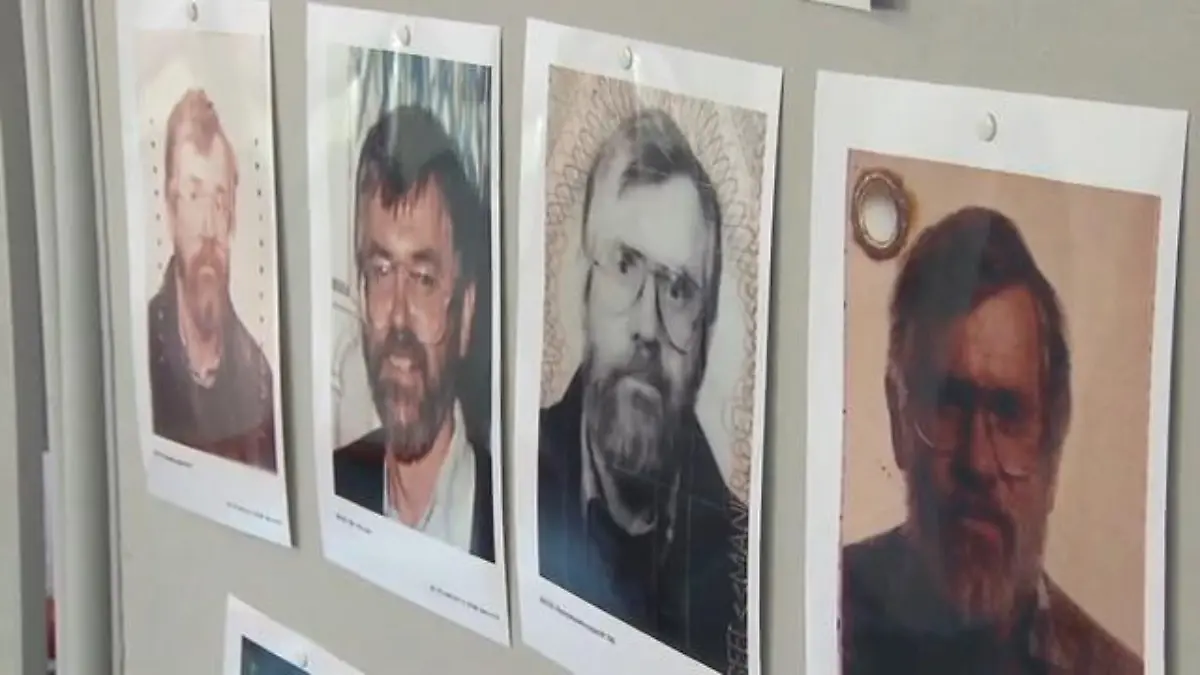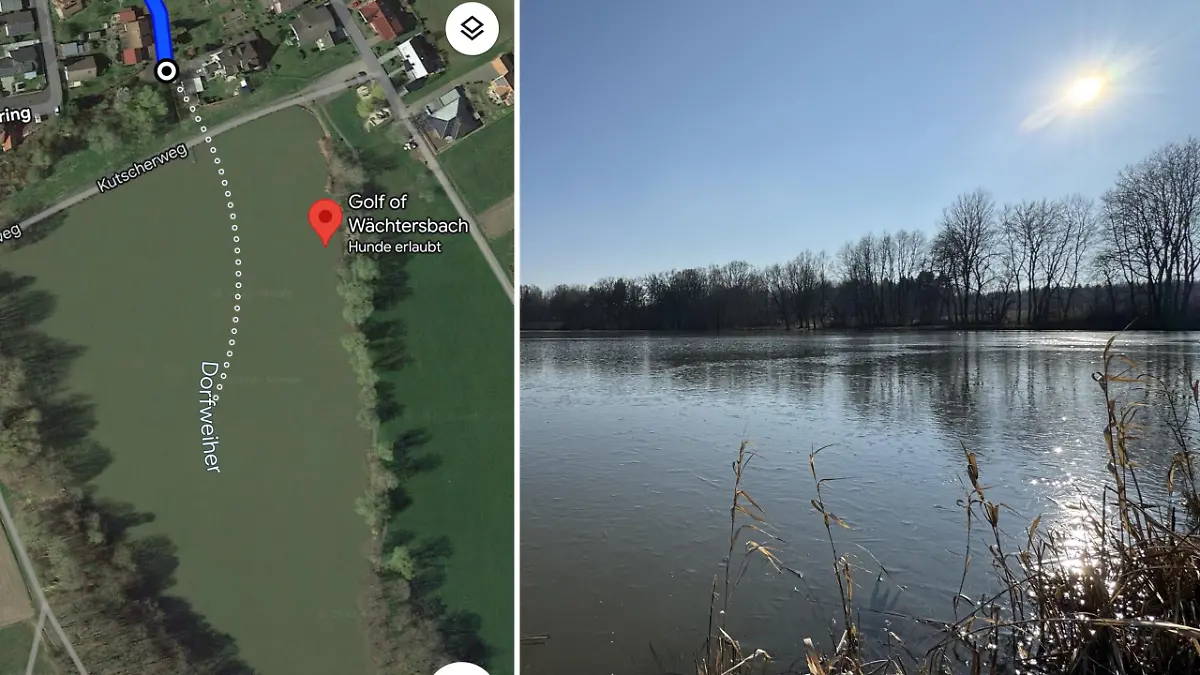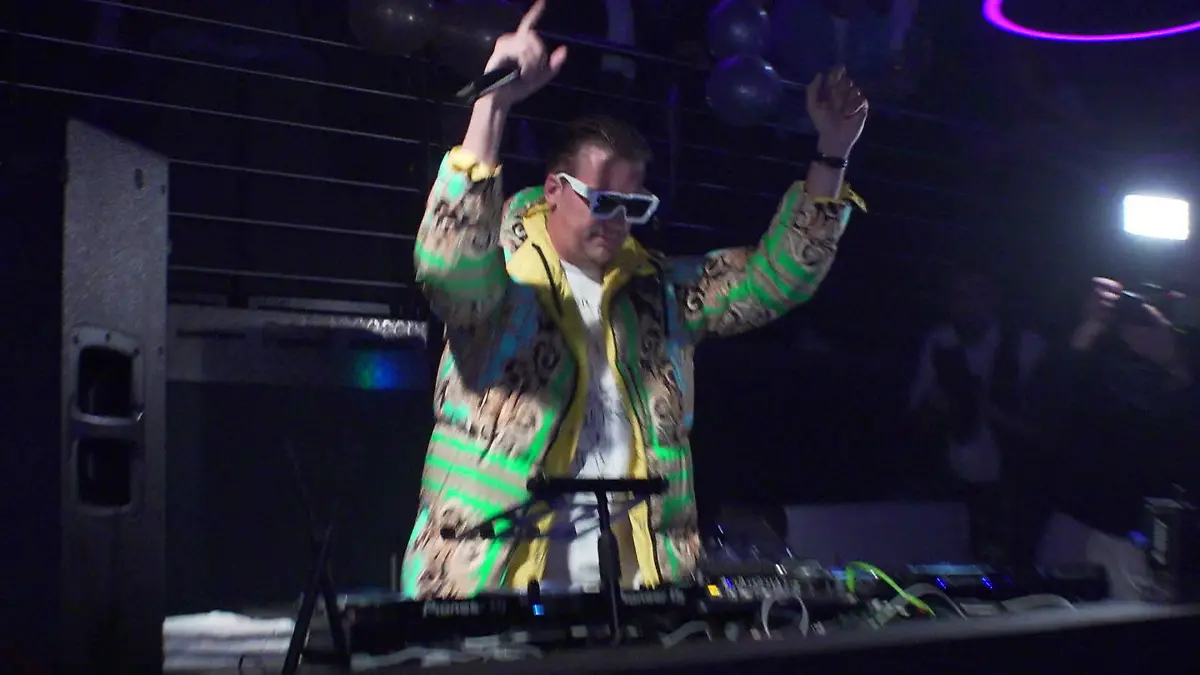Schweinesoldat mit Davidstern?Antisemitismus-Eklat bei documenta - Kunstwerk wird verdeckt!
Am Wochenende öffnete die Kasseler „documenta fifteen“ ihre Pforten für die Öffentlichkeit. Die Ausstellung für zeitgenössische Kunst steht aktuell enorm unter Druck. Hintergrund ist das Werk der Künstlergruppe Taring Padi, das antisemitische Abbildungen zeigt. Auf dem großflächigen Banner am Kasseler Friedrichsplatz ist unter anderem ein Soldat mit Schweinsgesicht zu sehen. Er trägt ein Halstuch mit einem Davidstern und einen Helm mit der Aufschrift „Mossad“ - die Bezeichnung des israelischen Auslandsgeheimdienstes. Die Verantwortlichen der documenta reagierten nun auf die Kritik und verhüllten das Kunstwerk.
"Das ist klare antisemitische Hetze"
Der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, Meron Mendel, forderte am Montag die Verantwortlichen der Weltkunstausstellung in Kassel auf, den Beitrag des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi wegen der antisemitischen Motive zu entfernen. „Das ist eine klare Grenzüberschreitung“, sagt Mendel der Deutschen Presse-Agentur. „Diese Bilder lassen überhaupt keinen Interpretationsspielraum zu. Das ist klare antisemitische Hetze.“

Künstlegruppe veröffentlicht Statement
Die Künstlergruppe Taring Padi hat mittlerweile ein öffentliches Pressestatement veröffentlicht und weist jeglichen Vorwurf des Antisemitismus von sich. In dem Statement heißt es: „Taring Padi ist ein progressives Kollektiv, das sich für die Unterstützung und den Respekt von Vielfalt einsetzt. Unsere Arbeiten enthalten keine Inhalte, die darauf abzielen, irgendwelche Bevölkerungsgruppen auf negative Weise darzustellen.“
Die als antisemitisch deklarierten Bildnisse erklären sie wie folgt: „Alle auf dem Banner abgebildeten Figuren nehmen Bezug auf eine im politischen Kontext Indonesiens verbreitete Symbolik, z.B. für die korrupte Verwaltung, die militärischen Generäle und ihre Soldaten, die als Schwein, Hund und Ratte symbolisiert werden, um ein ausbeuterisches kapitalistisches System und militärische Gewalt zu kritisieren.“
Nichtsdestotrotz entschied sich das Künstlerkollektiv gemeinsam mit der Leitung der documenta dazu, das Kunstwerk mit einem Banner zu verhüllen.
Auch Politik zeigt sich betroffen
Auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth fand deutliche Worte: „Das ist aus meiner Sicht antisemitische Bildsprache“, teilte die Grünen-Politikerin mit. „Ich sage es noch einmal: Die Menschenwürde, der Schutz gegen Antisemitismus wie auch gegen Rassismus und jede Form der Menschenfeindlichkeit sind die Grundlagen unseren Zusammenlebens, und hier findet auch die Kunstfreiheit ihre Grenzen.“ Die documenta müsse das umgehend gegenüber den Kuratoren und Künstlern deutlich machen. „Auch mein persönlicher Eindruck ist, dass hier eine antisemitische Bildsprache vorliegt“, teilte die stellvertretende documenta-Aufsichtsratsvorsitzende, Hessens Kunstministerin Angela Dorn (Grüne), mit.

Knobloch entsetzt über "blanken Judenhass"
„Als Mitglied der jüdischen Gemeinschaft, aber auch als Bürgerin dieses Landes bin ich entsetzt über den blanken Judenhass, der sich im Bild von Taring Padi zeigt. Personen mit Schläfenlocken und SS-Runen, dazu ein Schweinekopf mit der Aufschrift ´Mossad´“ - das sei plump antisemitisch, sagte Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, am Montag in München. Das Gemälde teilweise zu verdecken und der Grenzüberschreitung „durch Anbringung einer Fußnote die Spitze nehmen zu können, ist absurd“. Die antisemitischen Vorfälle rund um diese documenta seien zu einem Thema für die gesamte Gesellschaft geworden.

Taring Padi entschuldigt sich
Obwohl die Künstlergruppe in ihrem Statement erklärt, dass ihr Kunstwerk aus ihrer Sicht keine antisemitischen Bildnisse verbreitet, entschuldigen sie sich öffentlich. Sie schreiben: „Die Ausstellung von People’s Justice auf dem Friedrichsplatz ist die erste Präsentation des Banners in einem europäischen und deutschen Kontext. Sie steht in keiner Weise mit Antisemitismus in Verbindung. Wir sind traurig darüber, dass Details dieses Banners anders verstanden werden als ihr ursprünglicher Zweck. Wir entschuldigen uns für die in diesem Zusammenhang entstandenen Verletzungen. Als Zeichen des Respekts und mit großem Bedauern decken wir die entsprechende Arbeit ab, die in diesem speziellen Kontext in Deutschland als beleidigend empfunden wird.“
Das verhüllte Kunstwerk solle nun zu „einem Denkmal der Trauer über die Unmöglichkeit des Dialogs in diesem Moment“ werden. (kmü/dpa)