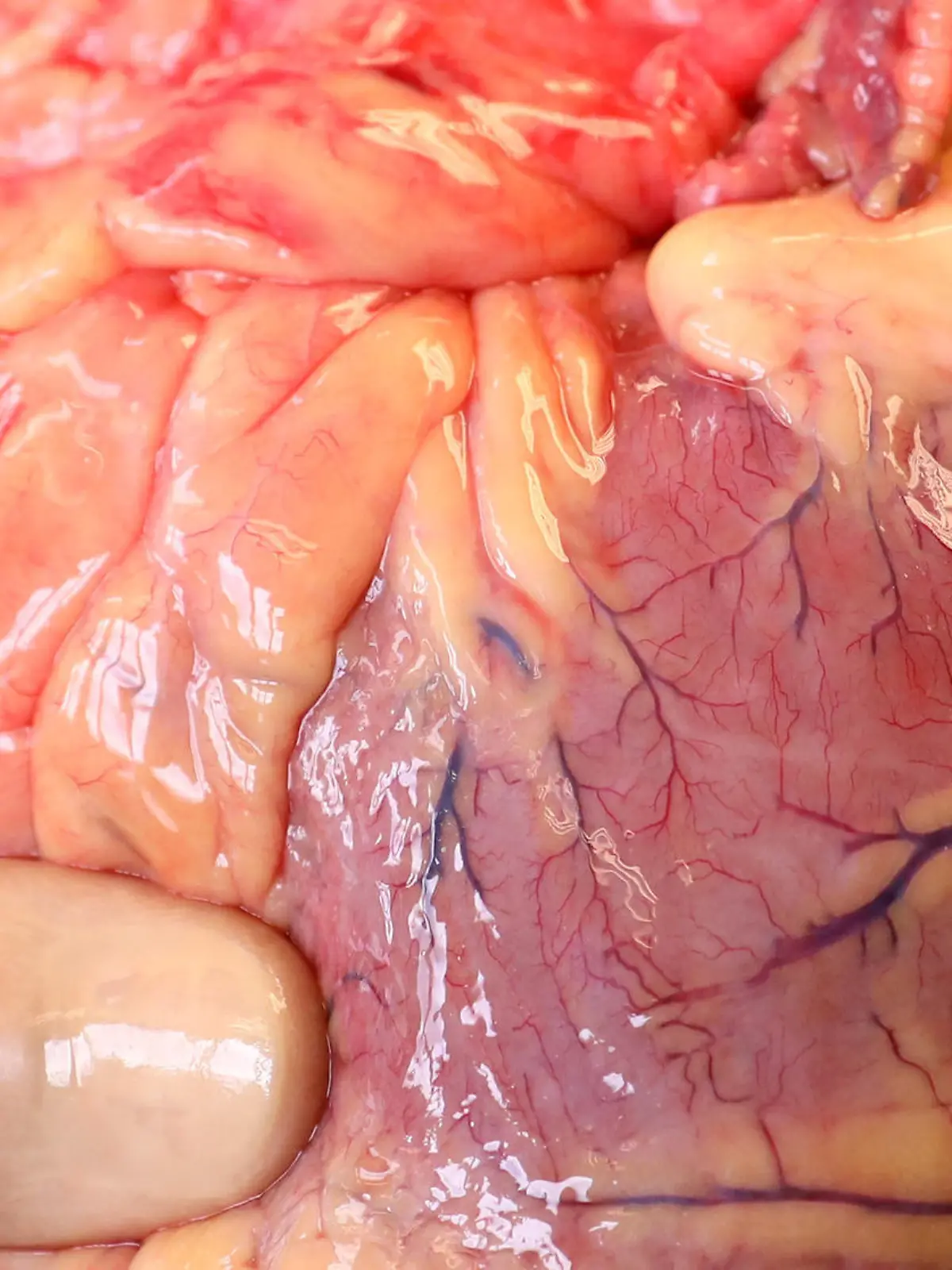Eine psychotherapeutische MethodeGesundheitslexikon: Verhaltenstherapie

Verhaltenstherapie ist ein Bereich der Psychotherapie, unter den viele unterschiedliche Therapieformen fallen. Sie alle haben gemeinsam, dass die Konditionierung als zentral für die Psyche angesehen wird. Die Hilfe zur Selbsthilfe steht bei der Verhaltenstherapie im Mittelpunkt. Der Patient soll zu einer inneren Haltung geführt werden, die ihm dazu ermächtigt, seine psychischen Probleme letztlich aus eigener Kraft zu bewältigen.
Methoden der Verhaltenstherapie
Die Basis der Verhaltenstherapie ist die Lerntheorie. Dadurch, dass Verhalten irgendwann erlernt werden musste, ist es auch möglich, es sich wieder abzugewöhnen, wenn es Probleme bereitet. Innerhalb der letzten Jahrzehnte haben sich viele verschiedene Formen der Verhaltenstherapie entwickelt, die sich in ihren Methoden teilweise deutlich unterscheiden.
Am Beginn jeder Therapie steht eine Verhaltens- und Problemanalyse, auf deren Basis die optimale Methode zur Überwindung falsch eingelernter Muster ausgewählt wird. Wichtig für die Analyse ist dabei die allgemein bekannte Gesprächspsychotherapie.
Es sind mehr als 50 verschiedene Verfahren der Verhaltenstherapie bekannt, die sich in Gruppen zusammenfassen lassen: Die Gruppe der Konfrontationstherapien baut auf Verfahren der klassischen Konditionierung auf. Ziel ist die Extinktion, die Gegenkonditionierung oder die Habituation, also eine Umgewöhnung. Speziell bei Zwangsstörungen, Phobien und Panikstörungen werden diese Verfahren angewendet. Dazu gehört die Systematische Desensibilisierung, Flooding, bei dem der Patient mit dem Stimulus unmittelbar und in höchster Intensität konfrontiert wird, oder die Aversionsherapie.
Bei sogenannten operanten Verfahren versucht man, das Verhalten über positive oder negative Verstärkung oder Bestrafung zu modifizieren. Die wird unter anderem bewerkstelligt durch Biofeedback, Token-Systeme, Rollenspiele oder Kommunikationstraining.
Ebenfalls häufig angewendet wird die kognitive Verhaltenstherapie. Sie basiert auf der Theorie, dass Individuen aktiv Informationen interpretieren und transformieren, welche das Verhalten beeinflussen. Nach ihr sind Verhaltensprobleme das Ergebnis falscher Annahmen beziehungsweise unvollständiger Schlüsse und inadäquater Selbstinstruktionen. Bei der kognitiven Verhaltenstherapie werden unter anderem Techniken angewendet wie Ärgermanagement, Stressmanagement, Attributionstherapie und Problemlösetraining.
Aus der Verhaltenstherapie ist später die Verhaltensmedizin entstanden. Der Gedanke hierbei ist, Menschen mit medizinischen Krankheiten, die beispielsweise zu sozialer Isolation oder zu aggressivem Verhalten führen können, darauf einzustellen besser damit umzugehen.
Wann Verhaltenstherapie angewendet wird
Verhaltenstherapie kommt bei vielen psychosomatischen Erkrankungen und psychischen Störungen zum Einsatz. Dazu gehören Therapien bei Drogenabhängigkeit, wie beispielsweise der Alkoholismus, und affektive Störungen, zu denen Depressionen zu zählen sind. Auch Belastungsstörungen, Essstörungen wie Bulimie, Persönlichkeitsstörungen und Angststörungen gehören zu den Einsatzgebieten, bei denen Verhaltenstherapien Erfolge erzielen können.
Finden Sie den richtigen Therapeuten und die richtige Therapie
Bevor Sie sich in Behandlung begeben, sollten Sie auf jeden Fall einen großen Augenmerk auf die Auswahl eines passenden Therapeuten legen. Dieser sollte Ihnen sympathisch sein und einen seriösen Eindruck erwecken. Auf Basis eines Erstgespräches und der Erstanalyse können Sie sich vom Therapeuten Behandlungsmethoden vorschlagen lassen. Entscheiden Sie sich prinzipiell für Methoden, mit denen Sie persönlich einverstanden sind – verlassen Sie sich auf Ihr intuitives Urteil. Eine Liste mit infrage kommenden Therapeuten in der Umgebung finden Sie in Suchmaschinen im Netz oder Sie erhalten konkrete Vorschläge von Ihrem Hausarzt, wenn dieser ebenfalls zu dem Urteil kommt, dass eine Therapie angezeigt ist.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel kann einen Besuch beim Arzt nicht ersetzen. Er enthält nur allgemeine Hinweise und darf daher keinesfalls zu einer Selbstdiagnose oder Selbstbehandlung herangezogen werden.