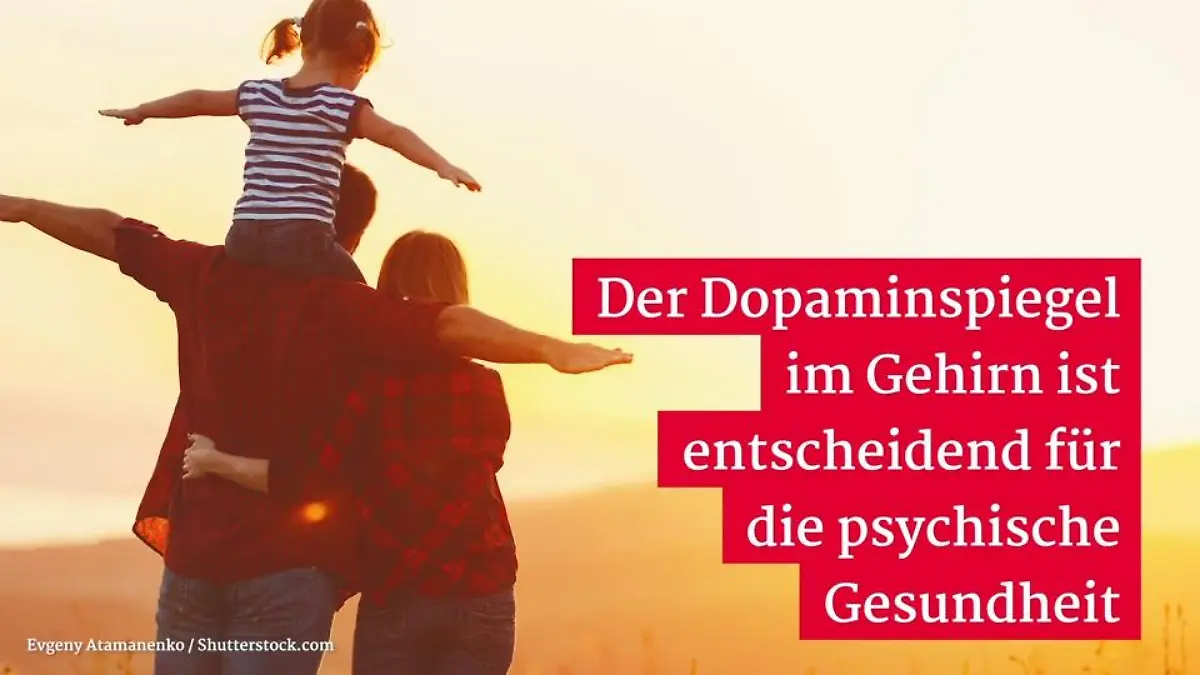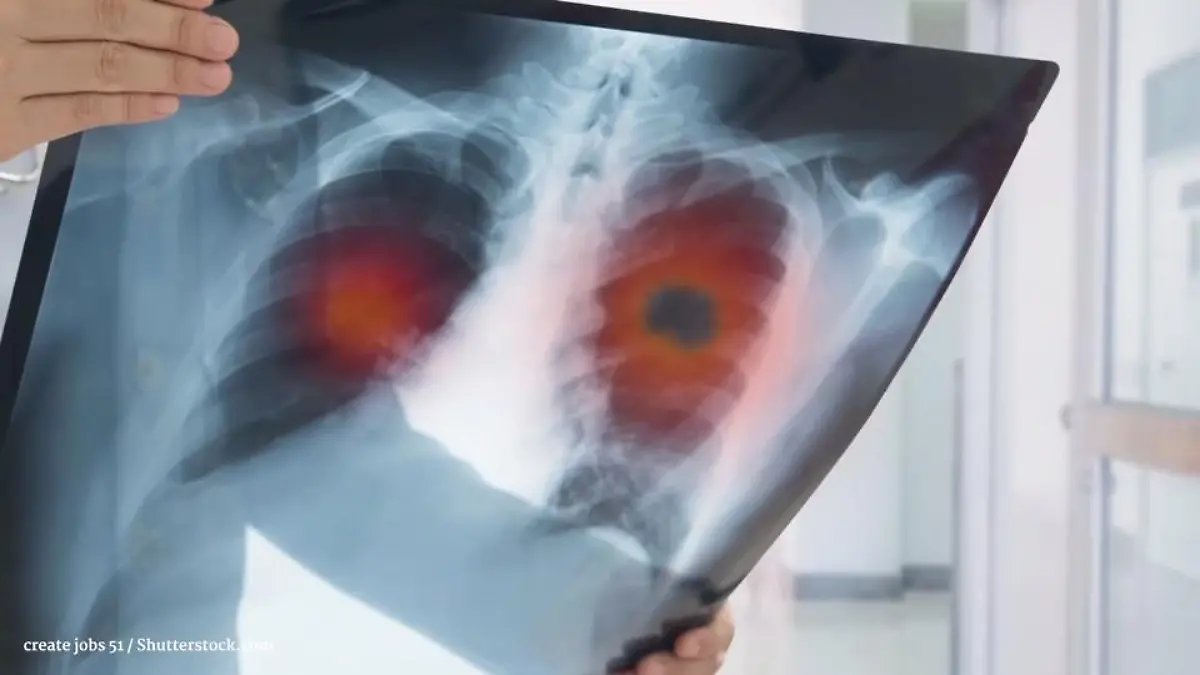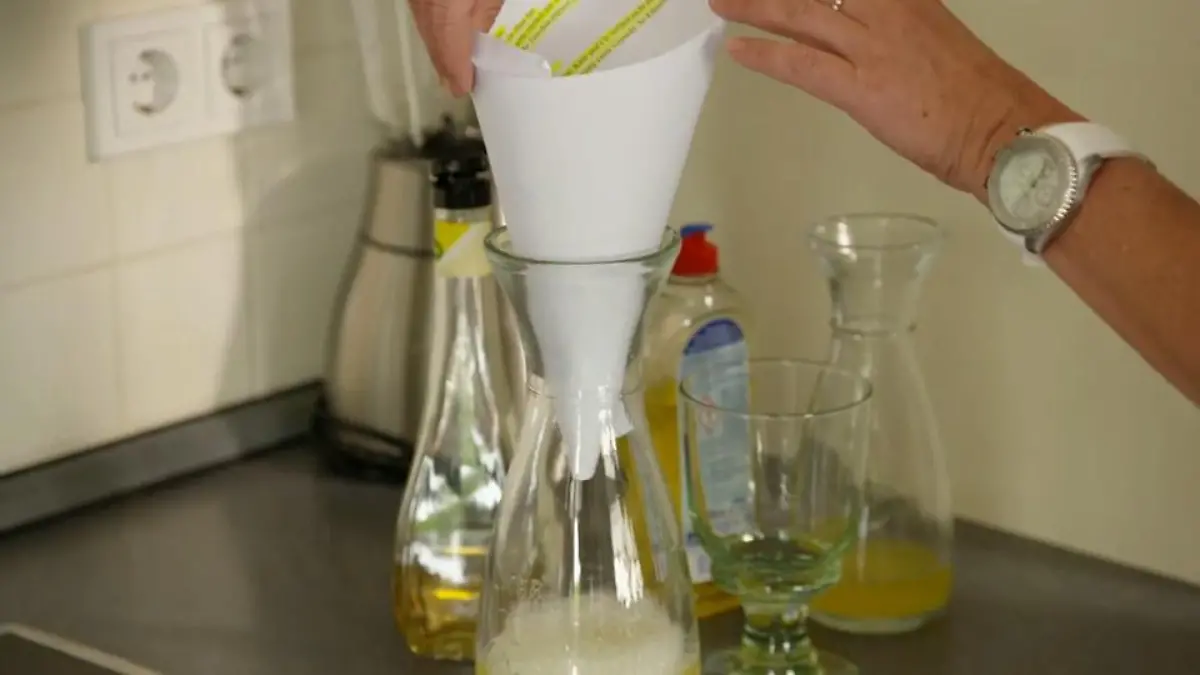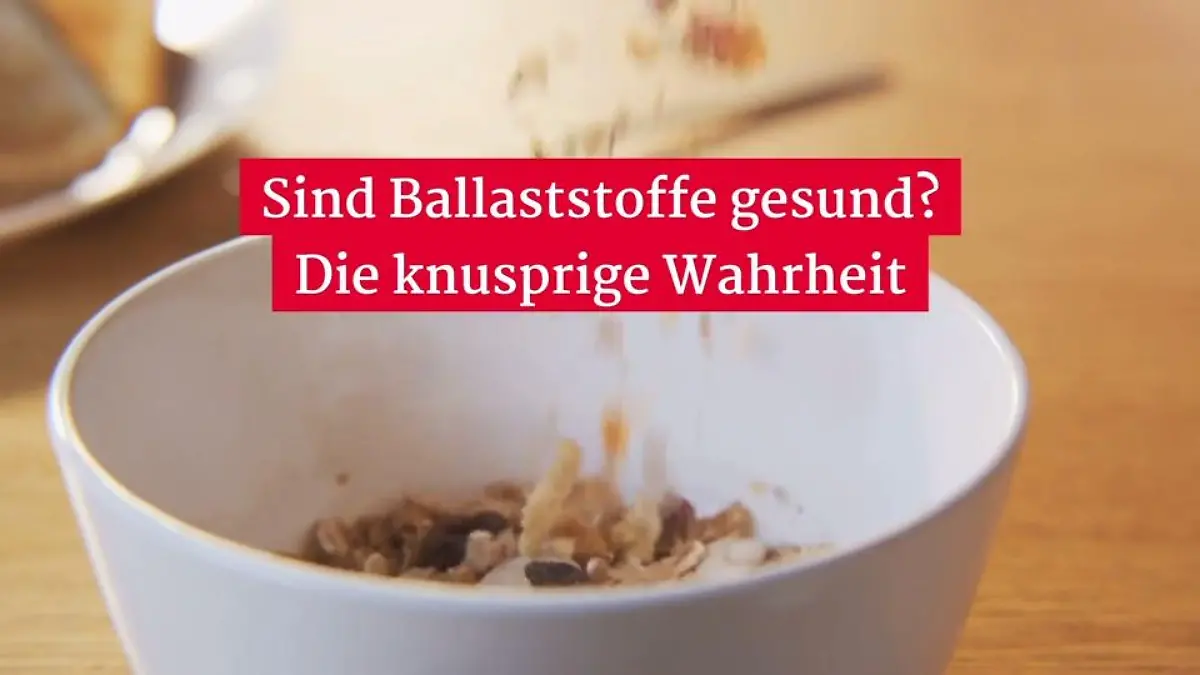Wundrose richtig behandelnGesundheitslexikon: Erysipel (Wundrose)
Erysipel, auch Wundrose oder Rotlauf genannt, ist eine plötzlich auftretende Entzündung der Haut. Charakteristisch für die Erkrankung ist eine flächenhafte, starke Rötung. Diese tritt häufig im Gesicht oder am Unterschenkel auf, seltener an anderen Stellen des Körpers. Die Erkrankung ist typisch für Kinder und ältere Menschen, kann aber jede Altersgruppe treffen. Vor allem Patienten, die an Diabetes, Alkoholismus, arteriellen oder venösen Zirkulationsstörungen leiden oder über ein geschwächtes Immunsystem verfügen, haben ein erhöhtes Infektionsrisiko.
Ursachen
Die Wundrose wird von Bakterien, meist Streptokokken der Gruppe A, ausgelöst. Diese dringen über Verletzungen der Haut in die Lymphspalten ein. Dort angekommen werden die körpereigenen Abwehrzellen aktiviert und es kommt zu massiven Entzündungsreaktionen. Häufige Gründe für offene Hautstellen sind Pilzinfektionen der Zehenzwischenräume oder akute und chronische Hauterkrankungen, die mit Erosionen einhergehen (zum Beispiel Löcher für Ohrringe oder Piercings). Eintrittsstellen für Bakterien können Insektenstiche, Hautkratzer, Mundwinkeleinrisse oder Verletzungen bei Pediküre oder Maniküre sein.
Symptome einer Wundrose
Ein Erysipel beginnt plötzlich. Auf der Haut tritt eine oberflächliche Hautrötung auf, die flächenhaft fortschreitet und stark schmerzt. Häufig sind die Hautareale selbst und auch die Lymphknoten geschwollen. Begleitet werden die Symptome von Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen oder Übelkeit. Bei Immunschwäche, bei Durchblutungsstörungen sowie bei verspäteter Therapie kann der Rotlauf einen schweren Verlauf nehmen. Es entstehen Blasen oder sogar Einblutungen im entzündeten Bereich, es kann zu Venenentzündungen, einer Blutvergiftung oder sogar einer Nierenentzündung kommen.
Anzeige:Diagnose eines Erysipels
Aufgrund des typischen Erscheinungsbildes kann der Arzt die Wundrose meist klinisch diagnostizieren. Allerdings sollte ein Erysipel sicher von anderen Erkrankungen abgegrenzt werden. Stauungsdermatitis, eine allergische Kontaktdermatitis, oberflächliche Venenentzündungen oder Schweinerotlauf können ähnliche Symptome aufweisen. Sicherheit bringt eine Blutuntersuchung. Die Blutsenkungsgeschwindigkeit ist im Erkrankungsfall ebenso erhöht wie die Zahl der weißen Blutkörperchen und das C-reaktive Protein.
Behandlung/Therapie
Wundrose wird mit Antibiotika, zumeist Penicillin, für etwa 10–14 Tage behandelt. In dieser Zeit steht für den Patienten Schonung auf dem Programm. Bettruhe sowie die Ruhestellung und Hochlagerung der betroffenen Region werden angeraten. Bei Schmerzen verschreibt der Arzt schmerzlindernde Medikamente, ansonsten wird das Erysipel mit abschwellenden und entzündungshemmenden Cremes behandelt. Wird der Rotlauf rechtzeitig erkannt und eine Therapie eingeleitet, so heilt die Krankheit zumeist komplikationslos aus. Bei Erkrankungen im fortgeschrittenen Stadium oder bei Komplikationen ist häufig ein Krankenhausaufenthalt notwendig. Bei manchen Patienten kommt es zu einem Wiederaufkeimen der Erkrankung. Infolge kann es zu Schädigungen der Lymphbahnen und zu Lymphödemen kommen. In diesem Fall wird eine langfristige Antibiotikatherapie verordnet. Es ist deshalb wichtig, bei der Ersterkrankung auch die Eintrittspforte des Erregers zu behandeln, so kann ein Rückfall eventuell vermieden werden.
Vorbeugung gegen Wundrose
Neben einem gesunden Lebensstil mit viel Bewegung und einer ausgewogenen Ernährung ist vor allem die Hygiene wichtig, um der Wundrose vorzubeugen. Die alltägliche Pflege sollte jedoch nicht übertrieben werden, damit die natürliche Hautflora unbeschädigt bleibt. Bei Verletzungen der Hautoberfläche müssen die Wundstellen umgehend behandelt und desinfiziert werden, um den Bakterien keinen Nährboden zu bieten.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel kann einen Besuch beim Arzt nicht ersetzen. Er enthält nur allgemeine Hinweise und darf daher keinesfalls zu einer Selbstdiagnose oder Selbstbehandlung herangezogen werden.