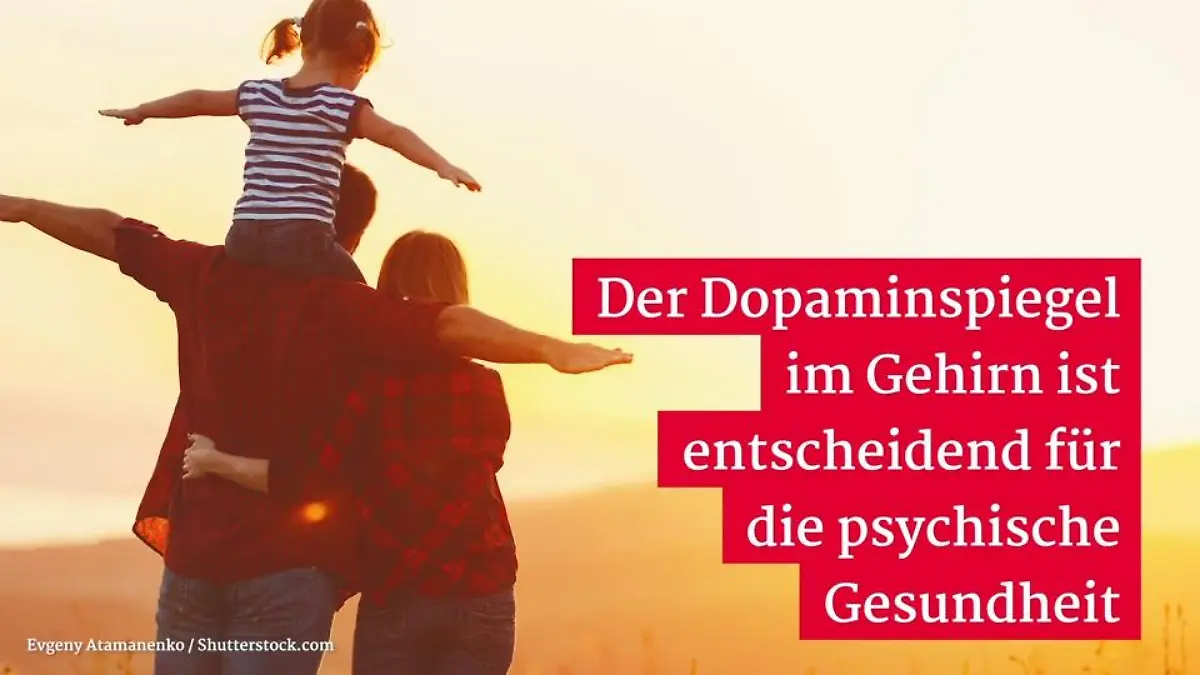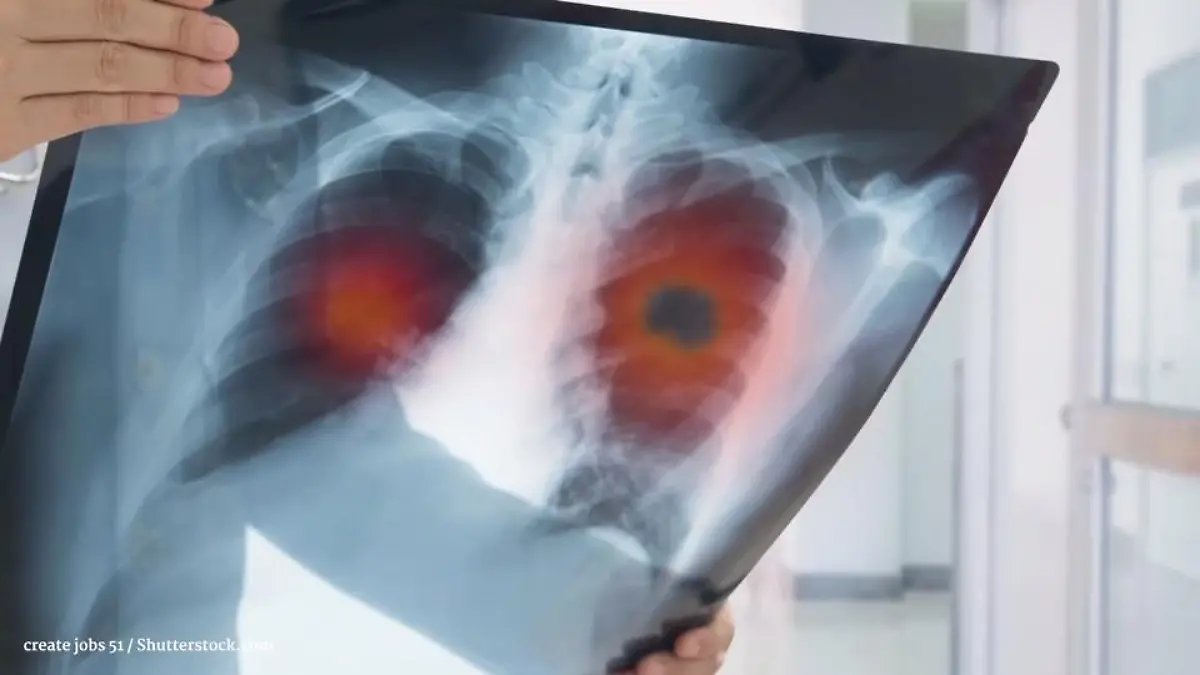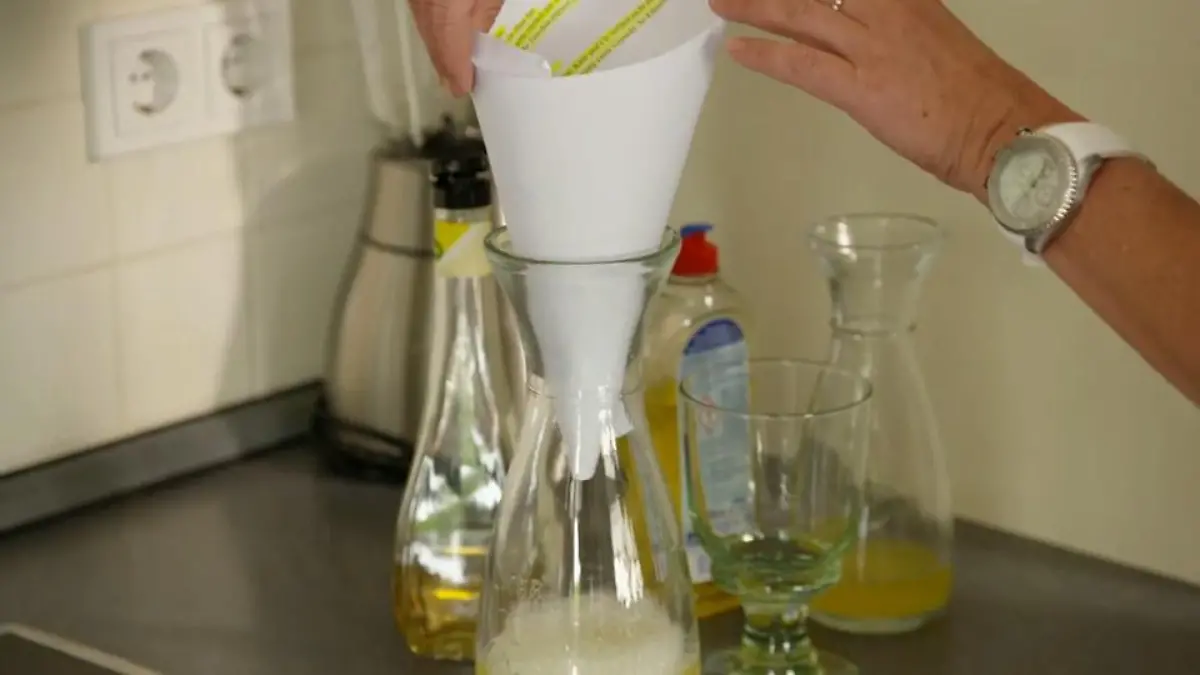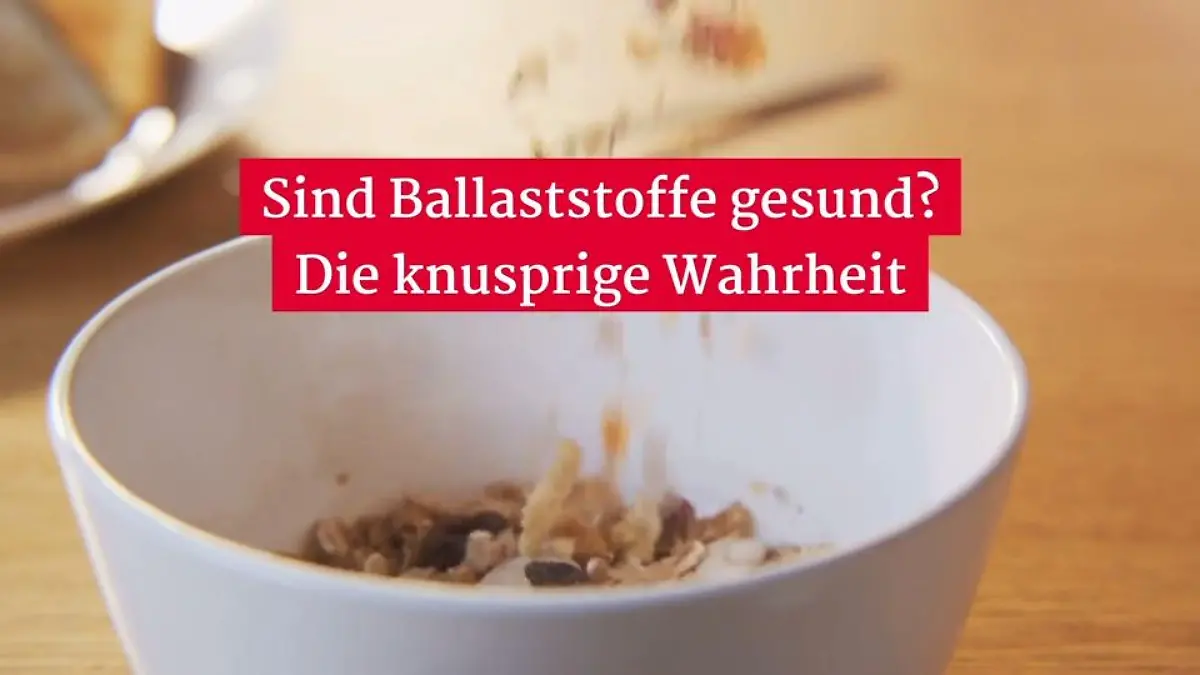Ursachen, Symptome, BehandlungGesundheitslexikon: Schüttelfrost
Schüttelfrost tritt meist in Kombination mit Fieber bei Infektionskrankheiten auf. Es ist im Grunde keine Erkrankung, sondern eine Begleiterscheinung von Infektionskrankheiten, die mit erhöhter Temperatur einhergehen.
Ursachen
Schüttelfrost kann viele unterschiedliche Ursachen haben. Es tritt vor allem, wie eingangs erwähnt, bei fieberhaften Erkrankungen wie Erkältungen oder einer Grippe auf. In schwerwiegenderen Fällen kann es zu Schüttelfrost kommen, wenn der Betroffene an einer Lungenentzündung oder Scharlach leidet. Eine Blutvergiftung, Wundrose oder Wundstarrkrampf sind weitere mögliche Auslöser. Alle Arten von Entzündungen, darunter Nierenbecken- oder Prostataentzündungen, können von Schüttelfrost begleitet werden. Auch Vergiftungen oder Entzugserscheinungen nach dem Drogenkonsum sind infrage kommende Ursachen. Selbst eine Schilddrüsenüberfunktion kann zum Schüttelfrost führen. Nach einem Aufenthalt in einem tropischen Land können Malaria oder andere Erkrankungen, wie Gelbfieber oder Pocken, unkontrolliertes Zittern auslösen. Bei einer Veranlagung zum Glaukom ist besondere Vorsicht geboten, denn Schüttelfrost tritt bei einem plötzlichen Glaukomanfall mit deutlich erhöhtem Augeninnendruck auf. Selbst bei einem Sonnenstich oder Hitzschlag kann es zu Schüttelfrost kommen.
Symptome
Ein Betroffener, der unter Schüttelfrost leidet, friert innerlich wie äußerlich. Schüttelfrost oder fachsprachlich Febris undularis löst unkontrolliertes Muskelzittern aus, insbesondere in den Oberschenkeln, in der Rückenmuskulatur und im Kaubereich. Schüttelfrost ist in der Regel mit einer erhöhten Körpertemperatur oder Fieber und mit Glieder- und Kopfschmerzen verbunden. Die Symptome sind mit dem Kältezittern vergleichbar, bei dem die Skelettmuskulatur reagiert, um die Wärmeproduktion des Körpers anzukurbeln. Dieses nicht beeinflussbare Muskelzucken strengt die Betroffenen enorm an, weshalb diese sich nach einem Schub oft erschöpft fühlen.
Diagnose
Um die Ursache des Schüttelfrostes zu klären, geht eine gründliche Befragung des Patienten der körperlichen Untersuchung voraus. Es sollte geklärt werden, wann der Schüttelfrost erstmals aufgetreten ist, ob eine Grunderkrankung, wie grüner Star vorliegt oder ob der Betroffene eine Auslandsreise hinter sich hat. Danach werden beispielsweise Lunge und Herz abgehört und gegebenenfalls eine Blut- und Urinuntersuchung vorgenommen, um mögliche Krankheitserreger zu identifizieren. Besteht die Gefahr eines erhöhten Augeninnendrucks als Auslöser des Schüttelfrostes, ist eine sofortige Einweisung in eine Augenklinik ratsam. Bei einer möglichen Tropenkrankheit oder einer schwer wiegenden Entzündung kann der behandelnde Arzt den Patienten in eine Klinik bringen lassen, die weitere diagnostische und therapeutische Maßnahmen unternimmt. Dazu gehören beispielsweise eine Messung des Augeninnendrucks, eine Bronchoskopie der Lunge oder eine Ultraschalluntersuchung der Nieren.
Behandlung
Die Therapie des Schüttelfrostes richtet sich immer nach der Krankheitsursache. Liegen eine Erkältung oder Grippe vor, können bewährte Hausmittel wie kalte Wadenwickel oder Schwitzkuren mit heißem Tee helfen, das Fieber zu bekämpfen. Sind die Beschwerden mit hohem Fieber und Schmerzen verbunden, versprechen schmerz- und fiebersenkende Medikamente wie Paracetamol Linderung. Bei einem Sonnenstich oder Hitzschlag muss der Körper mit Wickeln gekühlt werden und der Patient sollte ausreichend mineralhaltige Flüssigkeiten zu sich nehmen. Ist eine Infektion durch einen Erreger die Ursache für Fieber und Schüttelfrost, kann der Arzt ein Antibiotikum verordnen.
Vorbeugung
Gegen Schüttelfrost und seine Ursachen hilft vor allem eine Stärkung des Immunsystems. Eine gesunde, vitamin- und mineralstoffreiche Ernährung und ausreichend Bewegung an der frischen Luft sind anzuraten, denn diese Lebensweise beugt auch anderen Erkrankungen vor.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel kann einen Besuch beim Arzt nicht ersetzen. Er enthält nur allgemeine Hinweise und darf daher keinesfalls zu einer Selbstdiagnose oder Selbstbehandlung herangezogen werden.