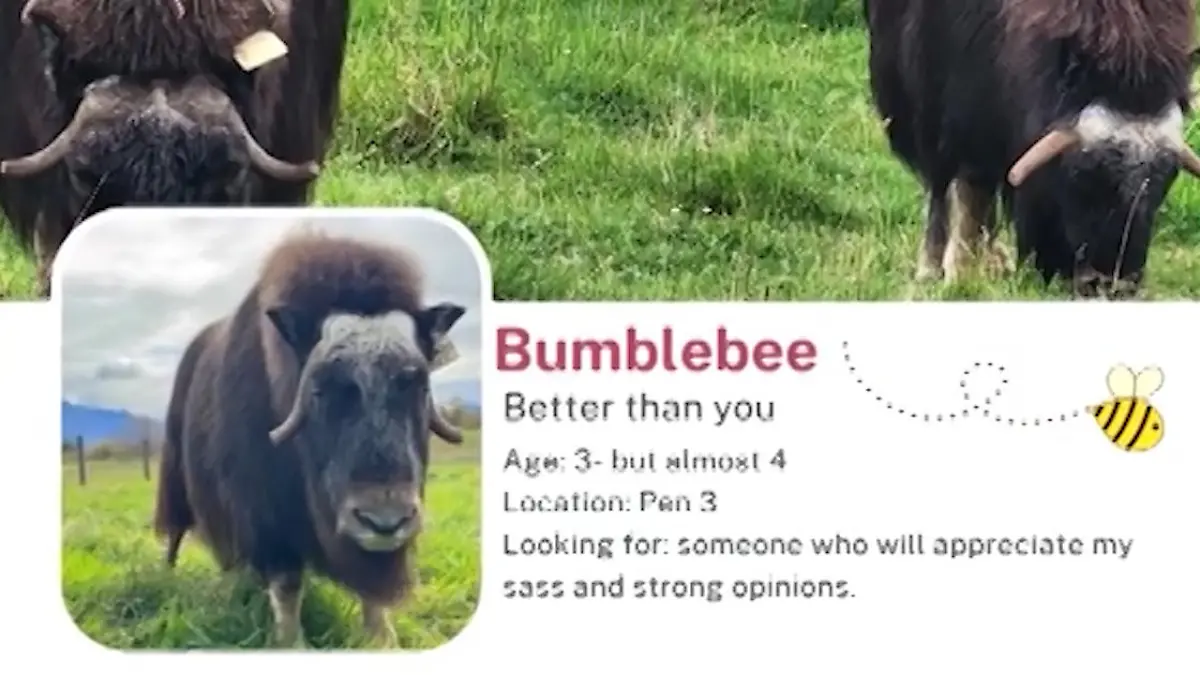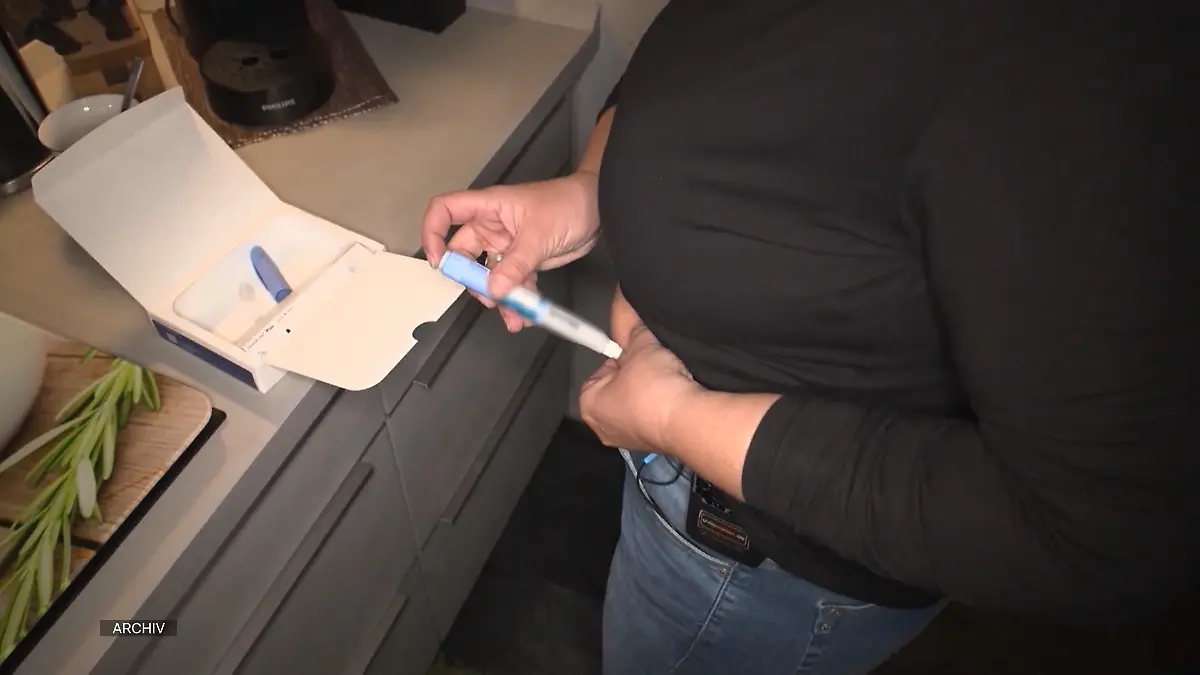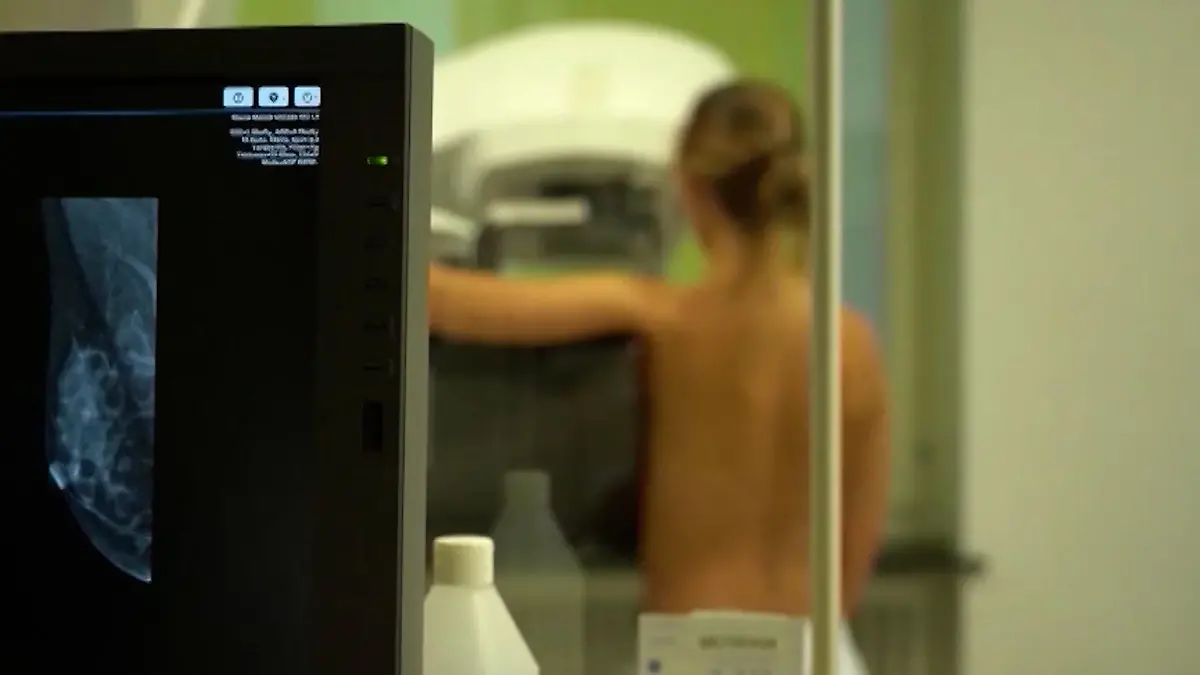Expertin: "Wir dressieren unser Kind wie einen Hund""Wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, dann…" Was emotionale Erpressung bei Kindern anrichten kann

Jeder kennt es vermutlich aus der eigenen Kindheit oder hat es schon mal selbst bei seinen Kindern angewendet: Sätze wie „Wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, darfst du dich nicht mit deinen Freunden treffen“ oder andersrum „Wenn du jetzt beim Arzt gut mitmachst, kriegst du nachher ein Eis“.
„Wir dressieren unser Kind wie einen Hund“, sagt Familienberaterin Ruth Marquardt. Mit einem System aus Bestrafung und Belohnung. Das Problem: Der Schritt in die emotionale Erpressung ist hier nicht weit – und kann bei Kindern enorme Schäden anrichten. Was in Ordnung ist, was zu weit geht und wie wir es je nach Alter des Kindes besser machen können.
Was ist emotionale Erpressung in der Erziehung?
Emotionale Erpressung kann viele Gesichter haben, erklärt Familienberaterin Ruth Marquardt im Interview. „Sie kommt oft gut verkleidet daher, richtet aber enormen Schaden an.“ Erkennen können wir sie anhand von Wenn-dann-Formulierungen wie:
„Wenn du der Oma kein Küsschen gibst, dann ist Oma enttäuscht.“
„Siehst du, weil das mit den Hausaufgaben so lange gedauert hat, hat Mama jetzt Kopfschmerzen.“
Mit solchen Sätzen werde Kindern die Verantwortung an den Gefühlen von Erwachsenen zugeschrieben, warnt Marquardt. Die Folge: Sie fühlen sich schlecht.
"Du bist nicht in Ordnung" - Was emotionale Erpressung bei Kindern anrichtet
Gerade im Alter bis etwa neun Jahren lernen Kinder der Expertin zufolge auf diese Weise: Ich bin schlecht. Mit mir ist etwas nicht in Ordnung. „Das greift massiv den Selbstwert von Kindern an, weil sie solche Sätze für bare Münze nehmen und noch nicht reflektieren können, was hier passiert.“
Was das Kind stattdessen lerne, sei: Ich schade anderen, wenn ich die Bedingungen nicht erfülle.
Ein weiterer Klassiker von Eltern, die sich hilflos fühlen, sei:
„Wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, dann nehmen wir dir dein Handy für den Rest der Woche ab.“
Auch Sätze wie „Du hast mich so enttäuscht“ schaden Kindern massiv, so Marquardt. Der Grund: Sie stellen das Kind als Person – und nicht das Verhalten des Kindes – infrage. Die unterschwellige Botschaft, die verstanden werde, laute: Du bist nicht in Ordnung. Mit dir stimmt etwas nicht, dass du dich so verhältst.
Wichtig: Unterscheiden Sie zwischen Verhalten und Person!
Wichtig sei es der Familienberaterin zufolge darum, zwischen dem Verhalten des Kindes und der Person zu unterscheiden:
Bin ich enttäuscht von dem, wie du dich verhalten hast?
Bin ich enttäuscht von dir als Mensch?
„Das Verhalten meines Kindes kann mich wütend machen oder enttäuschen. Das zu formulieren, ist in Ordnung“, sagt Marquardt.
„Wir hatten vereinbart, dass du um 16 Uhr zu Hause bist. Jetzt ist es 18 Uhr. Ich habe mir Sorgen gemacht."
oder weiterführend:
„Ich merke, dass ich mich hilflos und wütend fühle. Beim nächsten Mal bitte ich dich, dass du mir auf jeden Fall Bescheid sagst, wenn es später wird. Bist du bereit, das zu tun?“ Tipp der Expertin: Warten Sie hier einen Moment ab, bis die Antwort kommt und halten Sie dabei Augenkontakt.
Marquardt rät außerdem: „Lernen Sie, Person und Verhalten bei Kritik zu trennen. Sprechen Sie in Ich-Botschaften mit Ihrem Kind – deeskalierend.“
Die positive Folge: „Sobald wir das Verhalten kritisieren, aber die Integrität unserer Kinder würdigen, schaffen wir langfristige stabile und vertrauensvolle Verbindungen“, so die Familienberaterin. Damit tragen wir aktiv dazu bei, dass unsere Kinder zu respektvollen und eigenverantwortlichen Erwachsenen heranreifen können.

Das Problem mit der Belohnung - "Wir dressieren unser Kind wie einen Hund"
Neben Kritik am Verhalten des Kindes gibt es auch noch die andere Seite der Medaille, weiß Marquardt. Sätze wie „Wenn du dein Zimmer aufräumst, darfst du dich mit deinen Freunden treffen“ wirken erstmal positiv.
„Der Satz sieht aus wie eine Belohnung. Aber auch das wird heutzutage als wirklich gutes Mittel wissenschaftlich infrage gestellt“, so die Expertin. Bestrafung und Belohnung seien zwei Seiten derselben Medaille. „Wir dressieren unser Kind wie einen Hund – mit Belohnung oder Bestrafung.“
Das Problem: Das schaffe möglicherweise kurzfristig eine Reaktion in Richtung eines gewünschten Verhaltens, brauche aber mit jeder weiteren Belohnung oder Bestrafung mehr Druck - und dieser sei immer ein Angriff auf das Vertrauensverhältnis beziehungsweise die Eigenmotivation, erklärt Marquardt.
Ein Satz, den vermutlich viele Eltern von Schulkindern bereits so oder so ähnlich angewandt haben:
„Wenn du eine eins schreibst, bekommst du 50 Euro.“
Auch hier verstecke sich eine Schwierigkeit: Bei Sätzen, die eine Belohnung versprechen, machen wir etwas nicht, weil wir den Sinn verstehen, sondern wir erwarten die Belohnung. „Wie hoch müssen die Beträge dann mit der Zeit werden, wenn wir das als Standard setzen?“, gibt Marquardt zu bedenken. Es sei gut, sich dieser Dynamiken bewusst zu werden.
„Wollen wir die Eigenmotivation unserer Kinder fördern, sind wir als Eltern dafür zuständig, diese Lernprozesse über Einsicht, Verstehen und eigene Begeisterung zu unterstützen“, so die Expertin. Das könne mitunter auch anstrengend sein und Zeit kosten – zahle sich aber langfristig aus.
Warum erpressen einige Eltern ihre Kinder emotional?
Emotionale Erpressung geschehe meist nicht bewusst, weiß Marquardt. „Eltern wollen ihren Kindern nicht schaden, sie fühlen sich nur hilflos.“ Meist aus Zeitdruck oder anderen inneren Nöten wünschen sich Eltern, dass ihr Kind funktioniert, dass es sich möglichst schnell und reibungslos in den eigenen Alltag einfügt und eigene oder die Erwartungshaltungen von anderen erfüllt werden. Beispiel: Das Kinderzimmer soll aufgeräumt sein, damit wir vor den Großeltern oder Freunden gut dastehen.
„Wir wiederholen dann als Eltern eher unbewusst Sätze, die wir so oder ähnlich selbst als Kinder gehört haben.“ Das zeige, wie sehr wir als Kinder verinnerlicht haben, wie Erziehung funktioniere. Dies lohne sich laut Marquardt, zum Wohl einer langfristig vertrauensvollen Eltern-Kind-Beziehung zu hinterfragen.
Tun wir das nicht, sondern führen emotionale Erpressung fort, könne sich das folgendermaßen auf unsere Kinder auswirken: „Erpresse ich mein Kind emotional, wird es sich in Folge im Kontakt mit mir jedes Mal ein wenig unsicherer fühlen. Es wird Schmerz und Unverständnis empfinden.“
Vor allem im Alter zwischen null bis etwa neun Jahren könne das Folgen haben. „Kinder leben in dieser Zeit völlig im Gefühl. Gesagtes kann noch nicht abstrahiert und durchschaut oder hinterfragt werden“, weiß die Familienberaterin.
Ihre Erfahrung interessiert uns!
Die Ergebnisse dieser Umfrage sind nicht repräsentativ.
Was kann emotionale Erpressung mit Kindern machen?
Kinder suchen in ihren Eltern Vertrauen, Sicherheit und wollen gesehen werden, erklärt Marquardt. „Das ist das Gegenteil von emotionaler Erpressung. Diese erzeugt Unsicherheit und Angst und wird dafür sorgen, dass Kinder anfangen, Dinge heimlich zu tun.“
Der Grund: Emotionale Erpressung lasse Kinder die Erfahrung machen, dass Eltern oder andere Erziehungsberechtigte mächtiger seien, dass ihr Wort mehr gelte. Sie machen die Erfahrung von Schuldgefühlen und Unterlegenheit.
Nun könne man laut Marquardt durchaus argumentieren: Dieses Machtgefälle existiere ja auch und wir müssen Kindern als Erwachsene die Spielregeln des Lebens beibringen. Das stimme auch – dennoch können wir als Erwachsene wählen, mit welchen Mitteln wir unseren Kindern diese Spielregeln beibringen.
Statt auf Macht und Druck setze die Familienberaterin hier lieber auf den Dialog.
Was können Eltern besser machen?
Zeigen Sie Ihren Kindern logische Konsequenzen auf, rät Marquardt. Denn: Das können diese nachvollziehen, daraus können sie lernen. Aus Drohungen hingegen nicht.
Ein Beispiel für eine logische Konsequenz:
„Wenn du jetzt noch weiter trödelst, kommen wir später zum Geburtstag von Jan. Dann hast du dort weniger Zeit zum Spielen.“
Alternativ erklären Sie Ihrem Kind: „Wenn wir jetzt viel Zeit zum Aufräumen brauchen, dann hat Papa nachher weniger Zeit, um aus dem Buch vorzulesen. Was ist dir lieber?“ Tipp der Expertin: Lassen Sie Ihrem Kind die Wahl. Geben Sie ihm die Möglichkeit zu lernen, selbst darüber nachzudenken.
Im Video: Erziehung mal anders! Baby schreit - Vater beruhigt es: mit Schreien
Beispiel: Das unaufgeräumte Zimmer
Die meisten Eltern kennen die leidige Frage in- und auswendig: Wie bekomme ich mein Kind dazu, sein Zimmer aufzuräumen – und das ohne Macht, Druck, Belohnung oder Bestrafung?
„Kinder dürfen Ordnung lernen“, sagt Marquardt. Sie verstehen allerdings den Zeitdruck von uns Erwachsenen oft nicht – gerade im Alter unter zehn Jahren. Was dahinterstecke: Kinder leben im Augenblick. Zeit hingegen sei etwas, das für sie oft nicht zu gelten scheine. Sie haben ihren eigenen Rhythmus für Lernen und Entwicklung, verlieren sich im Spiel.
Anders sehe es bei Erwachsenen aus: Sie stehen oft unter Zeitdruck, um zu funktionieren, um ihren Alltag mit all seinen Herausforderungen zu bewältigen, müssen pünktlich beim Job oder nächsten Termin sein. „Stress und Streit zwischen Eltern und Kindern entsteht genau an dieser Schnittstelle: Den erwachsenen gesellschaftlichen Anforderungen und den tatsächlichen Bedürfnissen von Kindern“, weiß Marquardt.
Wie sich diese Diskrepanz lösen lässt, hängt der Familienberaterin zufolge unter anderem vom Alter des Kindes ab.
Zimmer aufräumen - bei Kindern unter zehn Jahren:
Räumen Sie das Zimmer gemeinsam mit Ihrem Kind auf! Allerdings rät die Expertin: „Nicht, wenn Sie gerade selbst im Stress sind, sondern in einem Moment, den Sie sich bewusst nehmen.“ Dann habe man die Möglichkeit, eine Aufgabe wie das Aufräumen eher spielerisch anzugehen und gemeinsam Spaß an der Ordnung zu finden.
Überlegen sie sich gemeinsam, wo was einen guten Platz haben könnte. Bei kleineren Kindern funktionieren auch Spiele gut, so Marquardt. Zum Beispiel: Wer hat die meisten Teile weggeräumt? „Seien Sie kreativ! Fragen Sie Ihr Kind. Beziehen Sie es mit ein.“ Denn: Unser menschliches Gehirn lerne über Freude, Begeisterung und Liebe. Strafe und Druck führen hingegen in aller Regel zu Gegendruck. Rebellion und Streit im Kinderzimmer seien dann die natürliche Folge.
Zimmer aufräumen - bei Kindern und Jugendlichen in der Pubertät:
Bei älteren Kindern in der Pubertät empfiehlt Marquardt: „Das Jugendzimmer DARF furchtbar aussehen!“ Warum die Familienberaterin hier so tolerant ist: Langsam werde aus einem Kind ein junger Erwachsener – und da gehöre auch eine chaotische Übergangsphase zum Erwachsenwerden dazu.
Allen Eltern, für die das Chaos schwer zu ertragen ist, rät die Expertin: Schließen Sie die Tür. Räumen Sie nichts mehr selbst auf! Atmen Sie ein und atmen Sie aus. „Der Impuls für Ordnung wird mit der Zeit von selbst einsetzen“, weiß Marquardt aus eigener Erfahrung. Denn: „Irgendwann kommen Freunde nach Hause - und es wird einen Punkt geben, an dem es für Freunde oder Postings auf Social Media peinlich ist, wenn der eigene Raum furchtbar aussieht!“
Das Konzept dahinter: Für allgemeine Räume wie Wohnzimmer, Küche und Co. gelten Regeln, an die sich alle halten und jeder dazu beiträgt, dass diese Räume aufgeräumt bleiben. Das Kinderzimmer dürfe aber aussehen, wie es will.
Die Privatsphäre des Kindes dürfe seine Privatsphäre sein – mit allem, was dazu gehöre. Das bedeute laut Marquardt auch: Hier bin ich zuständig. Das ist mein sicherer Raum, in dem ich lebe und Verantwortung habe.