Durch Bakterien der Gattung Listeria verursachte InfektionskrankheitGesundheitslexikon: Listeriose (Listerien-Infektion)
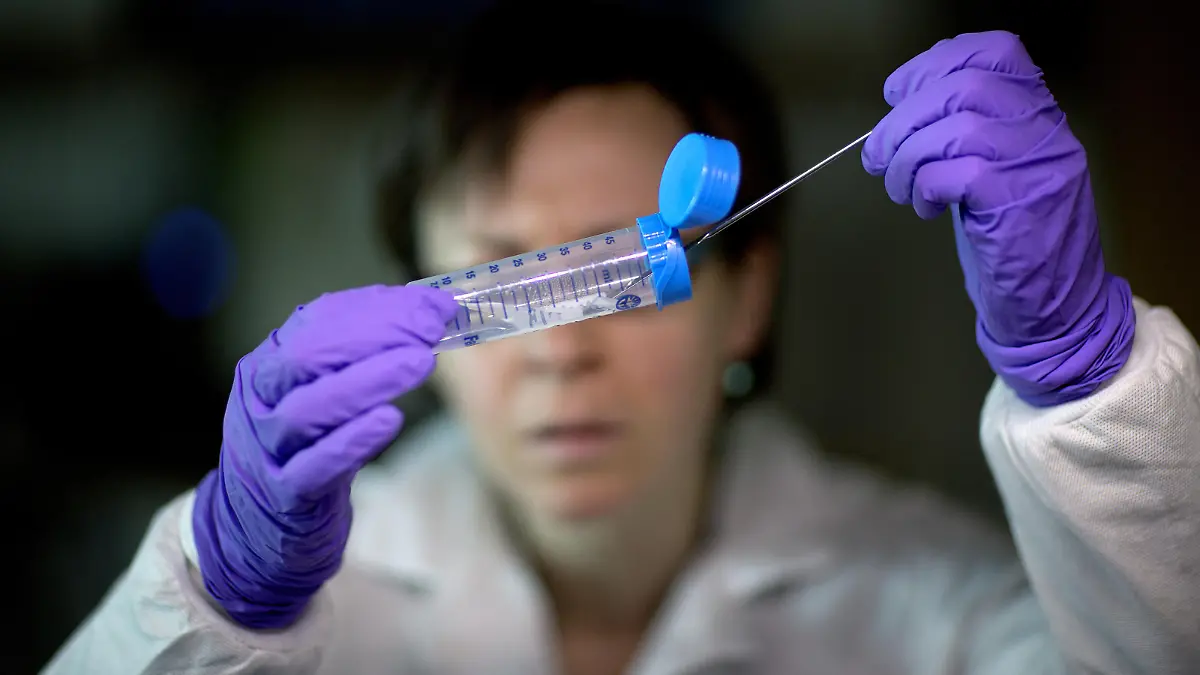
Die Listeriose ist eine Infektion, die durch Bakterien der Gattung ‚Listeria‘ verursacht wird. Wichtigster Erreger aus der Gruppe der Listerien ist ‚Listeria monocytogenes‘. Es handelt sich dabei um ein gram-positives Stäbchenbakterium, das in weiten Teilen der Umwelt vorkommt.
Ursachen
Die Listeriose entwickelt sich nach der Infektion mit Listerien. Die Ansteckung erfolgt oral oder über Schmierinfektionen. Prinzipiell sind Listeriosen aber meist lebensmittelbedingt. Listerien finden sich in Fisch, Geflügel, Fleisch und auch auf pflanzlichen Lebensmitteln. Insbesondere bei abwehrgeschwächten Menschen sind die Erreger auch Verursacher seltener Infektionen in Krankenhäusern. Bei der Listeriose einer Schwangeren erfolgt die Übertragung auf das Ungeborene während der Schwangerschaft über die Plazenta. Eine Ansteckung ist auch während der Geburt möglich.
Symptome
Im Normalfall führt die Aufnahme von Listerien nur zu einer begrenzten Keimbesiedlung des Verdauungstrakts. Menschen mit einem normalen Immunsystem zeigen in der Regel kaum Symptome. Eventuell äußert sich die Listeriose hier als eine leichte Fiebererkrankung, die Symptome können einer Grippe ähneln. Bei einigen Patienten entwickelt sich jedoch innerhalb weniger Stunden eine schwere und fieberhafte Infektion des Magen-Darm-Trakts, die mit Durchfall und Bauchkrämpfen einhergeht und im schlimmsten Fall zum Tode führen kann.
Abwehrgeschwächte Personen wie ältere Menschen, Neugeborene, Schwangere und Patienten mit chronischen Erkrankungen können eine manifeste Listeriose entwickeln. Sie zeigt sich in Form von Fieber, Erbrechen, Durchfall und Muskelschmerzen. Es kann sich eine lebensgefährliche Blutvergiftung (Sepsis) entwickeln. Vereinzelt kommt es sowohl zur Meningitis als auch zur Enzephalitis mit neurologischen Ausfällen und Störungen des Bewusstseins. Grundsätzlich kann im Rahmen der Listeriose jedes Organ befallen werden. So können sich beispielsweise Entzündungen des Herzens (Endokarditis) oder der Gelenke (Arthritis) entwickeln.
Diagnose
Anhand der unklaren klinischen Beschwerden ist eine Diagnose nur schwer zu stellen. Im Blutbild zeigt sich eine Erhöhung der weißen Blutkörperchen. Jedoch ist auch das pathologische Laborbild nicht eindeutig. Ebenso wenig haben Antikörpernachweise eine Aussagekraft. Die Diagnose kann ausschließlich durch eine bakteriologische Untersuchung mit Erregeranzüchtung gesichert werden. Dazu werden Proben aus dem Gehirnwasser benötigt. Gelegentlich gelingt der Erregernachweis auch aus Kot oder Vaginalsekret.
Behandlung
Listerien können theoretisch mit Antibiotika wie Erythromycin oder Amoxicillin behandelt werden. Allerdings beginnt die Behandlung aufgrund des unklaren Beschwerdebildes häufig zu spät, sodass die antibiotischen Arzneimittel nicht mehr anschlagen. Ein weiteres Problem bei der Antibiotikatherapie ist, dass die Erreger sich auch in den Körperzellen verstecken können. Dort sind sie für Antibiotika nicht greifbar. Ferner sind vor allem immuninkompetente Menschen in ihrer Abwehr so geschwächt, dass körpereigene Immunmechanismen nur noch unzureichend greifen. Trotz dieser Einschränkungen gilt eine Behandlung mit dem Antibiotikum Ampicillin als Methode der Wahl.
Vorbeugung
Der Listeriose kann am besten durch das ausreichende Erhitzen von Lebensmitteln vorgebeugt werden. Lebensmittel, die nicht erhitzt werden können, sollten sorgfältig gewaschen werden. Messer, Arbeitsflächen und Hände sind nach dem Kontakt mit Gemüse oder rohem Fleisch ebenfalls gut zu reinigen. Personen mit einem erhöhten Infektionsrisiko sollten auf rohen Fisch, Rohmilchprodukte und Rohmilch verzichten.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel kann einen Besuch beim Arzt nicht ersetzen. Er enthält nur allgemeine Hinweise und darf daher keinesfalls zu einer Selbstdiagnose oder Selbstbehandlung herangezogen werden.


