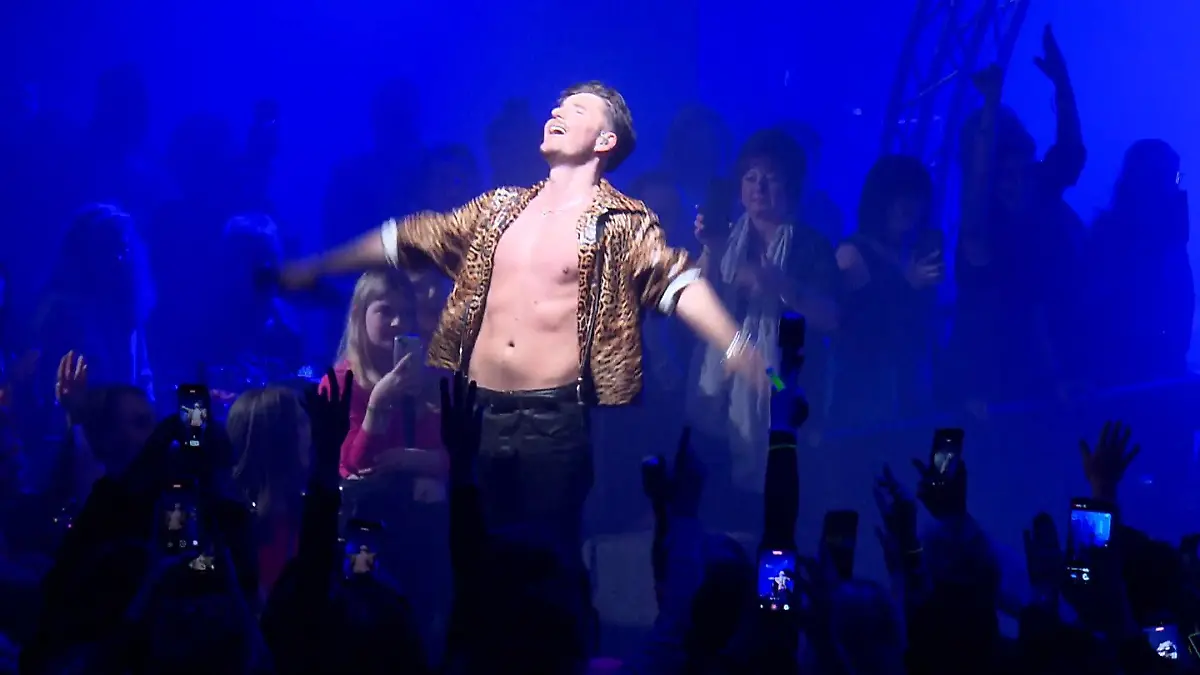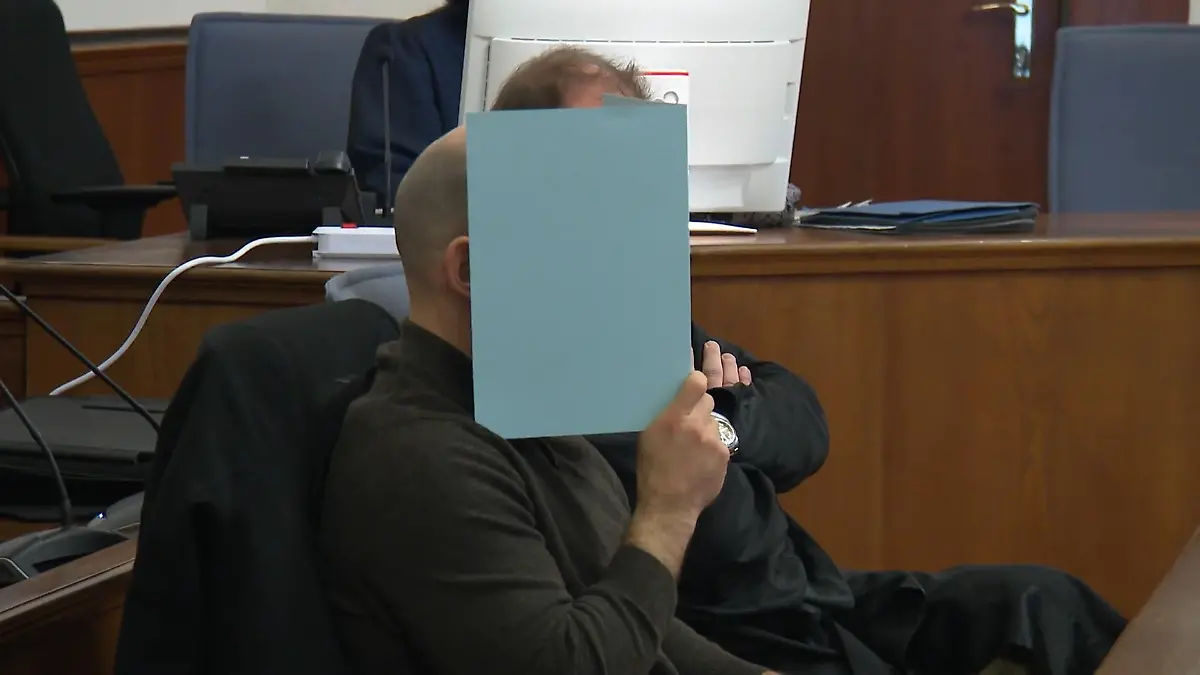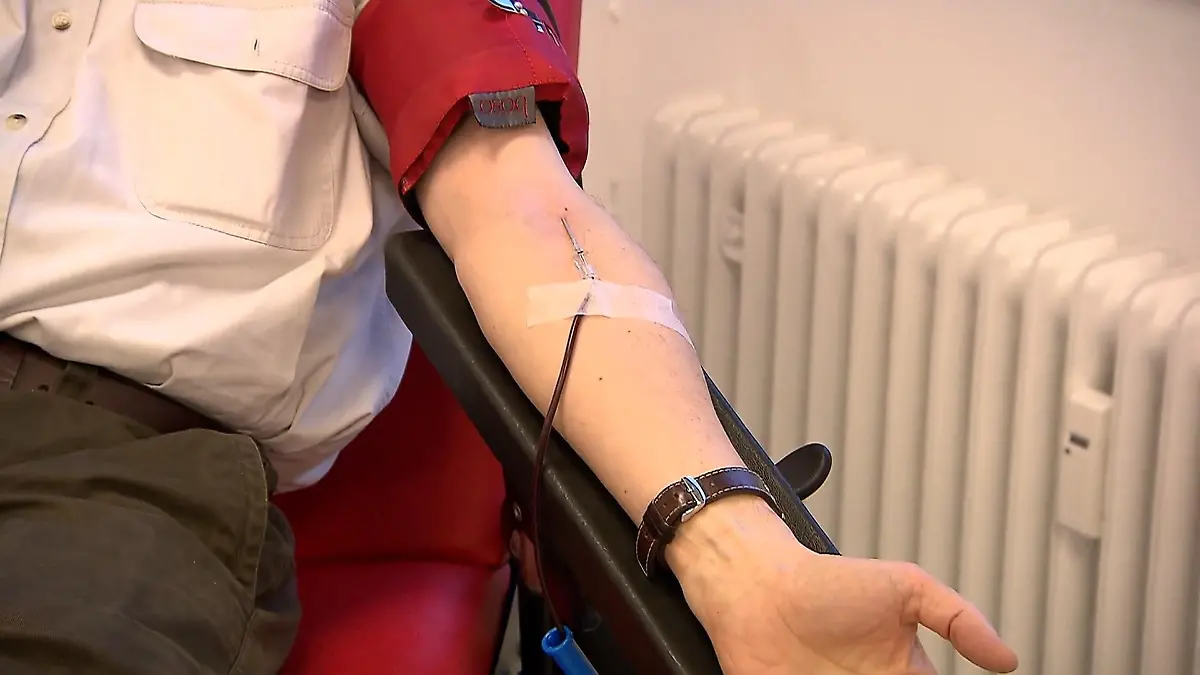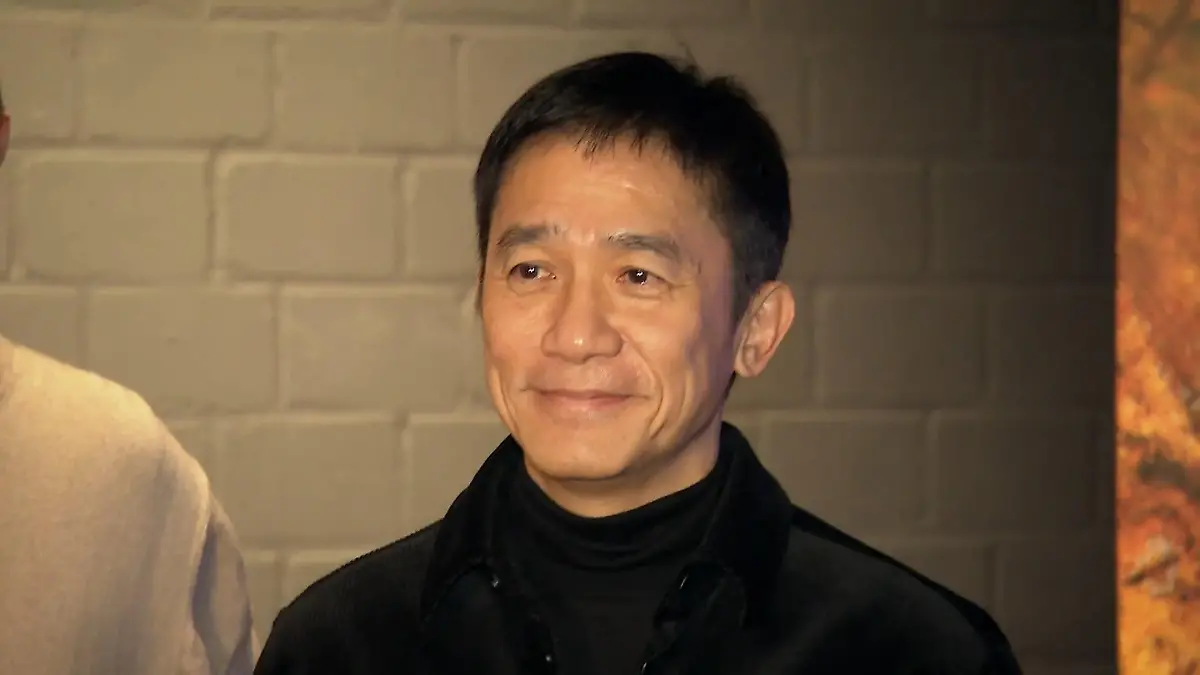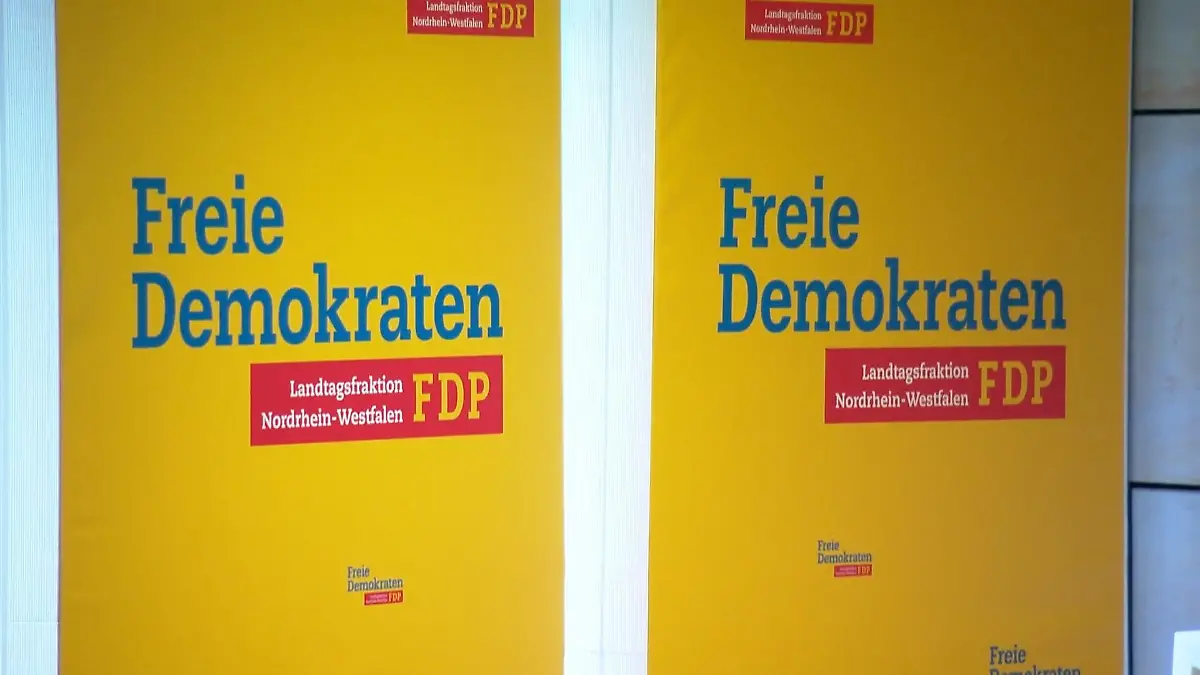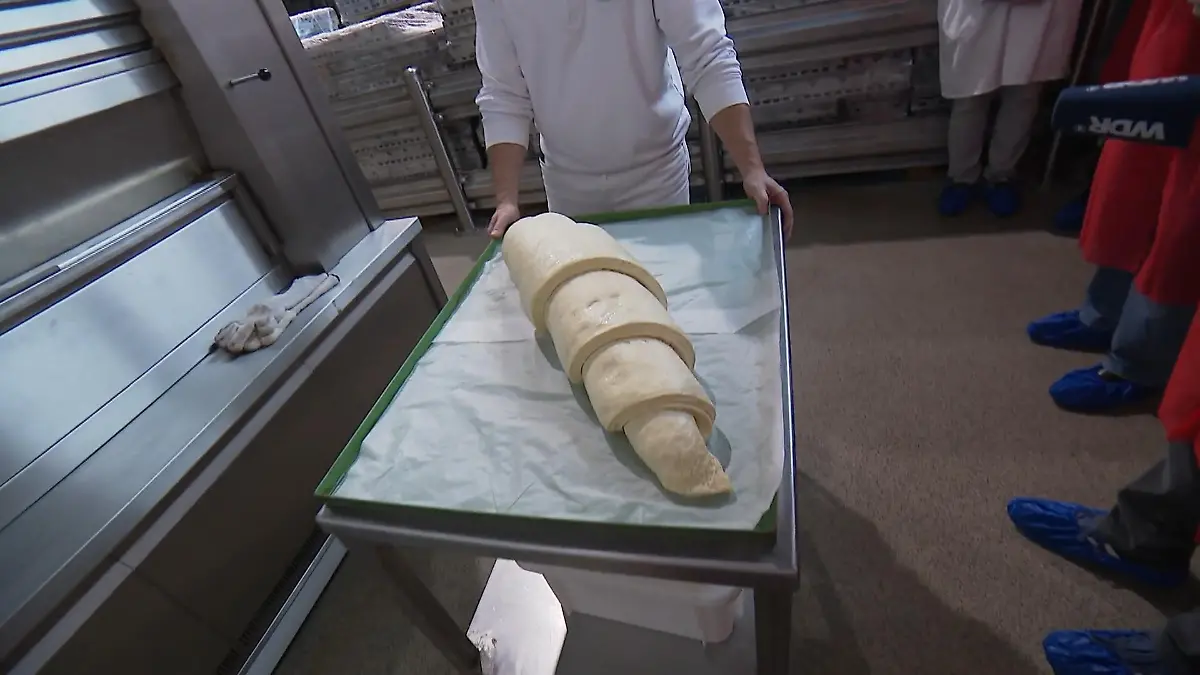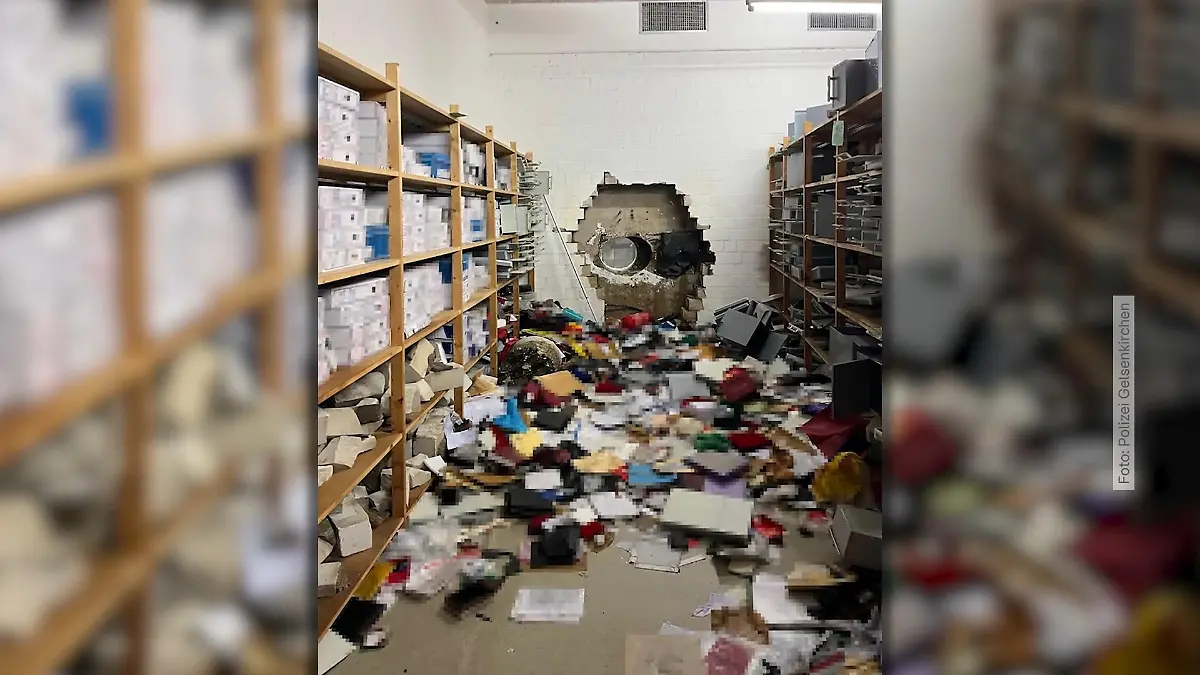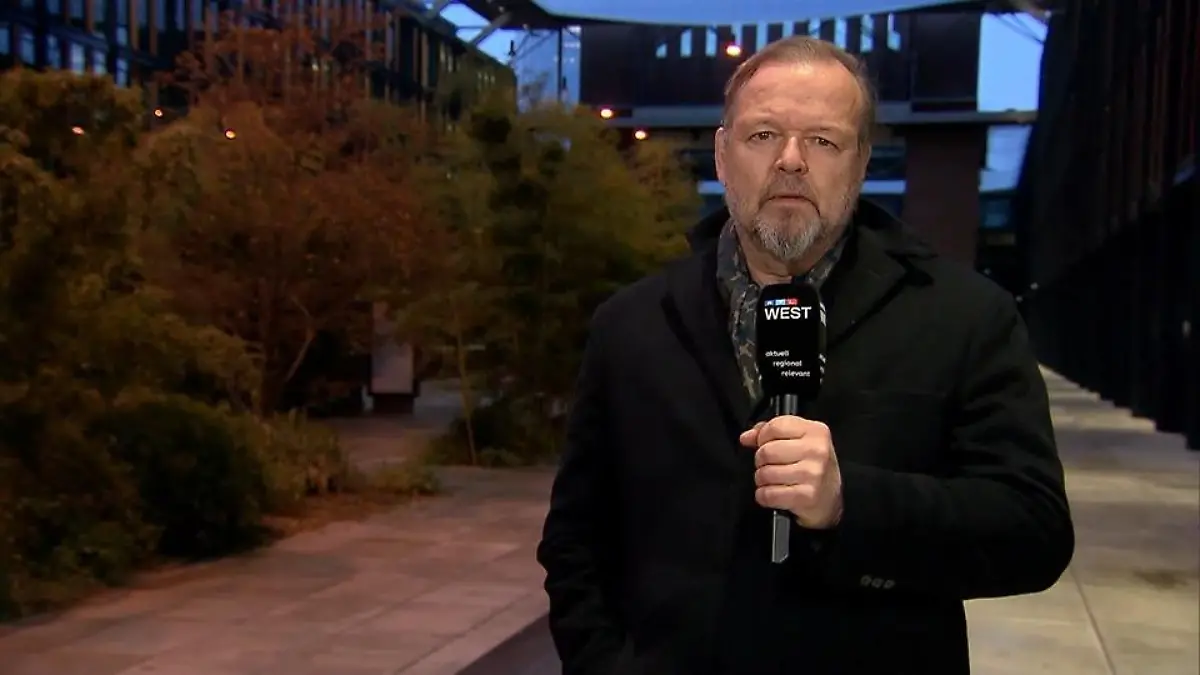Union und SPD wollen staatsferne Medienaufsicht stärkenSchwarz-roter Koalitionsvertrag – wie steht es ums Thema Desinformation und Hetze im Netz?
Union und SPD wollen laut Koalitionsvertrag gezielter gegen Desinformation und Hetze im Netz vorgehen – dabei soll die staatsferne Medienaufsicht eine zentrale Rolle spielen. Verfassungsrechtler warnen jedoch vor Eingriffen in die Meinungsfreiheit und fordern Augenmaß. NRW-Medienminister Liminski betont: Freiheit brauche Grenzen – besonders, wenn sie anderen Schaden zufügt.
Wo Meinungsfreiheit endet
Im Koalitionsvertrag heißt es klar: „Desinformation und Fake News sind ernste Bedrohungen für unsere Demokratie.“ Union und SPD wollen gezielter gegen Hass, Hetze und Informationsmanipulation vorgehen. Doch wo endet die freie Meinungsäußerung – und wo beginnt strafbare Rede? Verfassungsrechtler Markus Ogorek betont: Auch scharfe Kritik sei vom Grundgesetz geschützt. „Aber wenn eine Äußerung nur noch der Herabwürdigung dient, kann sie strafbar sein – etwa als Schmähkritik, Volksverhetzung oder Beleidigung.“ Wichtig sei, ob noch ein sachlicher Kern erkennbar ist oder nur noch gezielte Diffamierung. Gleichzeitig warnt Ogorek davor, mit überzogenen Maßnahmen selbst den Rechtsstaat zu gefährden.
Kontrolle durch unabhängige Stellen
Konkret tätig werden soll die staatsferne Medienaufsicht – in NRW ist das die Landesanstalt für Medien. Ihr Chef Tobias Schmid macht jedoch deutlich: „Ein Koalitionsvertrag ist kein Gesetz. Wir handeln nur, wenn es eine gesetzliche Grundlage gibt.“ Sollte es so weit kommen, werde man sich vor allem auf technische Manipulation konzentrieren – etwa durch Deepfakes oder automatisierte Falschinformationen. Es gehe nicht um einzelne Meinungen, sondern um systematische Eingriffe in den digitalen Diskurs. Damit soll verhindert werden, dass demokratische Prozesse durch gezielte Lügen untergraben werden.
Zwischen Schutz und Zensur
Doch nicht alle sind überzeugt. Kritiker fürchten, dass unter dem Vorwand der Desinformationsbekämpfung auch unliebsame Meinungen ins Visier geraten könnten. NRW-Medienminister Nathanael Liminski hält dagegen: „Freiheit endet dort, wo die des anderen beginnt.“ In Europa sei klar: Antisemitismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Für ihn steht fest: Es geht nicht um Zensur, sondern darum, Recht und Verantwortung auch im digitalen Raum durchzusetzen. Entscheidend bleibt: Die Maßnahmen müssen klar begrenzt, gesetzlich verankert und transparent kontrolliert werden – damit der Schutz der Demokratie nicht zur Gefahr für sie wird.