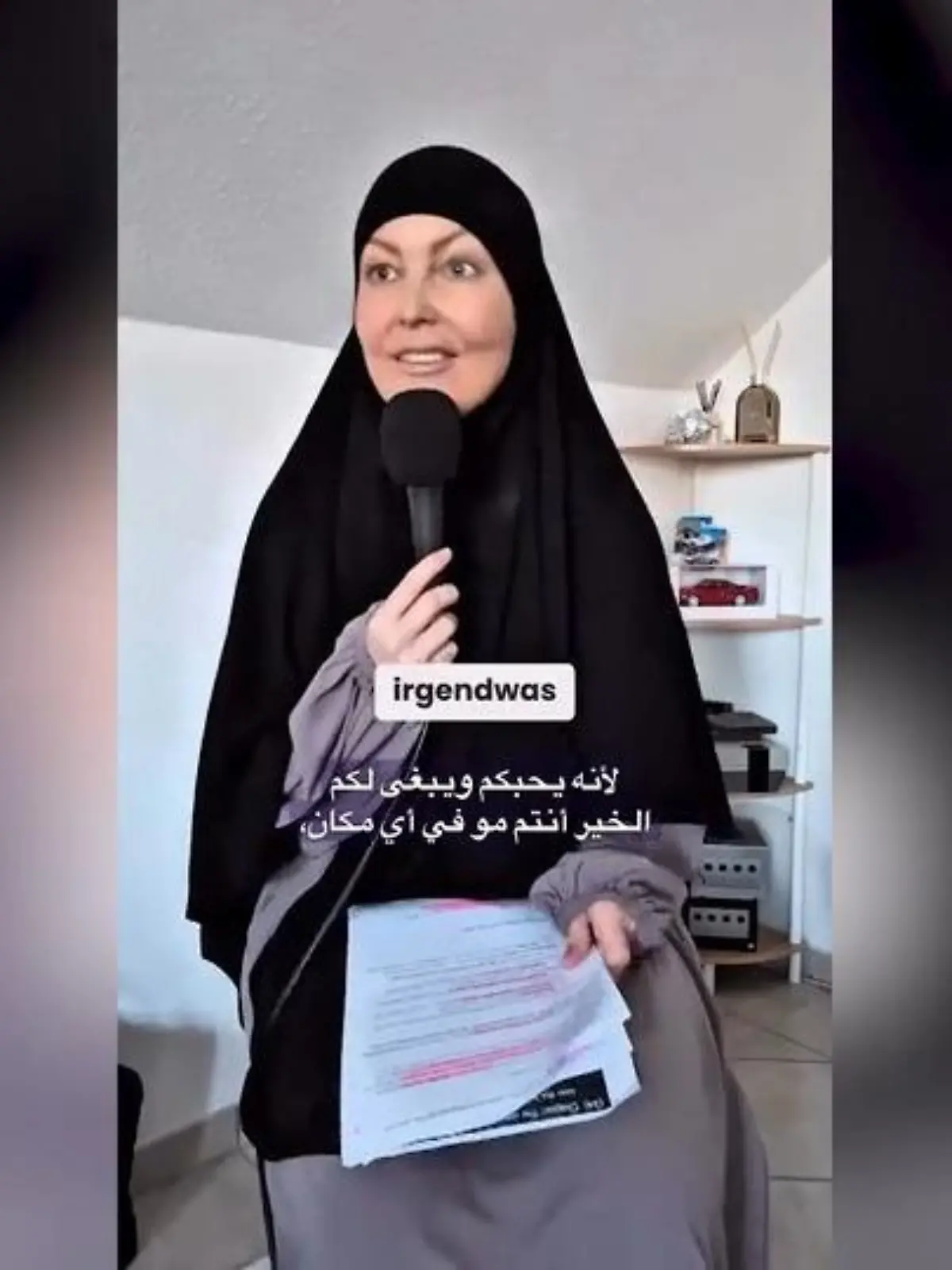Direkt hinter Garagentor war HauptgasleitungOpfer von Neonazi-Attacke wirft Ermittlern Untätigkeit vor: "Nur durch Glück haben wir diesen Brandanschlag überlebt"
Es ist die Nacht auf den 2. Februar 2018. Ferat Kocak und seine Familie schlafen in ihrem Haus in Berlin-Neukölln. Plötzlich wacht Kocak mitten in der Nacht auf, ist erstaunt, wie hell es draußen schon ist. Als er aus dem Fenster schaut, brennt sein Auto lichterloh in Flammen. Das Feuer reicht bis kurz vor die Dachdämmung. Er schreit seine Familie aus dem Schlaf. Sie rufen die Feuerwehr. „Die Feuerwehr hat gesagt, fünf Minuten später und wir wären im Haus mit verbrannt“, berichtet der engagierte Linken-Politiker im RTL-Interview. Doch er ist offenbar nicht das einzige Ziel solcher Attacken.

Linken-Politiker von Neonazis ausgespäht
Das Ganze war offenbar ein Anschlag aus der Neonazi-Szene, die Ferat Kocak wohl schon länger ausgespäht habe. „Nur durch Glück haben wir diesen Brandanschlag überlebt. Denn direkt hinter dem Garagentor war die Hauptgasleitung“, berichtet er. Zwei Verdächtige – Sebastian T. und Tilo P. – geraten ins Visier der Ermittler. Im August soll der Prozess gegen sie beginnen, viereinhalb Jahre nach dem Anschlag.

Haben Polizisten mit Rechten kooperiert?
Ferat Kocak erhebt auch Vorwürfe gegen die Ermittler. Durch Abhörbänder hätten sie wohl gewusst, dass Neonazis ihn beobachten. „Wir hätten sterben können. Nazis haben mich ausgespäht und ich wurde nicht gewarnt“, sagt Kocak.
Offen ist auch noch die Frage, ob möglicherweise Polizeibeamte mit Personen aus der rechten Szene kooperiert haben könnten. So soll sich der tatverdächtige Sebastian T. im April 2018 mit einem LKA-Beamten in einer Kneipe getroffen haben. Ein interner Bericht später habe aber keine Auffälligkeiten gezeigt und Verfassungsrichter waren sich wohl nicht mehr sicher, ob sie die beiden nicht doch verwechselt haben. „Immer wieder haben sich die Betroffenen die Frage gestellt, wie Neonazis an aktuellste Meldeadressen gelangen, an ihre Wohnorte gelangen, woher sie diese Daten haben, trotz Umzügen, trotz Daten- und Meldeauskunftssperren“, sagt Bianca Klose von der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus.
Drohschreiben von NSU 2.0 erhalten
Auf den ersten Anschlag gegen Ferat Kocak folgt eine zweite Drohung. Ein NSU 2.0 Schreiben sei eingegangen. Wieder habe er keine Warnung bekommen. Erst zwei Jahre später – beim NSU 2.0 Prozess in Hessen – habe er von dem Drohschreiben erfahren, berichtet der Aktivist.
Drohungen, die Ferat Kocak bis heute nicht loslassen. Immer wieder wacht er nachts von kleinen Geräuschen auf. Nach dem Anschlag 2018 wollte er seinen Job in der Politik eigentlich aufgeben. Seine Mutter aber hielt ihn ab. „Sie hat mir gesagt, wir sind schon einmal geflohen, haben hier unser Zuhause gefunden und wir lassen uns nicht einschüchtern. Deshalb werde ich nicht wegziehen“, so Kocak. Auch seine Eltern schränken sich bis heute im Alltag ein, gehen extra nicht in der Nähe einkaufen. Der 43-jährige Neuköllner möchte wieder vertrauen können – in staatliche Institutionen und in Menschen. Denn der Anschlag belastet ihn bis heute psychisch und körperlich.
Anschläge auch auf Buchhändler aus Neukölln
Die Geschichte von Ferat Kacak ist aber kein Einzelfall. Heinz Ostermann betreibt eine Buchhandlung in Neukölln. Gleich mehrfach wurde er Opfer von Anschlägen aus der rechten Szene, weil er in seinem Geschäft eine Veranstaltungsreihe über die AfD organisiert hat. Erst wurden seine Scheiben eingeworfen, dann brannte das erste Auto, später der Ersatzwagen. Auch in diesem Fall werden wieder die bekannten Neonazis aus Neukölln verdächtigt.
Experten aber sind sich sicher, dass hinten den Taten aus Neukölln keine Einzelpersonen allein stecken können, sondern ein breites Netzwerk. Wie groß das Problem tatsächlich ist und woher die Tatverdächtigen ihre Infos hatten, soll jetzt der Untersuchungsausschuss klären. Ferat Kocak sitzt selbst als Politiker im Untersuchungsausschuss und hofft, wie auch Heinz Ostermann – auf Antworten, die Klarheit schaffen.
Untersuchungsausschuss beschäftigt sich mit Anschlagsserie in Neukölln
70 Taten aus der rechten Szene werden der Neuköllner Anschlagsserie zugeordnet. Nach Anschlägen 2011 und 2012 gibt es seit 2016 also eine neue Serie. Immer richtet sie sich gegen Menschen, die sich gegen Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus und Rechtspopulismus engagieren. Die Liste reicht von Brandanschlägen auf Autos und Wohnungen, Drohschreiben an Hauswänden, Farb- und Flaschenwürfen bis zu Morddrohungen. Trotz der vielen Taten wurden Täter bisher nicht verurteilt. Dabei sei das Netzwerk bekannt.
„Daher stellen sich für die Betroffenen nun die Fragen, wurde nicht angemessen untersucht, gab es eventuell sogar Zulieferer aus den Sicherheitsbehörden in das Neonazi-Netzwerk hinein, gab es sogar Menschen, die die Ermittlungen behindert haben“, erzählt Bianca Klose von der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus. Diesen Fragen geht ab Donnerstag auch ein Untersuchungsausschuss nach, bei dem Berliner Abgeordnete den Sicherheitsbehörden Fragen stellen.