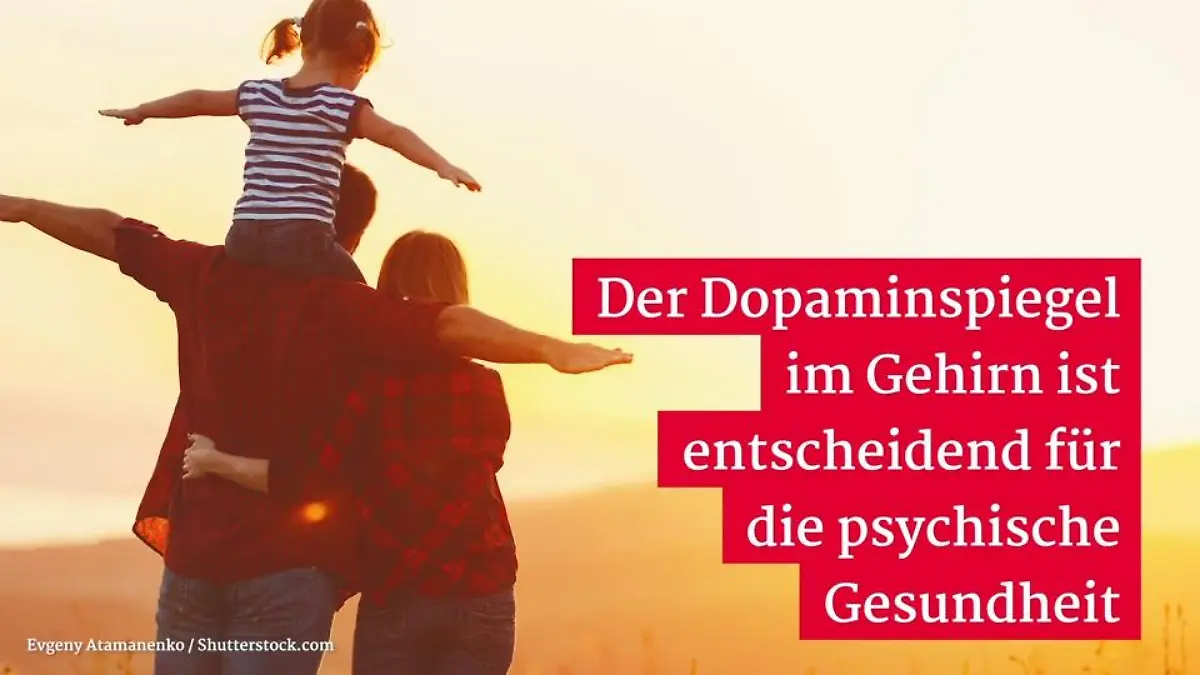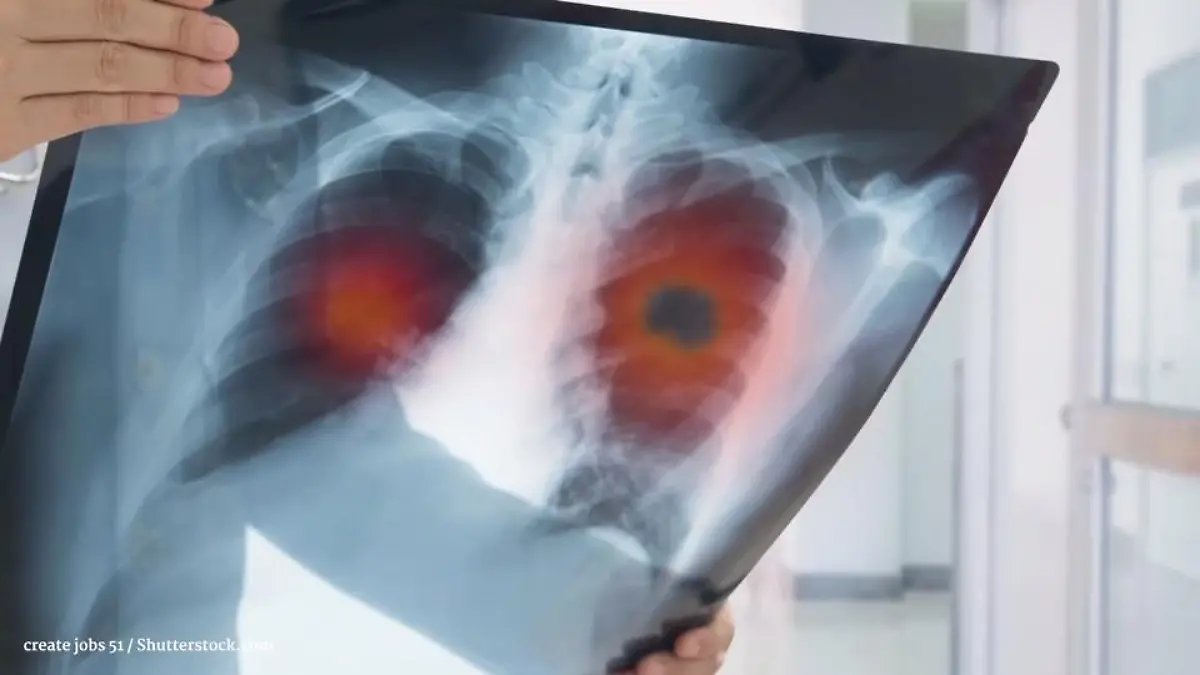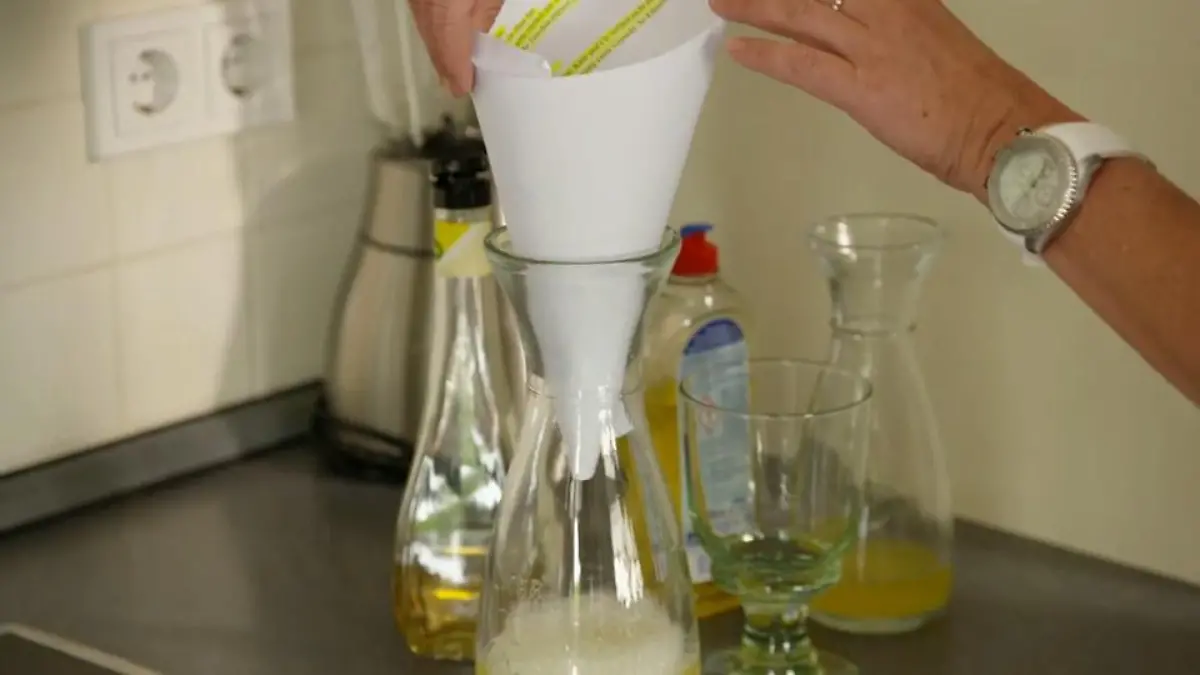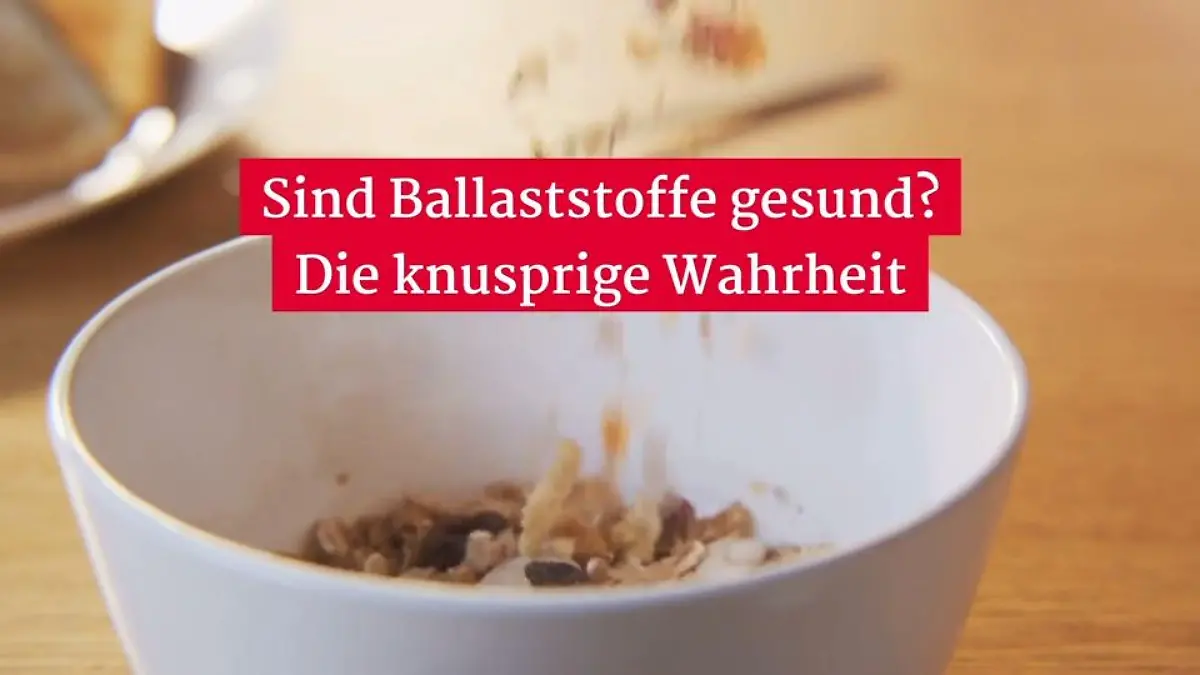Eine der bekanntesten und häufigsten Erkrankungen des NervensystemsGesundheitslexikon: Parkinson
Unter der Bezeichnung „Schüttellähmung“ beschrieb der englische Arzt James Parkinson im Jahr 1817 erstmals die Symptome der später nach ihm benannten Erkrankung. Heute sind in Deutschland schätzungsweise zwischen 300.000 und 400.000 Menschen von der Parkinson-Krankheit betroffen. Zu den typischen Merkmalen der Erkrankung gehört ihre langsam voranschreitende Entwicklung, die bei Betroffenen meist zwischen dem fünfzigsten und neunundsiebzigsten, in seltenen Fällen jedoch auch schon vor dem vierzigsten Lebensjahr einsetzt.
Was ist Parkinson?
Bei Parkinson handelt es sich um eine so genannte neurodegenerative Erkrankung. In ihrem Verlauf sterben im Bereich des Mittelhirns mehr und mehr Nervenzellen ab. Es kommt zu einem Mangel an Dopamin, welches für gewöhnlich in diesen Zellen produziert wird und als Neurotransmitter der Reizübertragung dient. Fehlt Dopamin im Bereich der Basalganglien, können unwillkürliche Bewegungen die Folge sein: Es kommt zu typischen Parkinson-Symptomen wie Zittern oder Gang- und Gleichgewichtsstörungen. Im „Diagnose-Katalog ICD-10“ werden Parkinson-Diagnosen unter dem Schlüssel G20 gegliedert. Die seltener auftretenden sekundären Parkinson-Formen finden sich unter G21, Parkinson in Kombination mit andernorts klassifizierten Krankheiten unter G22.
Ursachen
Neben dem bereits angesprochenen Dopamin-Mangel können auch andere Faktoren für das allmähliche Absterben von Nervenzellen verantwortlich sein. Im Falle des – allerdings sehr seltenen – familiären Parkinson-Syndroms findet eine Vererbung der Krankheit statt. Sekundäre Parkinson-Syndrome könnten unter anderem auch durch bestimmte Giftstoffe oder Medikamente ausgelöst werden. Obgleich die Erforschung der möglichen Ursachen für Parkinson seit vielen Jahren vorangetrieben wird, ist eine vorbeugende Behandlung bisher noch nicht möglich.
Anzeige:Symptome
Die inzwischen nicht mehr verwendeten Begriffe Schüttel- und Zitterlähmung beschreiben ein für Morbus Parkinson typisches Symptom: den Tremor. Neben diesem für die Erkrankten unbeherrschbaren Muskelzittern äußert sich die Erkrankung auch in Form verlangsamter Bewegungen, in der Fachsprache auch „Bradykinese“ genannt. Hinzu kommen eine Haltungsinstabilität mit Gang- und Bewegungsstörungen sowie eine im Lateinischen als „Rigor“ bezeichnete Muskelsteifheit. Bevor die genannten Hauptsymptome von Parkinson auftreten, kündigt sich die Krankheit im Frühstadium unter anderem durch Schmerzen und Verspannungen in Nacken, Schultern und Armen an. Auch Schlafstörungen, Unruhe oder depressive Verstimmungen können auf beginnenden Morbus Parkinson hinweisen.
Diagnose
Zur zuverlässigen Diagnose nach dem Auftreten typischer Frühsymptome empfiehlt die „Deutsche Gesellschaft für Neurologie “ (DGN) eine umfassende klinisch-neurologische Untersuchung. Hierbei sollte unbedingt auch ein bildgebendes Verfahren wie die Kernspin- oder Computertomografie zum Einsatz kommen. Zuvor kann bereits mittels eines L-Dopa-Tests auf Parkinson geschlossen werden: Sofern die Einnahme des Wirkstoffs L-Dopa zu einer Verbesserung des Zustands führt, ist eine bestehende Erkrankung sehr wahrscheinlich.
Behandlung/Therapie
Im Rahmen einer Parkinson-Behandlung steht meist die Einnahme von Medikamenten zur Eindämmung der typischen Symptome im Vordergrund, um Betroffenen je nach Krankheitsstadium eine möglichst selbständige Bewältigung ihres Alltags zu ermöglichen. L-Dopa ist als Vorstufe des Dopamins das wichtigste Medikament bei Parkinson. In Deutschland erhältliche Präparate enthalten zusätzlich einen Decarboxylasehemmer, der den L-Dopa-Abbau verlangsamt. Eine weitere Behandlungsmethode stellt die tiefe Hirnstimulation mittels eines programmierbaren Impulsgenerators dar; hinzu kommen diverse Ansätze aus der Gentherapie. Spezielle Übungen zur Mobilisierung des Bewegungsapparates, Entspannungs- und Atemübungen sowie die regelmäßige Massage (potenziell) betroffener Körperregionen können sich positiv auf das Krankheitsbild auswirken.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel kann einen Besuch beim Arzt nicht ersetzen. Er enthält nur allgemeine Hinweise und darf daher keinesfalls zu einer Selbstdiagnose oder Selbstbehandlung herangezogen werden.