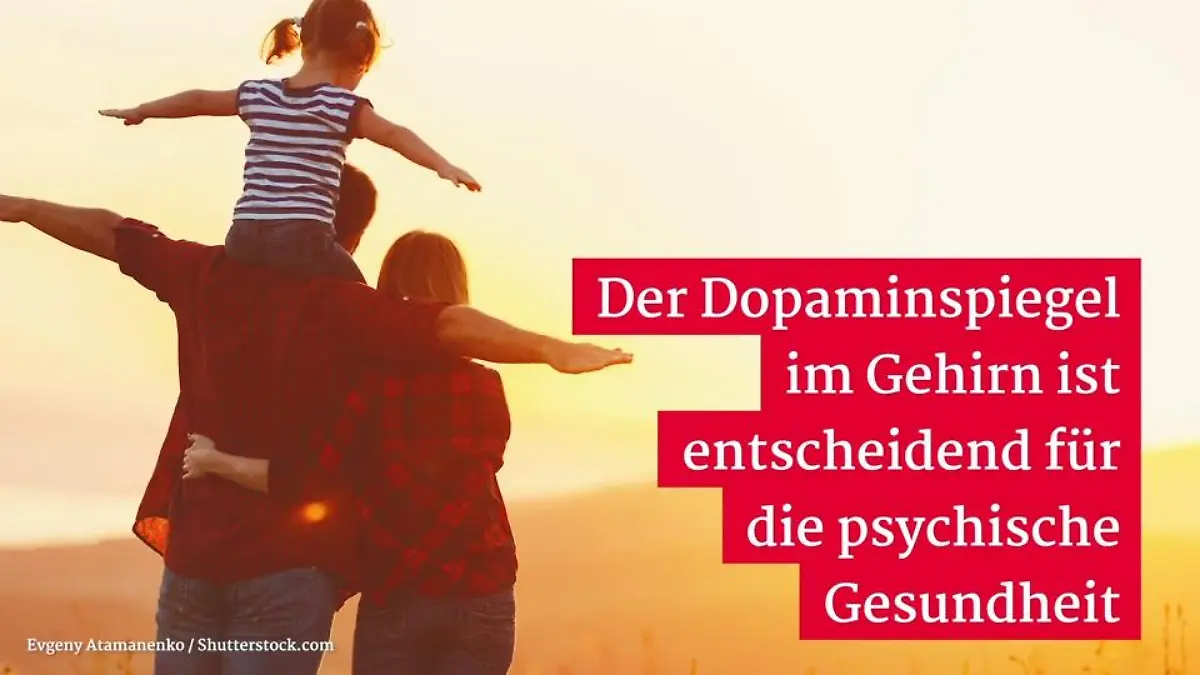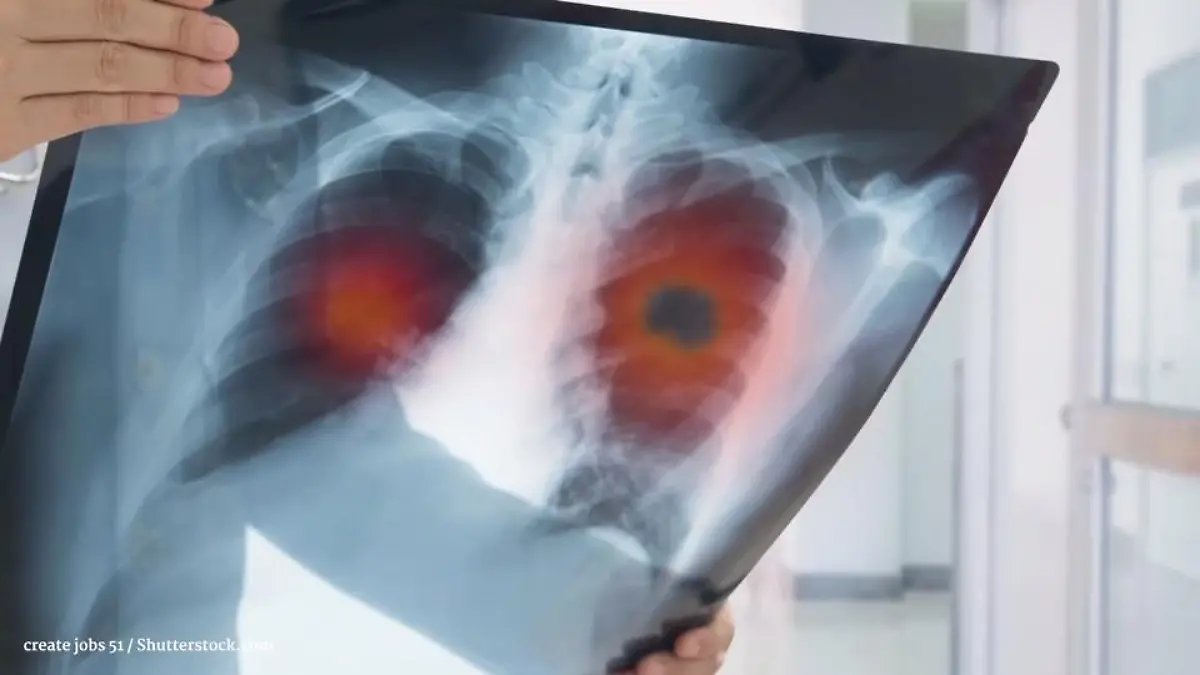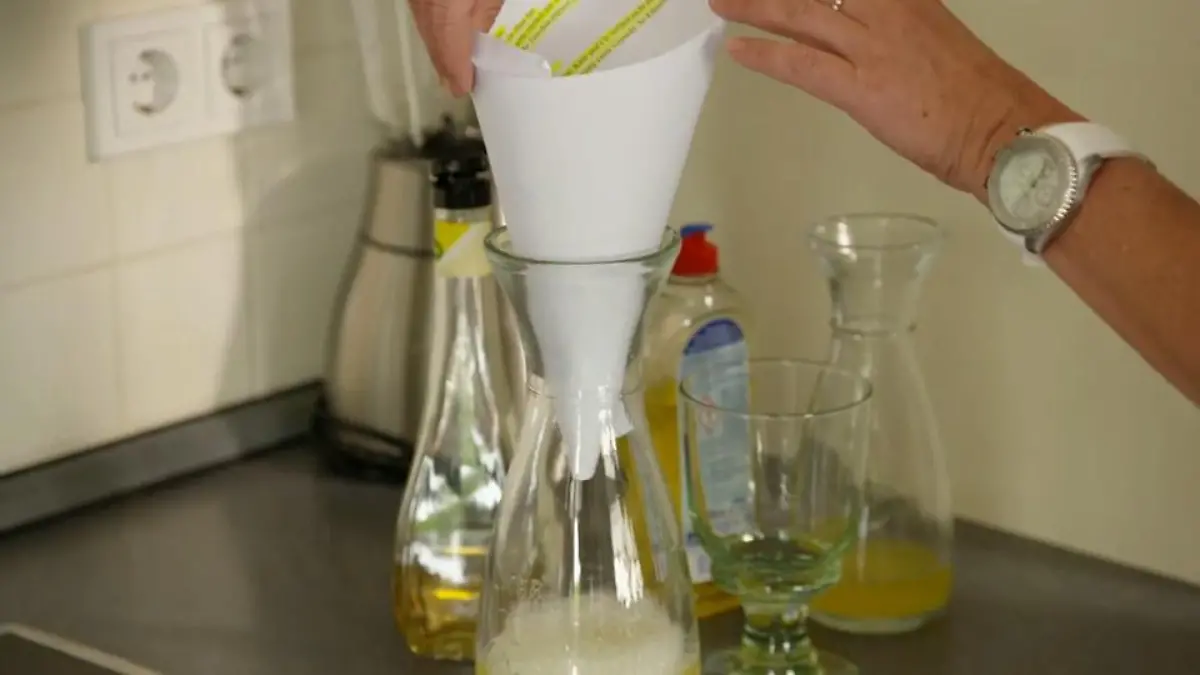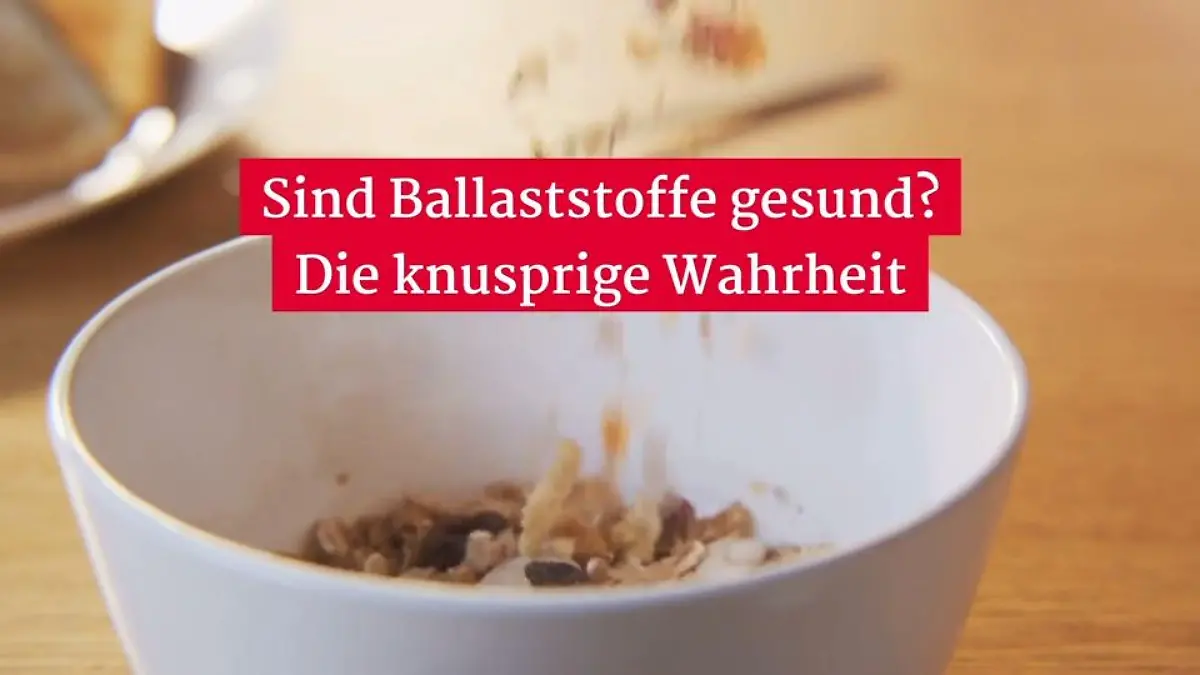Neurologische ErkrankungGesundheitslexikon: Epilepsie
Der Begriff Epilepsie fasst eine Gruppe verschiedener Gehirnerkrankungen zusammen. Allen gemeinsam ist das wiederholte Auftreten epileptischer Anfälle. Ein epileptischer Anfall ist eine Art Kurzschluss im Gehirn, denn unsere Nervenzellen stehen unter Strom. Sie laden sich auf und entladen sich. Die dadurch entstehenden elektrischen Impulse steuern alle menschlichen Aktivitäten. Bei einem Gesunden sind diese Vorgänge fein aufeinander abgestimmt. Während eines Anfalls ist das Zusammenspiel jedoch gestört. Plötzlich kommt es zu chaotischen Entladungen größerer Zellverbände. Die Muskeln erhalten überschießende Impulse, was zu Zuckungen und Krampfzuständen führt.
Die Entstehung von Epilepsie ist vielfältig und komplex
Alles, was die Funktion des Gehirns krankhaft verändert, kann auch Epilepsie verursachen. Beispiele dafür sind Kopfverletzungen, Gehirninfektionen (Meningitis, Encephalitis), ein Hirntumor oder Schlaganfall, Drogenvergiftung, Drogenentzug und Stoffwechselstörungen. Manchmal entwickelt sich die Anfallsneigung ohne ersichtlichen Grund oder durch ererbte Anlagen.
Symptome hängen von der Form der Erkrankung und der Ausprägung ab
Mögliche Anzeichen eines epileptischen Anfalls sind Muskelzuckungen, Krämpfe, Bewusstseinstrübung, Bewusstlosigkeit, Schaum vor dem Mund, starker Speichelfluss, starre Haltung, Zungenbiss und Urinabgang. Einige Betroffene können einen Anfall voraussagen, weil sie kurz davor eine sogenannte Aura verspüren, ein seltsames Gefühl des Unwohlseins.
Bei den Anfällen wird zwischen fokalen und generalisierten Epilepsien unterschieden. Fokale Epilepsien gehen von einem bestimmten Hirnareal aus. Bei einfachen fokalen Anfällen bleibt das Bewusstsein erhalten, während komplexe fokale Anfälle zu Bewusstseinsstörungen führen. Betroffene verhalten sich oft seltsam, reagieren nicht auf Ansprache und wiederholen automatisch gewisse Bewegungen. Später können sie sich an nichts mehr erinnern.
Bei der generalisierten Form sind große Gebiete beider Gehirnhälften betroffen. Die mildeste Ausprägung dieser Anfallsform ist die Absence (Petit Mal). Sie tritt meistens bei Kindern auf. Es kommt nur zu ganz kurzen Bewusstseinsverlusten, die für Außenstehende wie Tagträumen aussehen können. Beim großen epileptischen Krampfanfall (Grand Mal) bricht der Kranke bewusstlos zusammen. Es folgen die typischen Verkrampfungen und Zuckungen. Meistens ist alles nach wenigen Minuten vorbei. Es gibt aber auch Krampfattacken, die wesentlich länger dauern.
Anzeige:Diagnose: Erhebung einer Anamnese
Für eine genaue Diagnose brauchen die Ärzte so viele Einzelheiten über den Anfall wie möglich. Häufig werden Verwandte oder Augenzeugen befragt. Zur weiteren Abklärung wird meist ein EEG (Elektroenzephalogramm, Gehirnstrommessung) gemacht. Nicht immer ergeben sich dabei Auffälligkeiten. Deswegen sind manchmal Langzeittests oder ein Schlaf-EEG nötig, um krankhafte Veränderungen aufzuzeichnen. Bei Erwachsenen werden in einigen Fällen die Herzströme mittels EKG (Elektrokardiogramm) gemessen, um Herzrhythmusstörungen als Ursache für die Ohnmacht auszuschließen. Mitunter sind zusätzliche Bluttests oder ein Gehirn-CT erforderlich.
Behandlung: Therapie nicht immer nötig
Bei der Behandlung von Epilepsie sind Medikamente die erste Wahl. Sogenannte Antikonvulsiva senken wirksam die Häufigkeit von Anfällen, haben aber auch Nebenwirkungen. Hier muss der Arzt abklären, welches Präparat im Einzelfall geeignet ist.
Wenn Medikamente nicht anschlagen, kann auch eine Operation helfen. Das geht allerdings nur, wenn man das betroffene Gehirnareal genau lokalisieren und relativ leicht entfernen kann.
Eine weitere Therapieform ist die Vagusnervstimulation, bei der ein implantierter Stimulator elektrische Signale an das Gehirn sendet.
Vorbeugung gegen Epilepsie
Vorbeugend sollten mögliche Auslöser für Anfälle, wie übermäßiger Alkoholkonsum, Schlafentzug und bestimmte Medikamente, gemieden werden.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel kann einen Besuch beim Arzt nicht ersetzen. Er enthält nur allgemeine Hinweise und darf daher keinesfalls zu einer Selbstdiagnose oder Selbstbehandlung herangezogen werden.