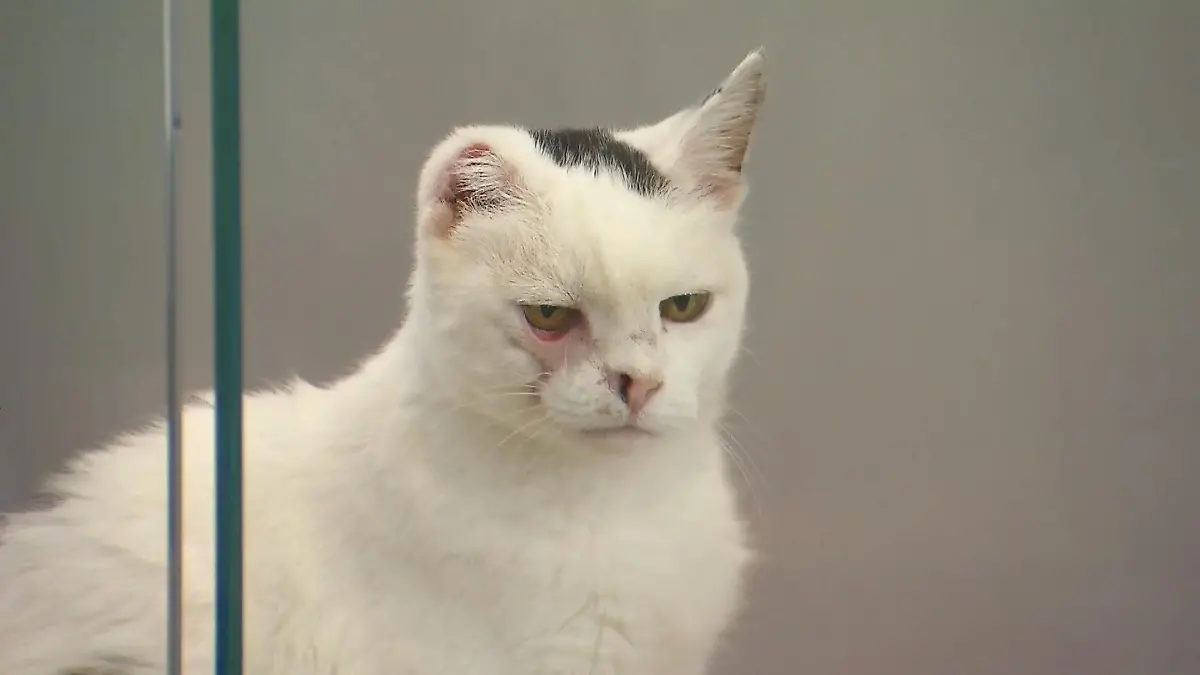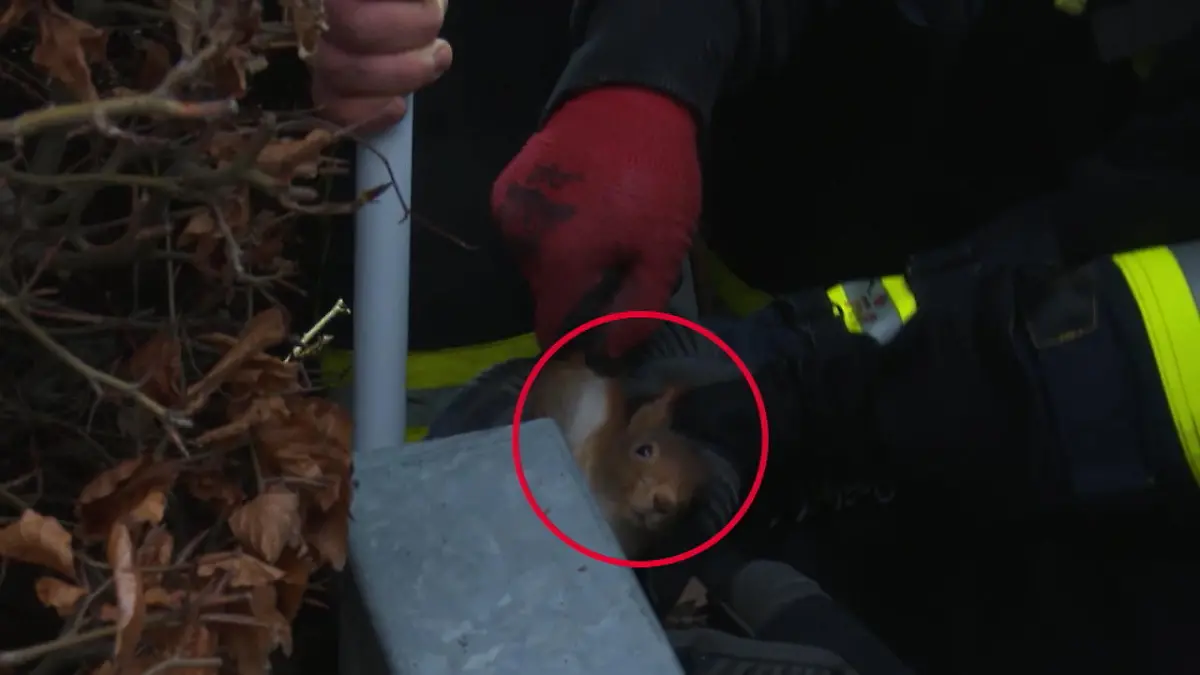Krasser VergleichStudie: Süßigkeiten verändern das Gehirn! Arzt sieht „Ähnlichkeit zu Drogen“

Fettige Pommes, ein leckeres Stück Kuchen oder eine Tafel Schokolade: Die Versuchungen lauern überall und vielen Menschen fällt es schwer, die Finger von süßem und fettigem Essen zu lassen. Eine Studie lässt nun darauf schließen, dass diese Vorliebe erlernt ist.
Lese-Tipp: „Kinder sollten davon wegkommen, dass Süßes eine Belohnung ist!“
Fettige und süße Lebensmittel aktivieren das Belohnungssystem
Warum wir zu Schokolade, Chips und Pommes nur schwer Nein sagen können, hat ein Team des Max-Planck-Instituts für Stoffwechselforschung in Köln anhand der Hirnaktivität von Probanden untersucht. Die Studie habe gezeigt, dass fettige und süße Lebensmittel das Belohnungssystem stark aktivierten, teilte das Institut am Mittwoch mit. Das Gehirn lerne, unbewusst solche Lebensmittel zu bevorzugen. Die Ergebnisse sind im Fachjournal „Cell Metabolism“ veröffentlicht.
„Unsere Neigung zu fett- und zuckerreichen Lebensmitteln, der sogenannten westlichen Ernährung, könnte angeboren sein oder sich als Folge von Übergewicht entwickeln. Wir denken aber, dass das Gehirn diese Vorliebe erlernt“, erklärte Erstautorin Sharmili Edwin Thanarajah die zentrale Hypothese der Studie.
Im Video: Experten fordern Werbeverbot für Süßigkeiten
"Die Ähnlichkeit zu Drogen ist absolut gegeben"
Um die These zu überprüfen, gaben die Forscherinnen und Forscher einer Gruppe normalgewichtiger Probanden acht Wochen lang zusätzlich zur normalen Ernährung zweimal täglich einen fett- und zuckerreichen Pudding. Die andere Gruppe erhielt einen Pudding, der zwar die gleiche Kalorienanzahl, aber weniger Fett und Zucker enthielt. Vor und während der acht Wochen maß das Team die Hirnaktivität der Probanden.
„Menschen, die übergewichtig sind, essen im Allgemeinen auch mehr, auch wenn es ihnen vielleicht nicht so bewusst ist – das hat mit der Umstellung des gesamten Stoffwechsels zu tun. Das war bekannt, aber man wollte jetzt wissen, ob es möglicherweise bevor überhaupt diese ganzen Körperprozesse einsetzen, auch schon Veränderungen im Hirn nachweisbar sind – und zwar im Belohnungszentrum“, erklärt Medienjournalist und Allgemeinmediziner Dr. Christoph Specht im RTL-Interview.
Lese-Tipp: Ist das zu viel?Süßigkeiten den ganzen Tag, ohne Limit
Die Messungen zeigten demnach, dass der fett- und zuckerreiche Pudding das sogenannte dopaminerge System der Probanden besonders stark aktivierte. Diese Region im Gehirn ist für Motivation und Belohnung zuständig. „Unsere Messungen der Gehirnaktivitäten haben gezeigt, dass sich das Gehirn durch den Konsum von Pommes und Co. neu verdrahtet. Es lernt unterbewusst, belohnendes Essen zu bevorzugen“, sagte Studienleiter Marc Tittgemeyer.
Dr. Specht wagt sogar einen krassen Vergleich: „Die Ähnlichkeit zu Drogen ist absolut gegeben. Man hat gesehen, dass das Belohnungszentrum, was ja über Dopamin letztendlich gesteuert wird, bei dieser fettreichen Ernährung ähnlich aktiviert wird. Dass sich neuronale Kreise aufbauen, ähnlich wie das auch bei Drogen der Fall ist.“
Veränderungen des Gewichts und der Blutwerte seien bei den Probanden nicht festgestellt worden.
Ihre Meinung interessiert uns!
Die Vorliebe nach Süßem wird auch nach der Studie anhalten
Die Forscherinnen und Forscher gehen davon aus, dass die erlernte Vorliebe auch nach der Studie anhalten wird. „Die Forscher sagen selbst, sie waren überrascht, dass sich diese neuronalen Kreise erstens in dieser kurzen Zeit bilden und dass man zweitens auch annehmen muss, dass sie auch relativ lange bleiben“, so Specht. Zwar wurde nicht untersucht, wie lange sie wirklich so existieren, aber man könne sich leicht vorstellen, dass wenn man mehr Fettes und Zuckerhaltiges esse, diese Netzwerke erhalten blieben.
Lese-Tipp:So verändert eine Ernährungsumstellung Ihr Leben
Somit erreichen wir genau das, was wir nicht haben wollen. Jedoch heiße das nicht, dass wir gar keinen Einfluss haben. „Es bedeutet nur, dass es schwerer, als man vielleicht gedacht hat“, so Specht.
Doch wie gelingt es wieder, von dem Zucker und Fett wegzukommen?
Das Wichtigste, was man aus der Studie rausnehmen könne, sei laut Specht die Erkenntnis, dass es so etwas wie eine „Umprogrammierung des Gehirns in diese negative Richtung“ gebe. „Das kann man auf der einen Seite als Entschuldigung nehmen und sagen: ‘Ich kann ja gar nichts dafür, mein Hirn ist so programmiert.’ Auf der anderen Seite kann man auch sagen: ‘Ich möchte das nicht!’ Dafür muss man aber noch mehr Anstrengung unternehmen, diese Regelkreise zu unterbrechen. Das ist möglich – setzt aber starken Willen voraus“, so Dr. Specht.
Die Studie wurde in Zusammenarbeit mit Forschenden unter anderem der Yale University in New Haven (USA) durchgeführt. Das Team gibt zu bedenken, dass die Analyse unter anderem wegen der recht kleinen Probandenzahl (57) nur erste Hinweise, aber keine Gewissheiten liefere. Bei unter- oder übergewichtigen Menschen könne das Ergebnis zudem anders ausfallen. Gleiches gelte für andere Snackarten und eine andere Testdauer. (dpa/kko)