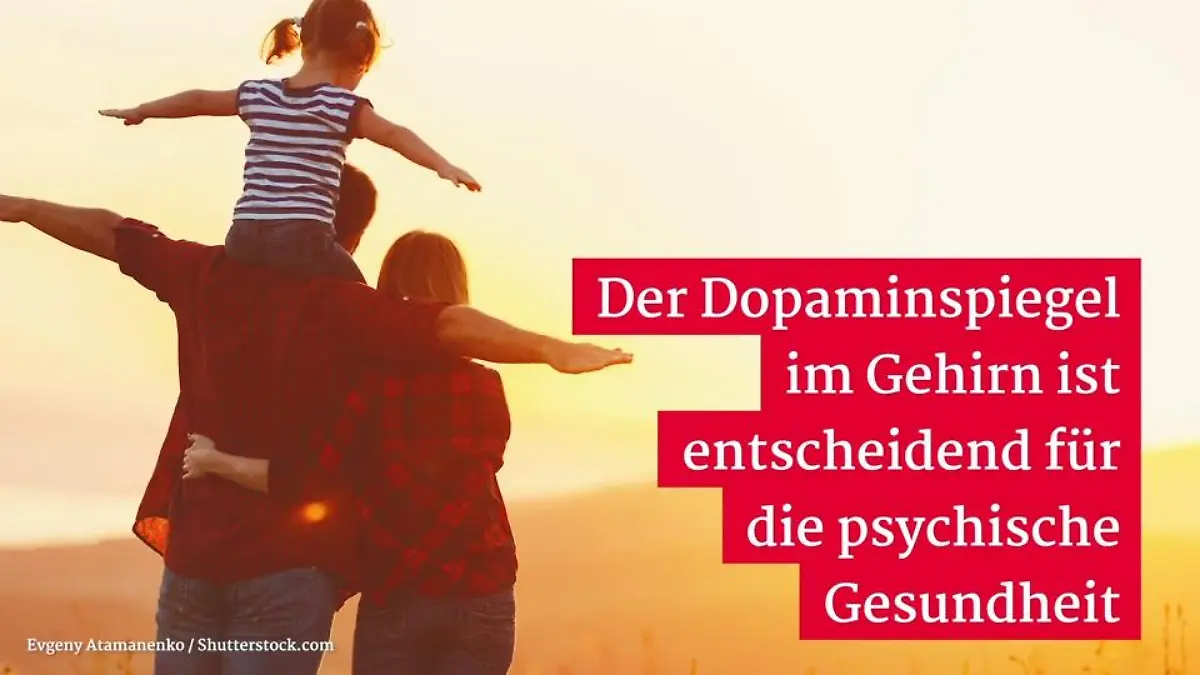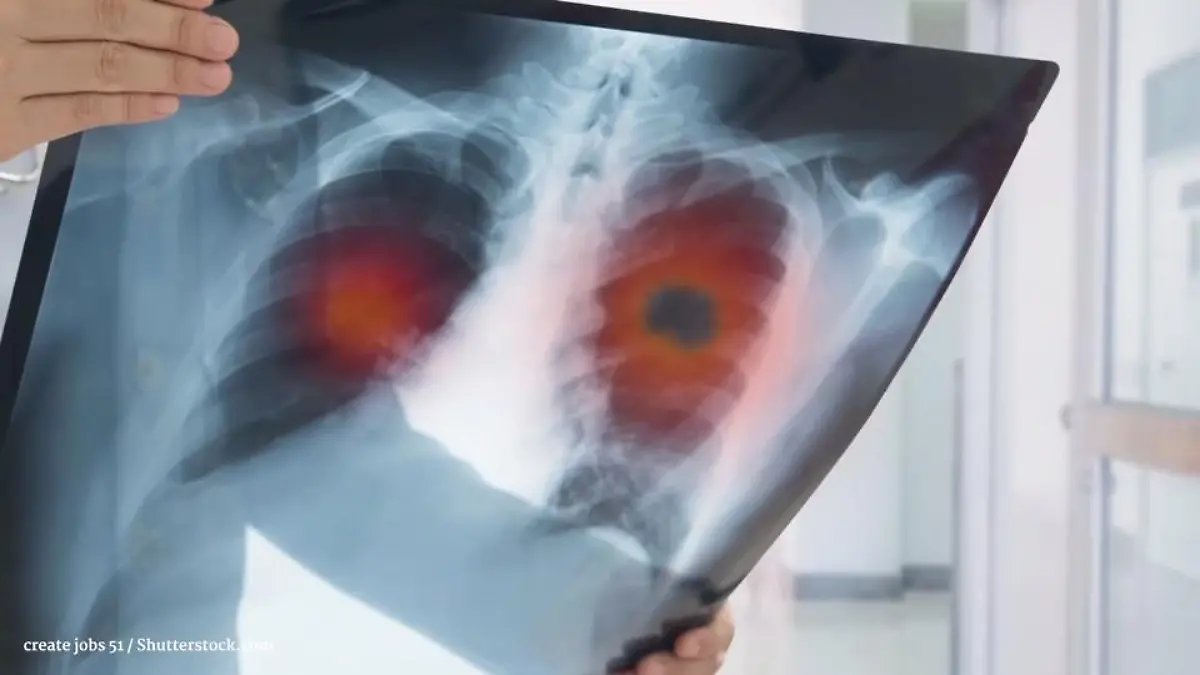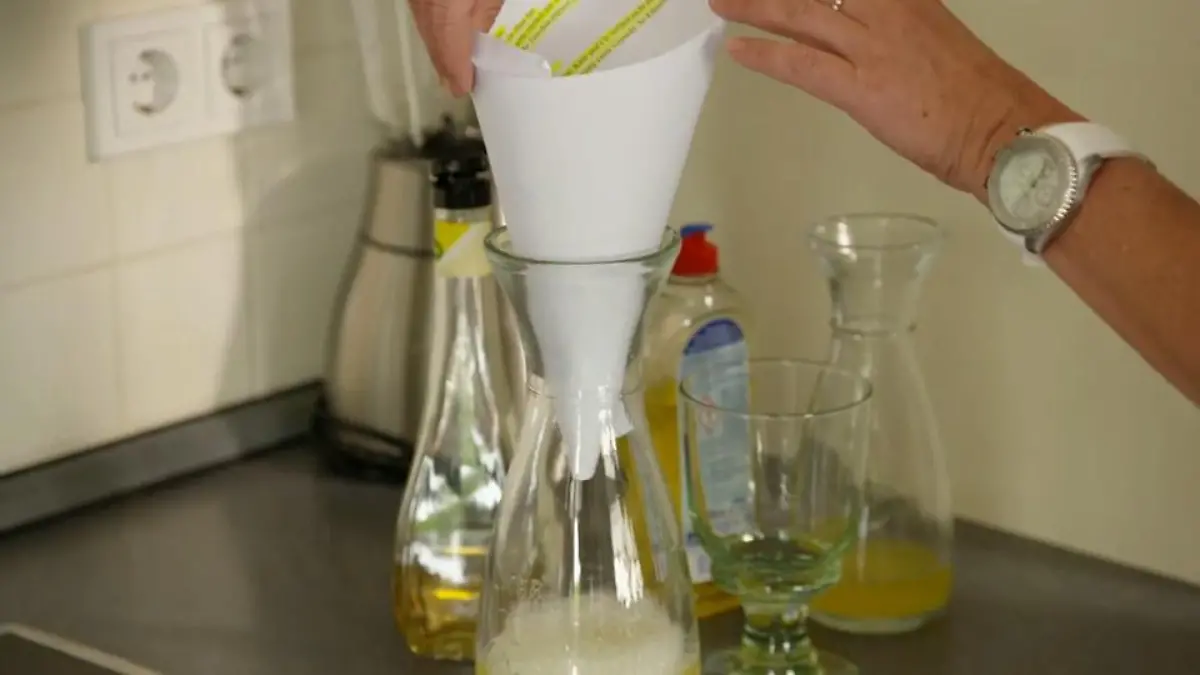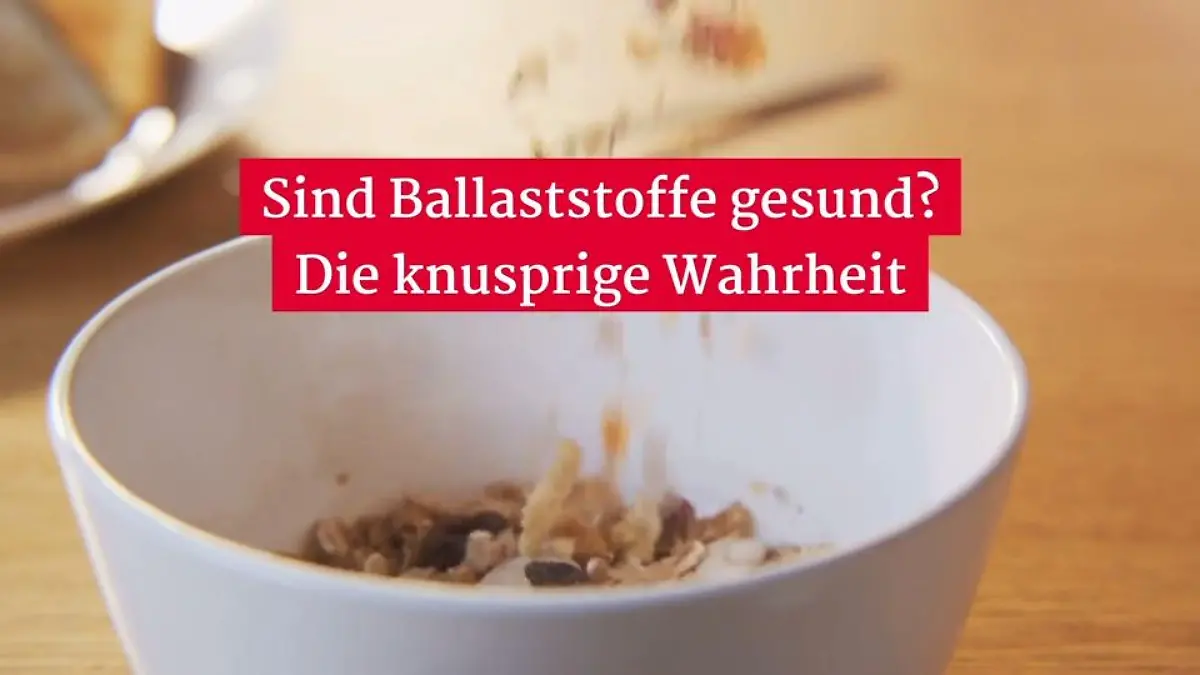Ganzheitliche Betrachtungsweise und KrankheitslehreGesundheitslexikon: Psychosomatik
Das altgriechische Wort ‚Psyche‘ steht für die Seele oder den Atem, ‚Soma‘ bedeutet so viel wie Körper, Leib oder Leben. Körperliche und seelische Prozesse sind untrennbar miteinander verbunden. Sie stehen gleichzeitig in Wechselwirkung mit ihrer Umwelt. Dementsprechend betrachtet die psychosomatische Medizin den Menschen in seiner Gesamtheit als somato-psycho-soziales Wesen. Zur Erklärung dieser komplexen Zusammenhänge existieren verschiedene theoretische Modelle, die sich bis zum Beginn der wissenschaftlichen Medizin unter Hippokrates (um 400 vor Christus) zurückverfolgen lassen.
Erklärungsmodelle psychosomatischer Erkrankungen
Neuere theoretische Konzepte betrachten psychosomatische Störungen und Krankheiten nicht mehr getrennt von den übrigen Erkrankungen. Das Stresskonzept sieht Stress als überstarke oder lang andauernde Reaktion des Organismus auf belastende Reize seiner Umwelt sowie das Versagen von Mechanismen, die ein natürliches Gleichgewicht aufrechterhalten könnten. Das neurohumorale Modell besagt, dass bei jeder Form der Aktivität eine physiologische (natürliche) Veränderung im Körper stattfindet. Stress bewirkt damit auch eine Veränderung des Immunsystems. Das Konzept der menschlichen Handlung, das Konzept des Situationskreises oder das Konversionsmodell nach Freud sind neben tiefenpsychologischen und systemischen Modellen weitere Möglichkeiten einer Ursachendarstellung psychosomatischer Erkrankungen.
Psychosomatische Störungen und Krankheitsbilder
Patienten mit einer Herzphobie oder Herzneurose sind mit der hypochondrischen Selbstbeobachtung ihres Herzens oft mehr behindert als durch ihre tatsächlichen Herzbeschwerden. Menschen mit einem Hyperventilationssyndrom klagen über Atemnot, obwohl sie gleichzeitig zu tief atmen: Das Gefühl, nicht durchatmen zu können, verursacht den Zwang, tief atmen zu müssen. Der Magen-Darm-Trakt meldet sich mit Aufstoßen, Sodbrennen, Übelkeit, Blähungen, Schmerzen und Völlegefühl bis hin zu Durchfall und Verstopfung, wenn wir etwas im übertragenen Sinne nicht verdauen können.
Die Verarbeitung und Interpretation von Schmerzen kann sich in Abhängigkeit von inneren Konflikten, aber auch durch körperliche Erziehungsmaßnahmen in der Kindheit oder als Selbstbestrafung verselbstständigen. Häufig sind Schmerzen und Depressionen miteinander verknüpft. Migränepatienten sind häufig Perfektionisten, die Selbstwertstörungen mit Leistung kompensieren wollen. Auch die Haut reagiert auf nicht verarbeitete psychische Konflikte. Neurodermitis-Patienten zeigen Gefühle und Wünsche, die sie nicht verbal äußern können, auf ihrer Haut.
Typisch bei der primären Adipositas (Fettsucht) sind abendliche und nächtliche suchtähnliche Fressanfälle oder übermäßiges Essen in Stresssituationen. Das Essen stellt eine Ersatzbefriedigung für fehlende emotionale Zuwendung dar. Weitere Essstörungen, die mit körperlichen Symptomen in Verbindung stehen, sind die Anorexia nervosa und die Bulimie.
Bedeutung der Psychosomatik in der Medizin
Nach wie vor wird oft versucht, Krankheiten nur nach einem einfachen Ursache-Wirkungs-Prinzip zu erklären – von medizinischen Laien, aber genauso von medizinischem Fachpersonal. Dabei wird psychosomatisch gleichgesetzt mit psychisch oder psychogen und der Patient fühlt sich missverstanden. Darüber wie wichtig der einzelne seelische oder körperliche Faktor bei der Entstehung einer Erkrankung ist, gibt es bei rein somatisch ausgerichteten Medizinern (Schulmediziner) und Vertretern der psychosomatischen Medizin häufig unterschiedliche Auffassungen. Genauso kann es vorkommen, dass Patienten eine psychische Komponente ihrer Erkrankung nicht akzeptieren wollen. Zahlreiche klinische Studien und Untersuchungen beschäftigen sich daher mit der Erforschung von Zusammenhängen körperlicher, seelischer und sozialer Komponenten bei der Entstehung von Krankheiten.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel kann einen Besuch beim Arzt nicht ersetzen. Er enthält nur allgemeine Hinweise und darf daher keinesfalls zu einer Selbstdiagnose oder Selbstbehandlung herangezogen werden.