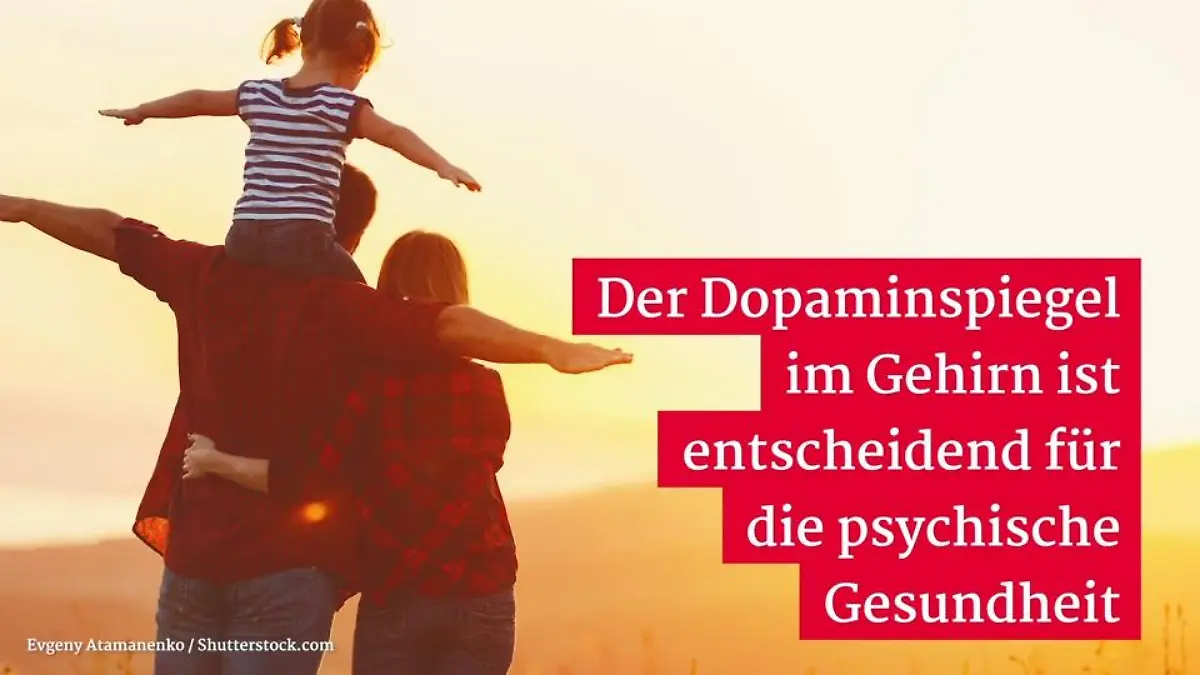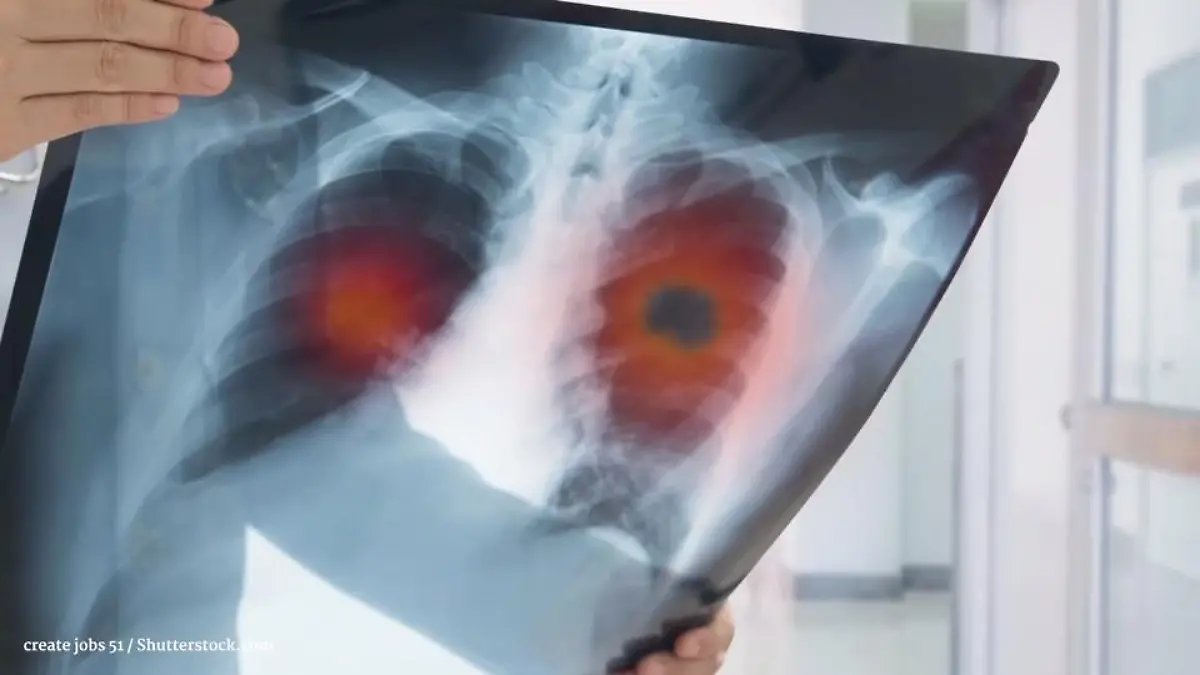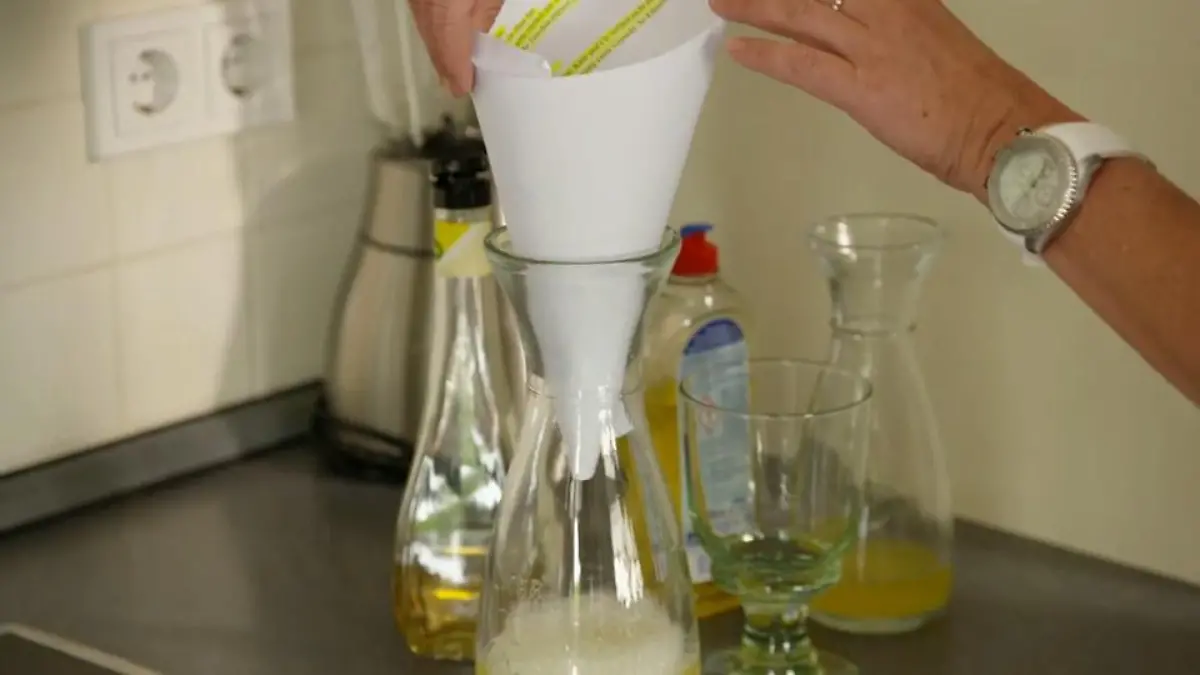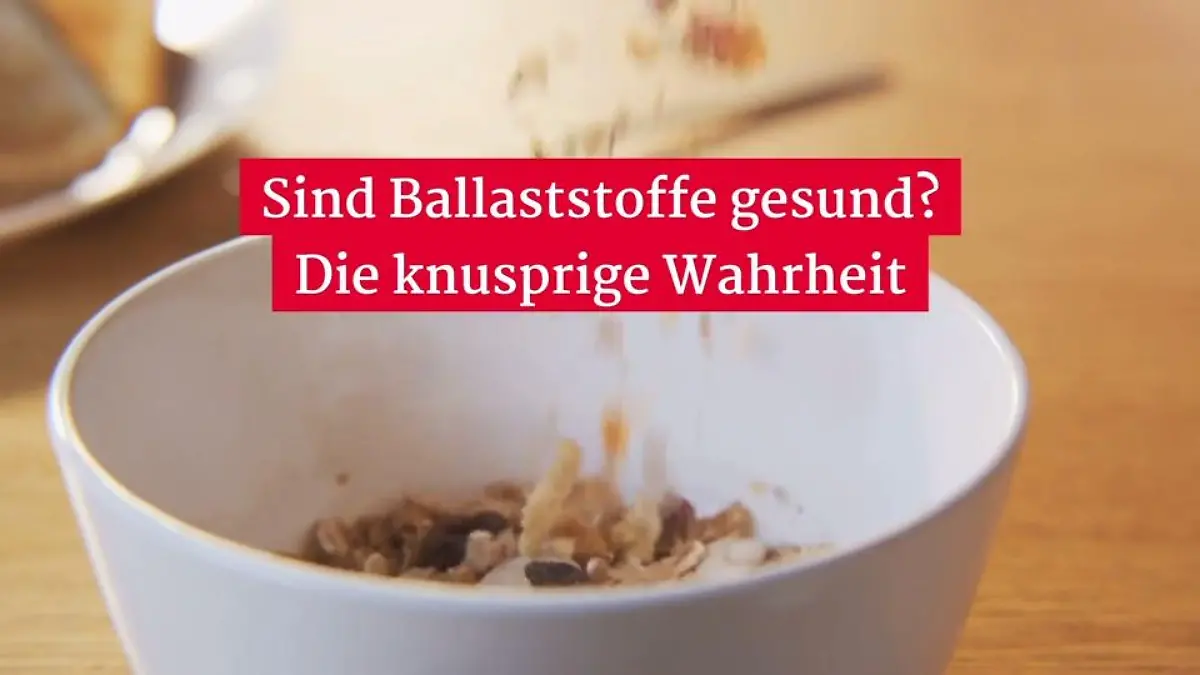Seltene, lebenslang andauernde neurologische ErkrankungGesundheitslexikon: Narkolepsie (Schlafkrankheit)
Die Narkolepsie, auch Schlafkrankheit oder Schlummersucht genannt, ist eine ernst zu nehmende Krankheit. Wer von der neurologischen Erkrankung betroffen ist, wird am helllichten Tag, ohne Vorwarnung, vom Schlaf übermannt. Dabei können neben unangenehmen auch gefährliche Situationen entstehen, etwa im Haushalt, bei der Arbeit oder im Straßenverkehr.
In Deutschland sind rund 40.000 Menschen von der Narkolepsie betroffen. Die Krankheit kann jederzeit auftreten, besonders oft wird ein Ausbruch der Schlafkrankheit zwischen dem zehnten und 20. Lebensjahr sowie zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr beobachtet. Bei der Schlafkrankheit wird zwischen der klassischen Narkolepsie, der Narkolepsie ohne Kataplexie (Muskelerschlaffung) und der sekundären Narkolepsie, verursacht durch eine andere Krankheit, unterschieden.
Ursache
Wie es zur Schlafkrankheit kommt, ist noch ungeklärt. Mediziner vermuten, dass es sich bei der Narkolepsie um eine Autoimmunerkrankung handelt oder dass Influenzaviren oder Streptokokken die Schlafsucht auslösen. Auffällig ist, dass die Mehrzahl der Patienten von einem Hypocretin-Mangel betroffen ist. Der Botenstoff spielt eine wichtige Rolle beim Essverhalten und beim Schlafrhythmus.
Symptome
Die Hauptsymptome der Narkolepsie sind der heftige Schlafdrang und die extreme Tagesschläfrigkeit. Insbesondere passive Tätigkeiten wie langes Sitzen, monotone Situationen oder Dämmerlicht, etwa im Kino, lösen bei Betroffenen ein unwiderstehliches Schlafbedürfnis aus. Dieses wird durch einen unsicheren Gang, eine undeutliche Aussprache und einen glasigen Blick deutlich. Häufig wirkt es, als sei der Narkoleptiker alkoholisiert.
Bei bis zu 90 Prozent der Patienten kommt die Kataplexie hinzu. Dabei erschlaffen die Muskeln plötzlich und der Patient kann trotz Bewusstsein nicht mit seinem Umfeld kommunizieren. Dieser Zustand dauert meist nur wenige Sekunden und kann die gesamte Muskulatur oder einzelne Muskelpartien betreffen. Bekannte Auslöser der Kataplexie sind heftige Gefühlsregungen wie Freude, Überraschung, Furcht, Erschrecken oder Lachen.
Schlaflähmungen und Halluzinationen kommen bei rund der Hälfte der Patienten vor. Beide Symptome treten beim Übergang vom Wach- zum Schlafzustand auf und dauern Sekunden bis wenige Minuten. Besonders gefährlich im Alltag ist das automatische Verhalten, das dann auftreten kann, wenn der Patient dem Schlafdruck nicht nachgeben möchte. In diesem Zustand führt der Narkoleptiker Tätigkeiten fort, registriert aber seine Umwelt nicht mehr. Im Straßenverkehr oder im Haushalt besteht dabei höchste Verletzungsgefahr.
Schlafsüchtige können zudem von weiteren Begleiterscheinungen geplagt sein. Kopfschmerzen, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, Depressionen oder Veränderungen der Persönlichkeit können auftreten.
Diagnose
Oft wird die Narkolepsie erst spät erkannt. Bei Verdacht auf die Erkrankung sollte umgehend ein Schlafmediziner konsultiert werden. Dieser kann anhand der Anamnese und mittels Schlaffragebögen und Schlaftagebücher eine erste Diagnose abgeben. Es folgen Untersuchungen im Schlaflabor, etwa über den Verlauf des Nachtschlafs (Polysomnografie) oder den Grad der Tagesschläfrigkeit. Ein Bluttest kann zudem Aufschluss über eine Autoimmunstörung geben.
Behandlung
Die Schlafkrankheit kann nicht vollständig geheilt, die Symptome aber gemildert werden. Gemeinsam mit dem Patienten sucht der Schlafmediziner die geeignete Therapie. Zum Einsatz kommen Medikamente, die der Tagesmüdigkeit oder der Kataplexie entgegenwirken. Zudem können Verhaltensmaßnahmen, etwa geplante Nickerchen zwischendurch, hilfreich sein. Unterstützend wirkt eine gesunde Lebensweise mit Sport und ohne Alkohol.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel kann einen Besuch beim Arzt nicht ersetzen. Er enthält nur allgemeine Hinweise und darf daher keinesfalls zu einer Selbstdiagnose oder Selbstbehandlung herangezogen werden.