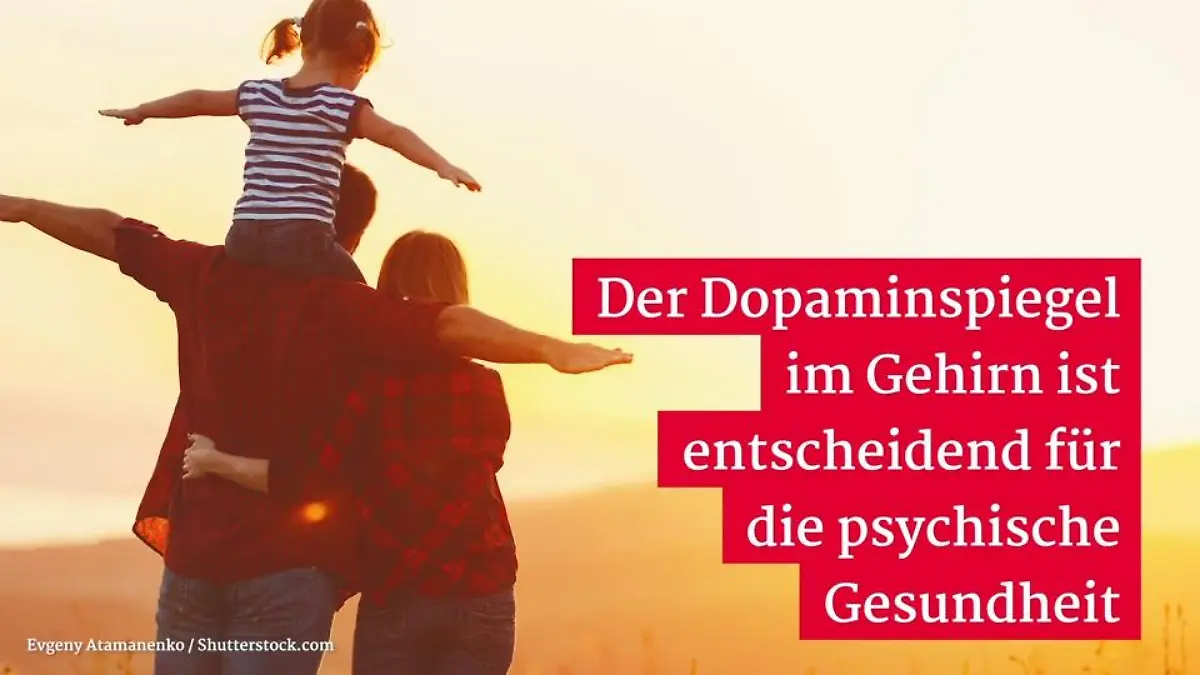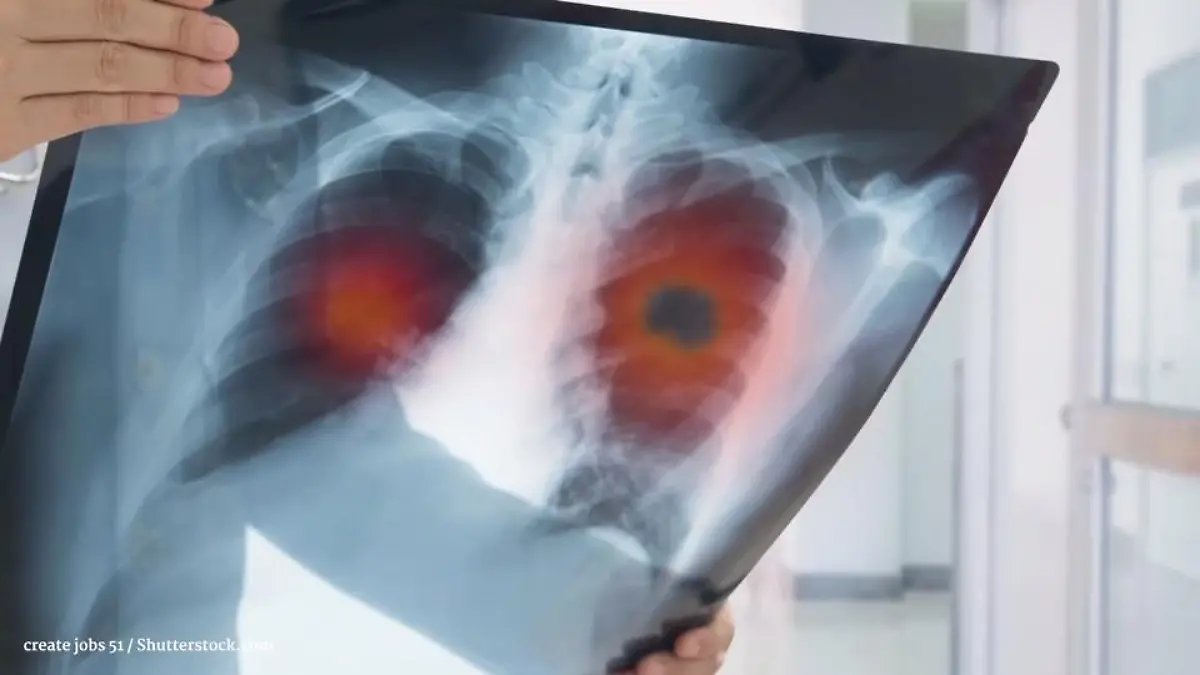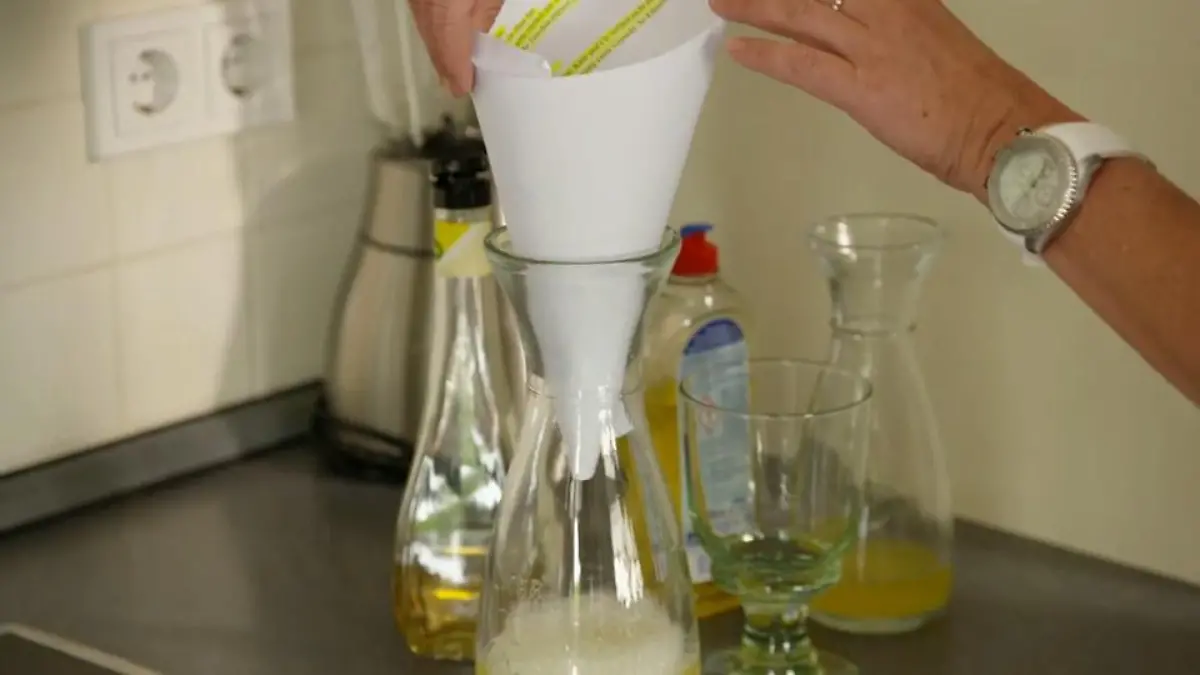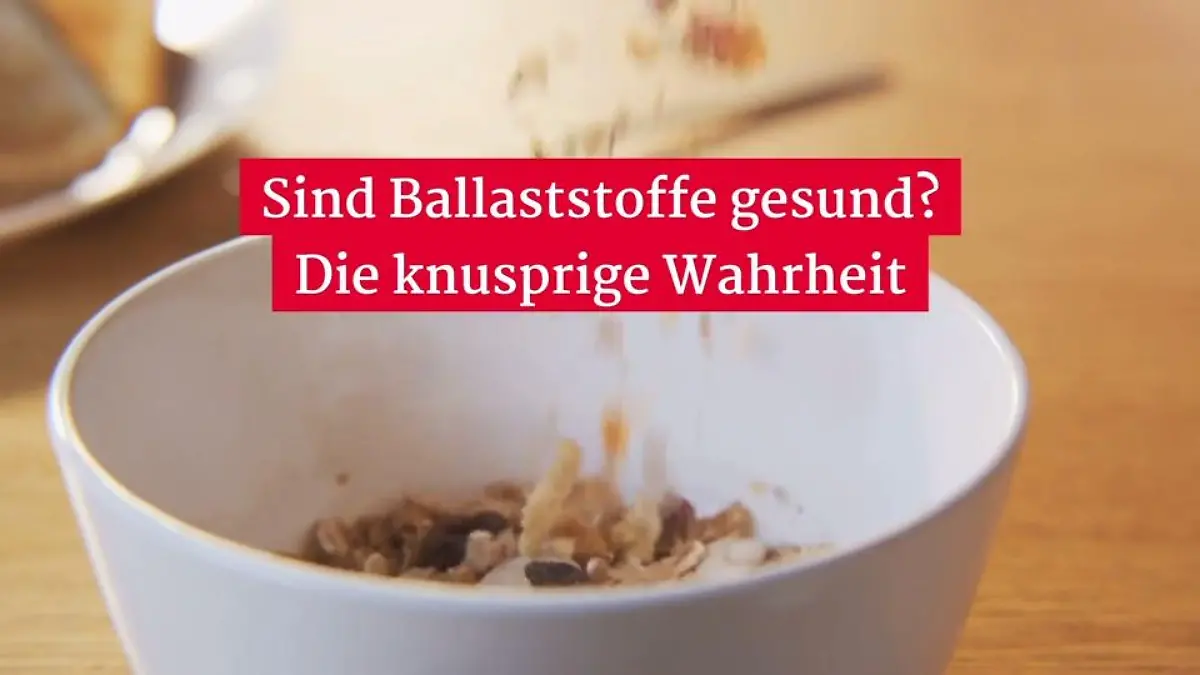Gesundheitslexikon: Anästhesie
Die Anästhesie wird in der Medizin eingesetzt, um Behandlungen möglichst schmerzfrei durchführen zu können. Der Begriff kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet übersetzt ‚ohne Empfindung‘. Unterschieden wird zwischen der Vollnarkose und der Lokalanästhesie, wobei letztere mehrere Unterformen kennt. Da es die Aufgabe des Arztes ist, das geringste Risiko und den größten Nutzen für den Patienten zu gewährleisten, entscheidet der Anästhesist über die Art der Betäubung.
Vollnarkose: Tieschlaf während Operationen
Bei der Vollnarkose, auch Allgemeinanästhesie genannt, wird der Patient in einen tiefschlafähnlichen Zustand versetzt. Das Bewusstsein und das Schmerzempfinden werden ausgeschaltet. So können lange und komplexe Operationen, die sonst nicht möglich gewesen wären, durchgeführt werden. Die komplette Anästhesie wird zudem dann angewendet, wenn die Unruhe des Patienten den chirurgischen Eingriff gefährden würde oder wenn für die Operation die Erschlaffung der Muskulatur notwendig ist.
Der Anästhesist führt mittels injiziertem Schlaf- und Schmerzmittel, häufig begleitet von Muskelrelaxanzien, die Allgemeinanästhesie herbei. Alternativ, meist bei kleinen Kindern, wird die Betäubung durch Narkosegas eingeleitet. Da der Patient bei dieser Anästhesie nicht nur sein Bewusstsein, sondern auch seine Muskelkraft und den Atemantrieb verliert, ist während der gesamten Narkose eine Beatmung notwendig. Diese kann gänzlich manuell passieren oder nur unterstützend, etwa durch eine Kehlkopfmaske oder einen Beatmungsschlauch. Nach dem Eingriff wird die Zufuhr der Medikamente gestoppt, woraufhin der Patient nach einer Weile wieder aufwacht.
Lokalanästhesie: Partielle Betäubung
Anders als bei der Vollnarkose wird bei der Lokalanästhesie nur ein Teil des Körpers unter Betäubung gesetzt. Das heißt, der Patient ist bei Bewusstsein, verspürt aber keinen Schmerz. Diese Art der Anästhesie ist weniger belastend und birgt geringere Risiken. Die Lokalanästhesie kann auf verschiedene Arten wirken. Bei der Oberflächenanästhesie etwa wird das betäubende Arzneimittel auf die Haut oder die Schleimhaut aufgetragen. Die Infiltrationsanästhesie wirkt durch ein Einspritzen des Betäubingsmittels in das Gewebe oder die Haut. Bei der Regionalanästhesie, auch Leitungsanästhesie genannt, werden ganze Nerven blockiert.
Regionalanästhesie: Anästhesie des Rückenmarks
Diese Sonderform der Lokalanästhesie kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. So können die Nerven direkt beim Austritt aus dem Rückenmark (rückenmarksnahe Blockade) blockiert werden oder erst in ihrem Verlauf (periphere Nervenblockade). Die peripheren Nerven können einzeln oder in der Gruppe (etwa der ganze Arm oder das ganze Bein) anästhesiert werden.
Die rückenmarksnahen Regionalanästhesien werden nochmals in Spinalanästhesie und Periduralanästhesie unterteilt. Bei Ersterer wird das Betäubungsmittel direkt in das Nervenwasser gespritzt, bei Letzterer werden über einen Plastikkatheter außerhalb der Rückenmarkshülle Schmerz- und Betäubungsmittel verabreicht.
Risiken, die eine Anästhesie mit sich bringt
Die möglichen Komplikationen hängen vom Anästhesieverfahren ab. Bei der Vollnarkose sind Nebenwirkungen wie Heiserkeit, Halsschmerzen oder sogar Stimmbandschäden durch die Platzierung des Beatmungsschlauches möglich. Häufige Folgen dieser Anästhesie sind Übelkeit und Erbrechen, seltener kommt es durch die Einatmung des Mageninhalts zu einer Lungenentzündung. Je ausgeprägter das Grundleiden, desto höher ist das Risiko schwerer Herz-Kreislauf- oder Beatmungsprobleme im Zuge der Vollnarkose.
Bei der Lokalanästhesie können allergische Reaktionen auftreten, bei der Regionalanästhesie kommen vor allem Verletzungen der Gefäße oder der Nerven vor. Bei der rückenmarksnahen Regionalanästhesie kann zudem das Rückenmark geschädigt werden.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel kann einen Besuch beim Arzt nicht ersetzen. Er enthält nur allgemeine Hinweise und darf daher keinesfalls zu einer Selbstdiagnose oder Selbstbehandlung herangezogen werden.