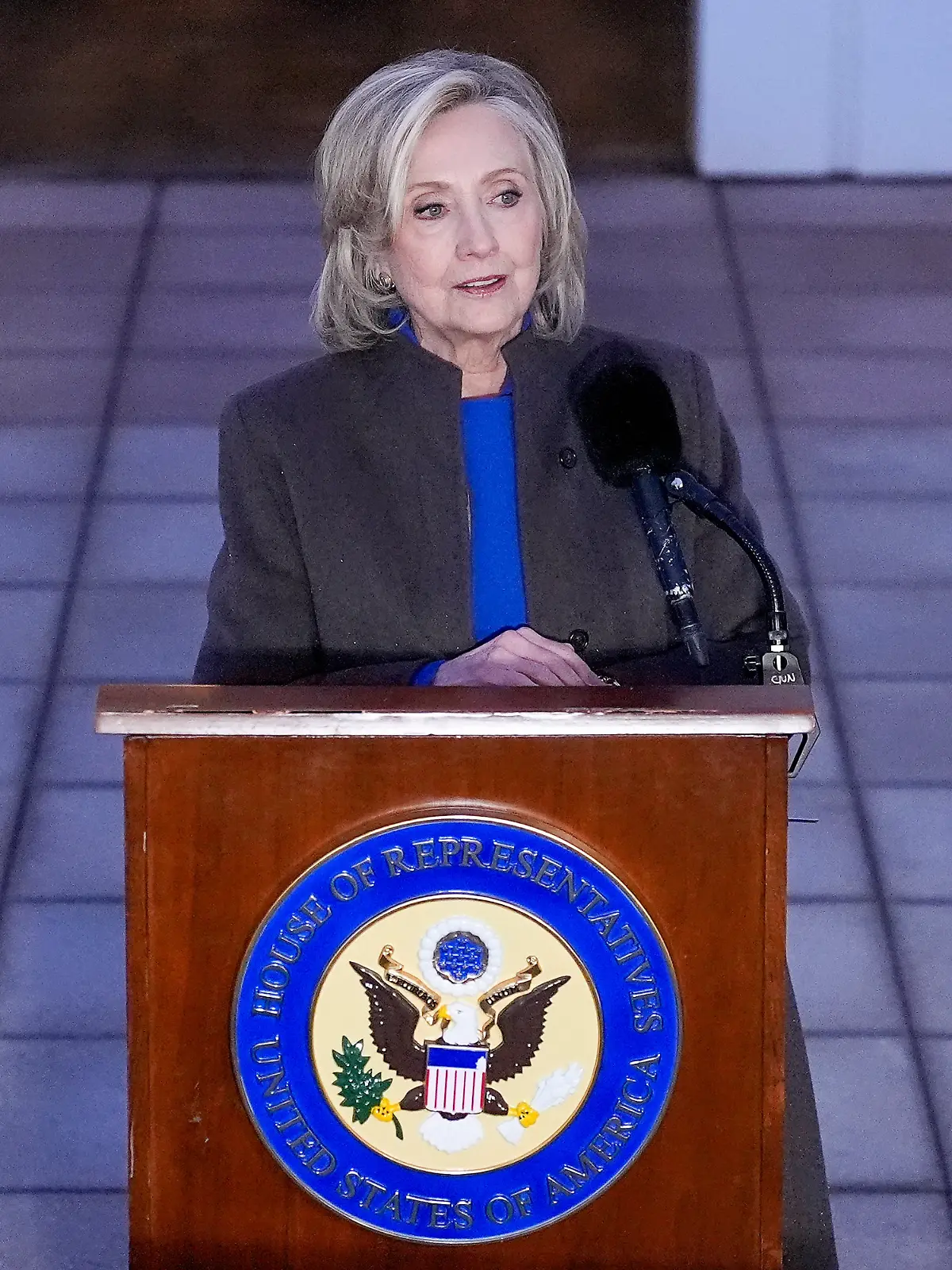Was dafür spricht, was dagegen! Ein Pro-Contra-Kommentar: Braucht Deutschland Schuluniformen?
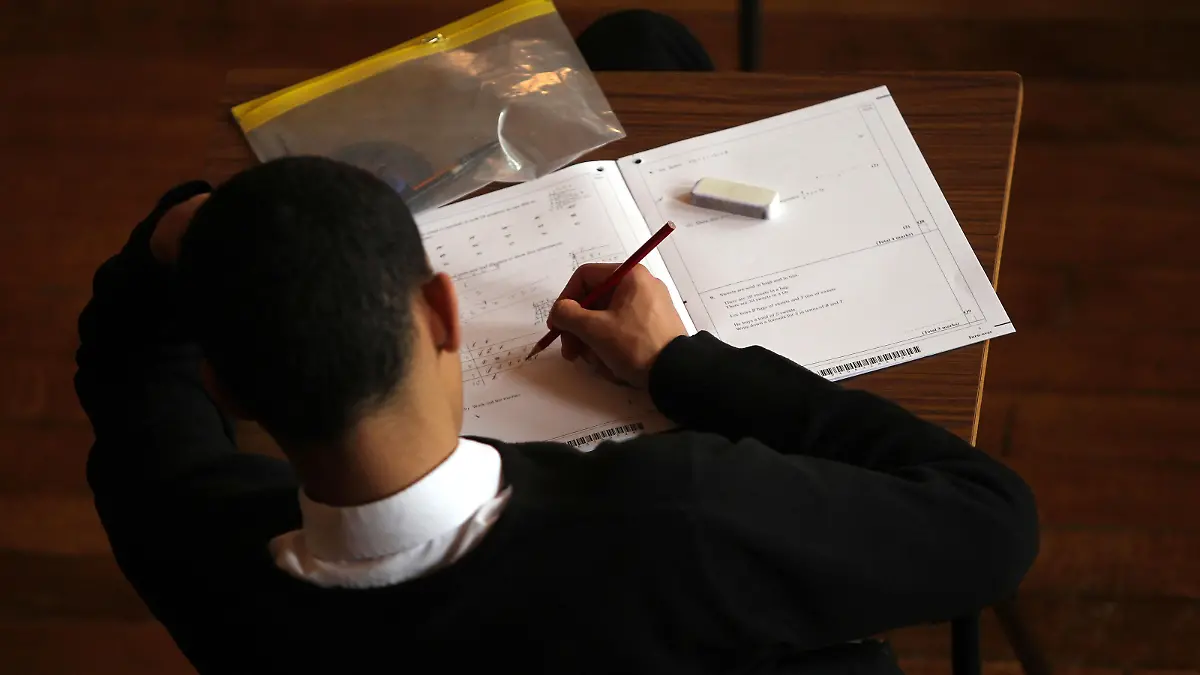
Schuluniformen: Pro oder Contra?
In Frankreich ist die Diskussion wieder voll im Gange und auch hier wird immer wieder diskutiert: Brauchen wir nicht vielleicht eine Schuluniform-Pflicht? Die Meinungen gehen da weit auseinander, auch im RTL-Team. Ein Pro-Contra-Kommentar!
Schuluniformen: ja, bitte!
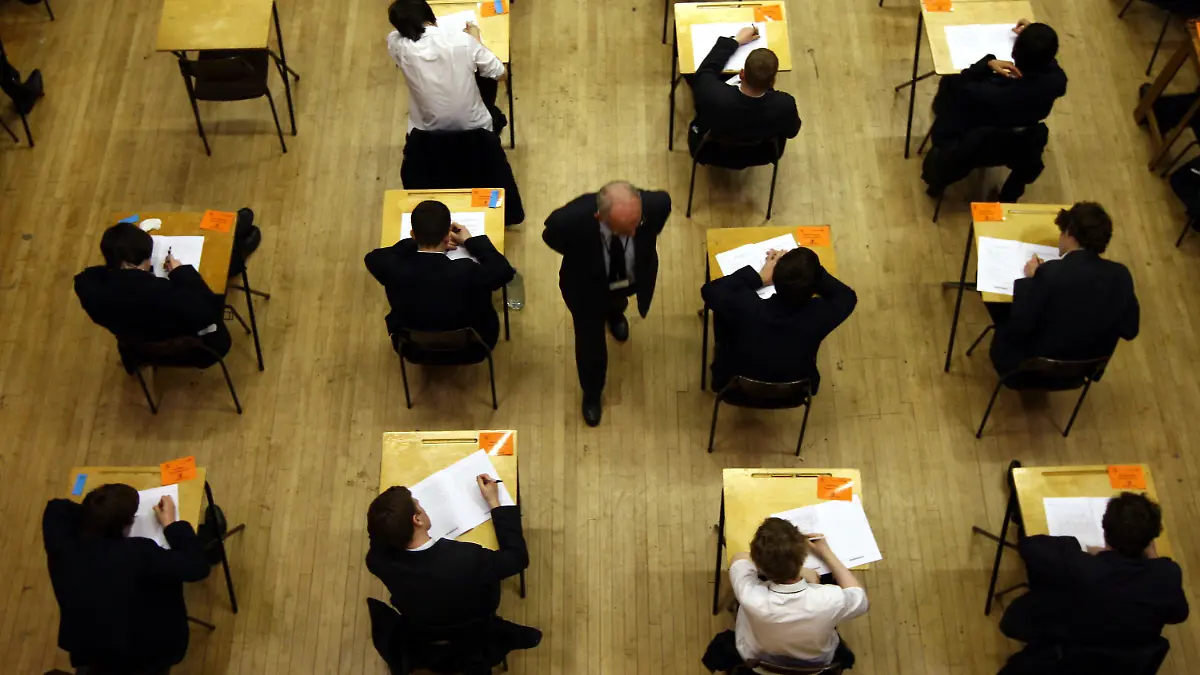
von Nina Lammers
Ich denke gerne an meine Schulzeit in den 90ern zurück. Jede Pause hochinteressant: Wie war die Party am Wochenende? Wie ging das Rumhängen (heute: Chillen) im Park gestern nach der Schule noch weiter? Wer hat mit wem geknutscht? Oder sogar rumgemacht? Wie liefen die ersten Versuche mit Alkohol und Cannabis? Welche Party ist am nächsten Wochenende? Ist man eingeladen? Wer eingeladen wurde, gehörte zu den Coolen und die Coolen konnte man schon weitem erkennen: Untenrum an der Levis 501, ganz unten an den Chucks oder Doc Martens. Obenrum war mehr möglich: da durfte es Esprit, Benetton, Chiemsee oder Oilily sein.
Cool sein war teuer: Die Levis 501 kostete 150 D-Mark, Doc Martens 120, einen Esprit-Pulli der neuen Kollektion konnte man mit etwas Glück schon für etwa 80 D-Mark bekommen – Benetton lag meist darüber, für Chiemsee und Oiliy-Oberteile konnten mehr als 150 D-Mark fällig werden. In der günstigen Esprit-Variante gehörte man also mit 350 D-Mark zu den Coolen. Den Marken-Rucksack und das Portemonnaie - vorzugsweise der Marke Eastpack - noch nicht eingerechnet Und damit war man für gerade mal einen Tag in der Woche eingekleidet. Schule war aber an fünf Tagen in der Woche – wenn samstags Unterricht war, auch an sechs.
Ich brauchte als Schülerin also viel Geld, um was zu gelten und das wollte ich auf jeden Fall: Coolness ist schließlich die Währung der Jugend – auch wenn es heute wahrscheinlich ein anderes Wort für „cool“ gibt. Wie bei meinen Mitschülerinnen und Mitschülern kam das Geld für Klamotten von den Eltern. Allerdings hatten meine Eltern im Gegensatz zu den Eltern vieler anderer aus meiner Klasse für meinen Markenwahn weder Verständnis noch das nötige Geld. Jeans und Oberteile gab´s schließlich auch woanders und günstiger, aber damit konnte ich mich auf keinen Fall auf dem Schulhof blicken lassen.
Lese-Tipp: England: Schüler trägt jetzt Röcke - weil Schuluniform keine Shorts erlaubt
Ich ging also mit meinen Eltern in Verhandlungen: ließ mir das Geld auszahlen, das sie für meine Kleidung kalkuliert hatten, suchte mir mehrere Jobs – als Babysitterin und in den Ferien auf einem Bauernhof, wo ich Eier der Größe nach in Kartons einsortierte, machte einen Bogen um C&A und ging bei Benetton und Esprit ein und aus – allerdings oft mit halbleeren Tüten: Viel Klamotte bekam ich für das Geld, das ich hatte, nicht: Ich erinnere mich, dass ich in einen Winter immer zwischen zwei Pullis wechselte (Benetton und Esprit) weil mehr Marke in meinem Budget nicht drin war.
Kurz: Mit den richtigen Klamotten in der Schule aufzukreuzen, bedeutete für mich Stress – und der ließ übrigens auch nicht nach, als der Marken-Wahn dem Vintage-Look wich: Auch die dann obligatorische Lederjacke und die Schlagjeans mit der perfekten Waschung auf dem Flohmarkt waren kein Schnäppchen. Und ich war bei Weitem nicht die einzige, die am meisten gestresst war: Ein Mädchen aus meiner Klasse trug die Kleidung anderer auf: Ich erinnere mich an ihre rosa Cordhosen, an den Knien stark ausgebeult, und Oversize-T-Shirts mit verwaschenem Mickey-Mouse Aufdruck. Sie schrieb in ein Freunde-Buch unter „ich mag“: Gute Klamotten. Und ergänzte: „kann sie mir aber leider nicht leisten“. Zu den Coolen gehörte sie natürlich nicht. Vielleicht hätte sie eine Chance gehabt, dazu zu gehören, wenn es einheitliche Schulkleidung gegeben hätte. Man hätte ihr die Verhältnisse, aus denen sie kam, jedenfalls nicht auf den ersten Blick angemerkt.
Klar, man kann soziale Ausgrenzung auch mit Schuluniformen nicht überwinden. Man trifft sich auch außerhalb der Schule, spätestens zur Party am Wochenende. Aber vielleicht steigen die Chancen, dass auch die eingeladen werden, die sonst wegen ihrer uncoolen Klamotten keine Chance auf eine Einladung bekommen. Und einmal eingehüllt ins schummrige Licht des Partykellers, sind die ausgebeulten rosa Cordhosen und Billig-Oberteile vielleicht nicht mehr so wichtig, wie Gerüche und Berührungen und was man sonst so entdeckt, wenn einen die Pubertät vom rationalen Denken abhält.
Und wer jetzt argumentiert, die Individualität und Subkultur gingen mit Schuluniformen verloren, der ist wirklich in den Wirren der Pubertät hängen geblieben und argumentiert genauso wie die, die damals auf dem Schulhof nach Klamotten kategorisierten: Das Outfit ist doch nicht das Aushängeschild für Individualität und Subkultur! Das Aushängeschild für Individualität und Subkultur sind Charaktereigenschaften und Weltbilder. Das weiß eigentlich jeder, der die Pubertät einigermaßen unbeschadet überlebt hat.
Lese-Tipp:Gegen „lottrige“ Kleidung: Gibt es bald Klamottenregeln für unsere Schüler?
Weg mit der Scheindebatte rund um die Schuluniform

von Silas Merkelbach
Alle paar Jahre kommt sie auf – die Diskussion um Schuluniformen an öffentlichen Schulen. Dabei kann die Debatte auch diesmal bedenkenlos beerdigt werden und auf dem Friedhof der Scheindebatten direkt neben dem vegetarischen Essen in Schulmensen und der Genderdiskussion im Deutschunterricht ihren Platz finden. Die Idee – hat sie eigentlich einen guten Hintergedanken – ist nämlich der erneute Versuch, uns zu täuschen.
Allzu oft hört man in der – ständig wiederkehrenden - Debatte um Schuluniformen davon, dass Kinder gemobbt würden, weil sie keine Markenklamotten tragen, oder das Schüler zu freizügig zur Schule kämen. Die Argumente sind gleichsam richtig, dennoch nicht wirksam.
Denn: Ja, sicherlich gibt es Mobbing aufgrund von Markenklamotten auf Schulhöfen und auch ich stimme zu: Freizügigkeit im Unterricht ist fehl am Platz. Der Schule gebührt Respekt! Aber zumindest letzterem Punkt kann man mit einfachen Kleiderordnungen wie der Verpflichtung vom Tragen langer Oberteile und Hosen entgegenwirken.
Der erste Punkt jedoch trifft den Kern des Problems und macht die Uniform-Pflicht als bloßen Vorwand nichtig: Denn dass Ihre Kinder auf dem Schulhof gemobbt werden, geht zurück auf ein tiefgreifendes gesellschaftliches Problem, in dem Konsum und der Fetisch der Marke zu einem Statussymbol herangereift ist, welches Kinder produziert, die aufgrund von Oberflächlichkeiten ihres Gleichen mobben. Klamotten teilen Menschen dann in die, die es sich leisten können und die, die deren Eltern keine Mittel haben. Der soziale Status hängt also vom Geldbeutel der Eltern ab.
Die Schuluniform löst das Problem aber nicht. Nein, die Schuluniform verschiebt das Problem auf den Moment, in dem die Kinder mit dem Porsche zur Schule gefahren werden, ihre Handys auf dem Schulhof zücken oder wenn über dem Uniform-Sakko die Wachsjacke im Winter getragen wird. Spätestens aber wird das Problem auf den Tag verschoben, an dem sich das Kind reicher Eltern auf einen Praktikumsplatz bewirbt.
Lese-Tipp: 100 Millionäre fordern Vermögensteuer für Superreiche
Wer seine Kinder vor Mobbing schützen will, der benötigt eine gleiche Gesellschaft. Die schafft aber keine Schuluniform. Die wird auch durch die Schule nicht geschaffen – die bekommt es mit ihren Mitteln ja nicht mal hin, die Toiletten sauber zu halten. Nein, Mobbing und soziale Ausgrenzung kommt vom Elternhaus und aus einer Gesellschaft, die ständig „oben“ und „unten“ als Bewertungskategorie verwendet. Und glauben Sie mir: Kinder werden gemobbt – ganz unabhängig von den Markenklamotten. Als nächstes ist das Handy wichtig, der Sneaker und eines Tages vielleicht das, was im Köpfchen steckt. Ungleichheit und Unfairness werden woanders gemacht und in der Schule kaum bekämpft werden können, hier kommt sie lediglich zum Vorschein.
Wer eine Gesellschaft ohne Abwertung und Ausgrenzung fordert, der mag sich an den Schuluniformen aufhalten. Auch ich begrüße Einheitlichkeit! Aber wer mit vollem Ernst und ganzem Herz eine einheitliche, gemeinschaftliche und gleichere Gesellschaft fordert, der muss da ansetzen, wo Werte gemacht und gestrickt werden. Und das ist nicht der Samt der Schuluniformen. Viel eher betrifft es all diejenigen Bereiche, die Ungleichheit, Ausgrenzung und Desintegration befördern – nicht die Gleichschaltung durch täuschende Gleichmachung.
Also vielleicht gehört auch diese Idee auf den Friedhof der unliebsamen und nichtsnutzigen Ideen. Ich schlage stattdessen vor: Gute Bildung für alle! Und weg mit der Pseudopolitik – ran an die Ungleichheit.
Lese-Tipp: Paritätischer Wohlfahrtsverband schlägt Alarm: Neuer Höchststand von Armut
Anzeige:Spannende Dokus und mehr
Sie lieben spannende Dokumentationen und Hintergrund-Reportagen? Dann sind Sie auf RTL+ genau richtig: Sehen Sie die Geschichte von Alexej Nawalny vom Giftanschlag bis zur Verhaftung in „Nawalny“.
Oder: Die Umstände des mysteriösen Tods von Politiker Uwe Barschel werfen auch heute noch Fragen auf. Sehen Sie auf RTL+ die vierteilige Doku-Serie „Barschel – Der rätselhafte Tod eines Spitzenpolitikers“.
Wie läuft es hinter den Kulissen von BILD? Antworten dazu gibt es in der spannenden Doku „Die Bild-Geschichte: Die geheimen Archive von Ex-Chef Kai Diekmann.“ Er hat Politiker kennengelernt, Skandale veröffentlicht und Kampagnen organisiert. Die Doku wirft einen kritischen Blick auf seine BILD-Vergangenheit.