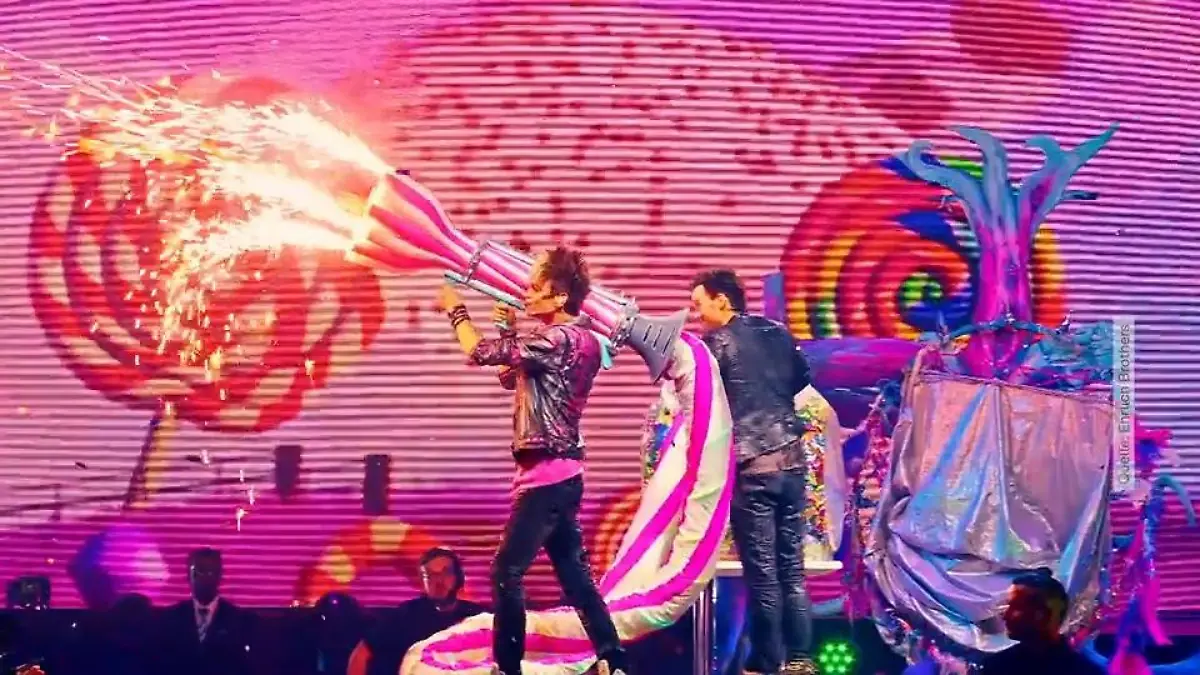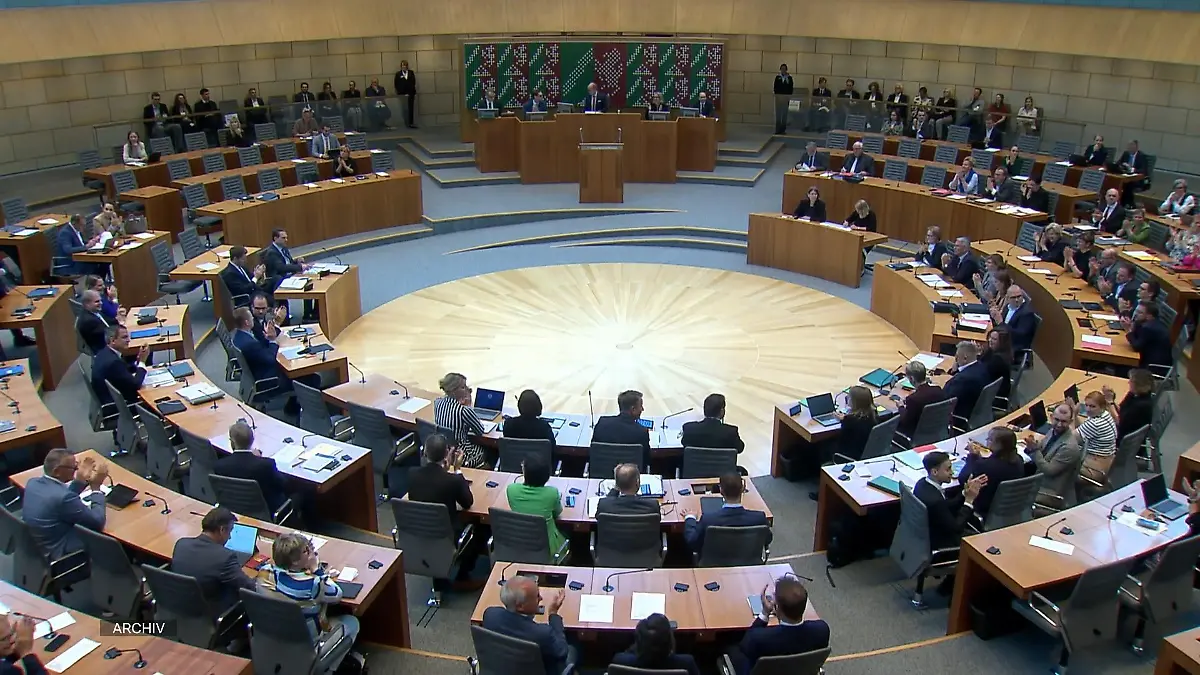Saubere Sache: die stillen Helden der PatientensicherheitKrankenhauskeime - für das menschliche Auge unsichtbar
Krankenhauskeime sind für das menschliche Auge unsichtbar, aber allgegenwärtig. Sie können für Patienten zur ernsten Gefahr werden – besonders, wenn sie gegen Medikamente resistent sind. Jedes Jahr infizieren sich in Deutschland laut Robert Koch-Institut rund 3,5 Prozent aller Klinikpatienten mit solchen Erregern. Doch hinter den Kulissen gibt es Menschen, die täglich alles tun, um dieses Risiko zu minimieren.
Die unsichtbare Gefahr im Klinikalltag
Viele Menschen gehen davon aus, dass Krankenhäuser die sichersten Orte sind, wenn es um Hygiene geht. Doch gerade dort lauern Keime wie MRSA, die auf Haut und Schleimhäuten leben können, ohne zunächst Beschwerden zu verursachen. Gelangen sie aber in den Körper oder in eine Wunde, können sie schwere Infektionen auslösen – und oft helfen dann die gängigen Antibiotika nicht mehr. Besonders betroffen sind Menschen mit geschwächtem Immunsystem oder nach Operationen.
Wenn Hygiene nicht ausreicht: Ein persönliches Schicksal
Wie dramatisch die Folgen einer Infektion sein können, zeigt das Beispiel von Karin Süßmann. Nach einer Routine-Operation ist sie querschnittsgelähmt. 2013 infiziert sie sich zusätzlich mit dem MRSA-Keim. Sie erinnert sich an die Zeit im Krankenhaus: „Schmerzen hast du in dem Moment nicht. Du bist eher überrascht, dass dich das betrifft und wie man dich behandelt. Das heißt, du hast fast schon das Gefühl, dass du Lepra krank wirst, weil du aussortiert wirst. Du wirst weggeschoben. Raus aus dem Zimmer, raus aus der Klinik.“ Wo genau sie sich angesteckt hat, bleibt unklar – doch ihr Fall steht stellvertretend für viele Betroffene. Keime können sich auf viele Wege übertragen: durch direkten Kontakt, etwa über die Hände oder indirekt über gemeinsam genutzte Gegenstände. Auch Tröpfchen beim Husten oder Niesen sowie verunreinigte Lebensmittel und Wasser spielen eine Rolle.
Die stillen Profis hinter der Sicherheit
Damit solche Infektionen möglichst selten bleiben, gibt es eine Berufsgruppe, die oft im Schatten arbeitet: Fachkräfte für Medizinprodukteaufbereitung. Sie reinigen, kontrollieren und sterilisieren sämtliche medizinischen Instrumente – ein Prozess, der mehrere Stunden dauert und höchste Präzision erfordert. In etwa drei Viertel der deutschen Kliniken gibt es eigene Aufbereitungseinheiten, sogenannte AEMPs. Alle Akutkrankenhäuser mit OP-Betrieb müssen eine eigene AEMP betreiben oder sich durch eine externe, zertifizierte AEMP versorgen lassen. Auch größere ambulante OP-Zentren und Kliniken mit invasiven Eingriffen fallen unter diese Pflicht. Nancy Onnebrink, die im Brüder-Krankenhaus Paderborn als Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung arbeitet, sagt: „Wir werden halt nicht so wirklich erkannt, was die Wichtigkeit unseres Berufes darstellt, weil ohne unsere Arbeit würde natürlich der OP keine Operation durchführen können.“ Die Ausbildung für diesen Beruf dauert drei Jahre und wird immer anspruchsvoller: Die Instrumente werden komplexer, die gesetzlichen Vorgaben strenger. Doch am Ende geht es immer um das gleiche Ziel: maximale Patientensicherheit. Trotz aller Sorgfalt lässt sich das Risiko nie ganz ausschließen. Aber die Arbeit dieser Fachkräfte ist ein entscheidender Schutzwall gegen Krankenhauskeime – und gibt Patienten die Sicherheit, die sie brauchen.