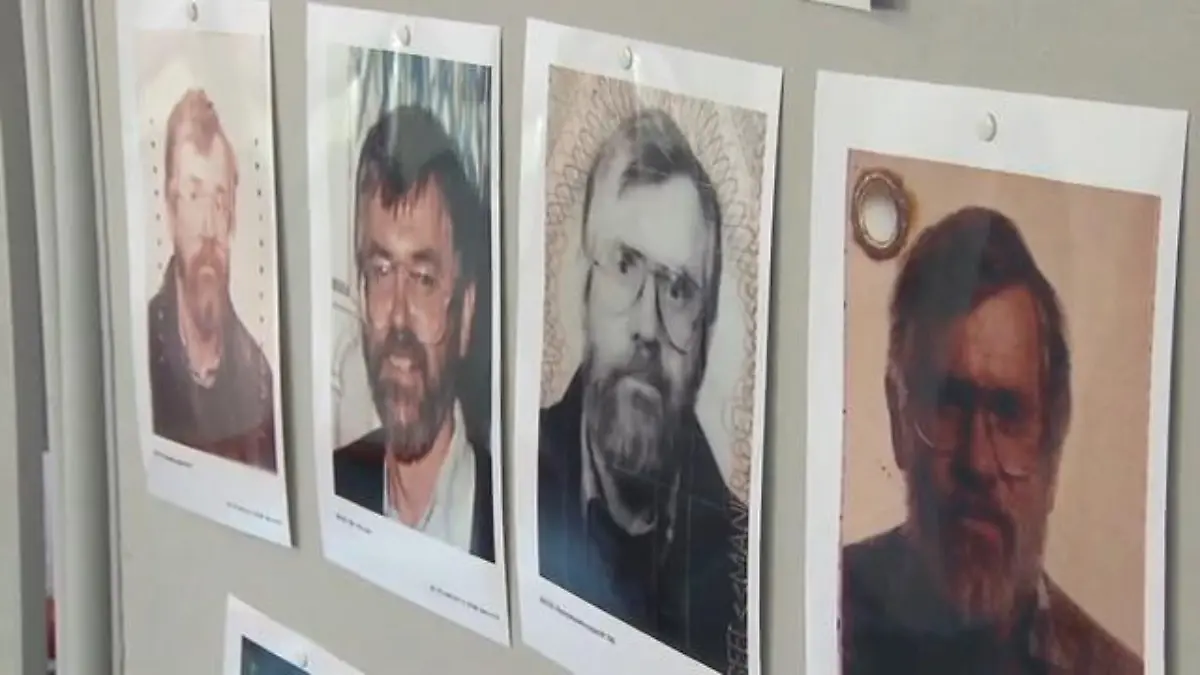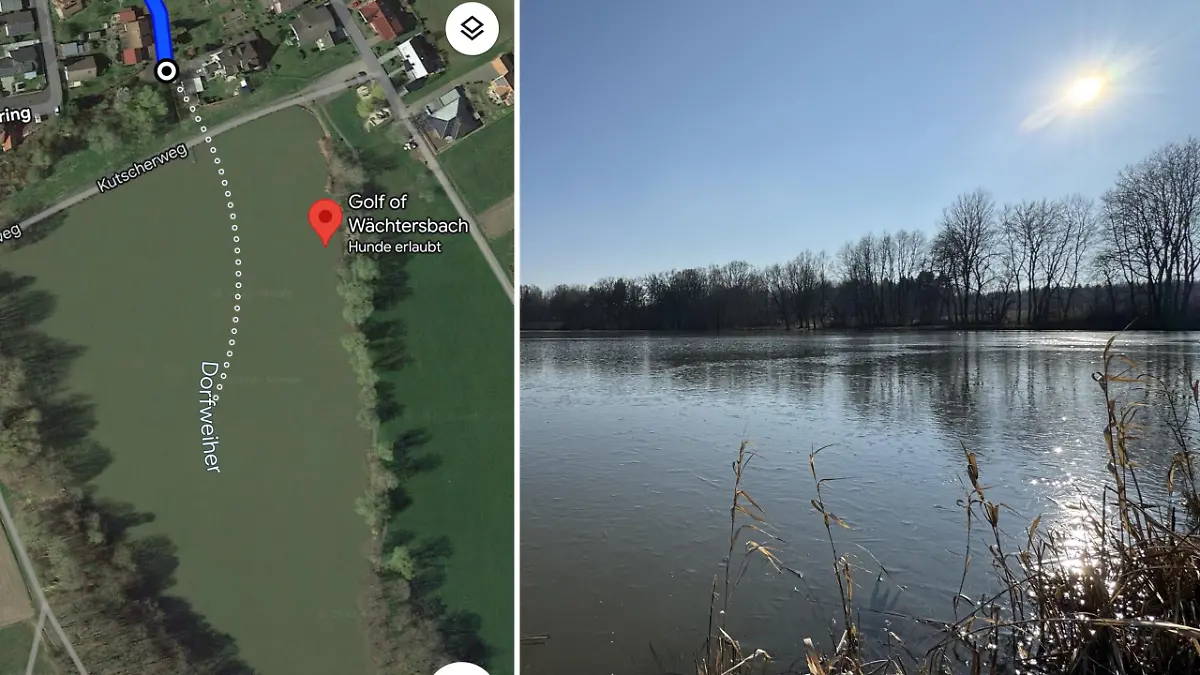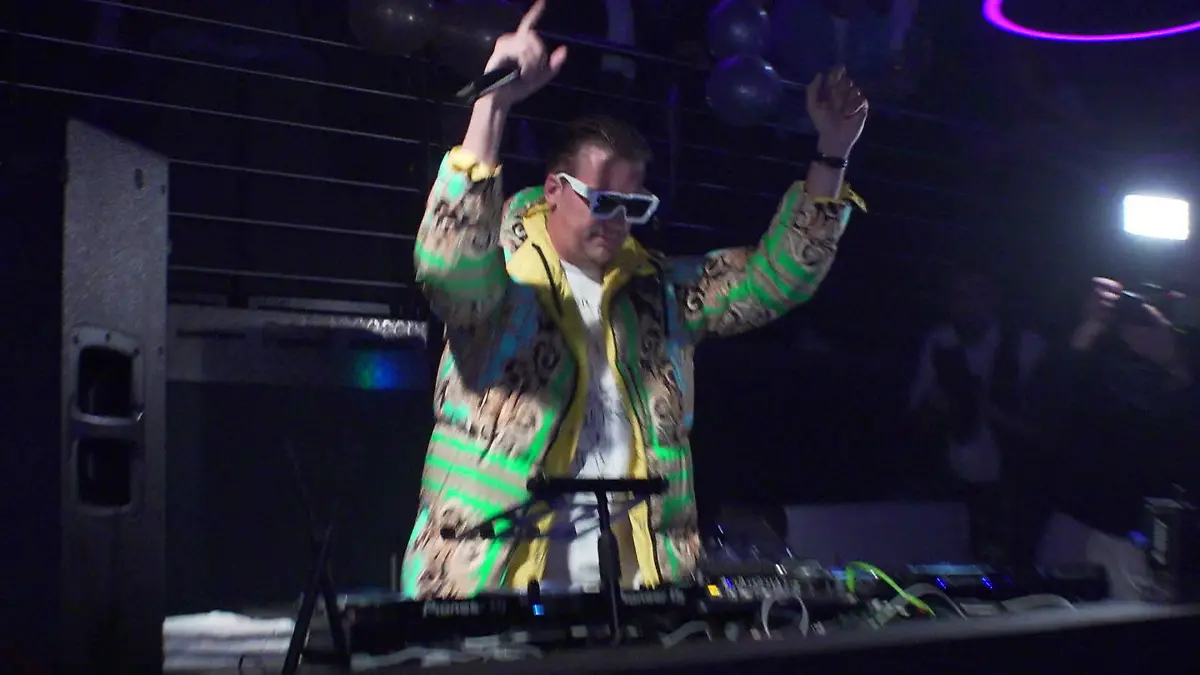Grün statt Grau in der „Essbaren Stadt“Stadt zum Anbeißen: Wie Köln mit Urban Gardening grüner werden will

"Pflücken erlaubt" statt "Betreten verboten"
Im Park einfach einen Apfel oder Himbeeren pflücken und sich gleich in den Mund stecken – kostenlos. Die Ein-Millionen-Metropole Köln hat sich vorgenommen, die grüne Lunge der Stadt zu erweitern. 70 Prozent aller ihrer Neupflanzungen sollen essbar sein. Für ihr Konzept der „Essbaren Stadt“ gab’s im März einen Preis bei der „Edible Cities Conference“ in Barcelona. Aber wie funktioniert das in der Praxis?
Essbares für Mensch und Tier - ob in städtischen Grünanlagen oder auf Mietäckern im Gartenlabor
Samstagvormittag im rechtsrheinischen Köln. Auf den Mietacker-Parzellen zwischen Bundesstraße 55 und der Straßenbahnlinie 1 wird fleißig gegraben, gelockert, gegossen und geerntet. Auch Saatgut wird hier im „Gartenlabor“ getauscht – oder das, was man erntet. „Wir machen aus einer grauen Stadt eine grüne und essbare – für Menschen und auch für Tiere“, erläutert die projektverantwortliche Landschaftsarchitektin Leonie Rademacher von der Stadt Köln die Idee, „also nicht nur Obst und Gemüse, sondern alles, was die Biodiversität steigert.“
Urban Gardening: Die Stadt Köln unterstützt beim Gärtnern - mit Finanzspritzen und Know-How

Auch das „Gartenlabor“ mit seinen Mietäckern gehört zu diesem Projekt. „Wie ein abgespeckter Kleingarten“, erläutert Leonie Rademacher das Angebot. Nur dass man keine Ablöse für eine Laube zahlen muss und sich keinen Vertrag ans Bein bindet, den man vergisst zu kündigen. Das Ziel laut Rademacher: „Dass jeder, der die das möchte, die Möglichkeit bekommt, in der Stadt zu gärtnern.“ Insbesondere Menschen, die daheim keinen Balkon haben. Die Stadt Köln fördert Initiativen mit Geld für Saatgut oder Geräte – und mit Know-How.
Wer zwei graue Daumen hat oder zum ersten Mal gärtnert, kann in Vorträgen direkt auf dem Feld lernen, wie man bienenfreundliche Gärten gestaltet oder wassersparende Beete anlegt. Die ehemalige 1,5-Hektar-Ackerfläche stellt der Bauer nun unterteilt in kleinere Areale von 50 bis 300 Quadratmeter zur Verfügung – Jahresbeitrag ab 40 Euro aufwärts. Das, was man dort erwirtschaftet, gehört einem dann selbst, sofern sich nicht Tiere oder hungrige Menschen auch mal einfach bedienen.
Streuobstwiesen und Nüsse in der Grünanlage: Aufessen erlaubt
Das ist bei anderen Pflanzungen durchaus gewollt und sogar erwünscht. Jörn Hamacher, Koordinator für das Projekt Essbare Stadt beim Kölner Ernährungsrat erläutert die Vision: „Man geht durch die Stadt und am Wegesrand kann ich einen Apfel pflücken und ihn verzehren. Größer gedacht: Der Anbau von Obst und Gemüse zwischen und an den Häusern.“
„Was da anfällt von Obst bis zu Nüssen, ist für jeden frei zugänglich“, sagt Leonie Rademacher. In der Praxis bleibt aber aktuell noch einiges an Streuobst liegen. Jörn Hamacher: „Die Leute wissen oft nicht, kann ich mir die nehmen oder nicht.“ Hier soll eine Kampagne für Aufklärung sorgen.
Kohlrabi & Co im Knast: Selbst im Gefängnis wird gegärtnert
An Menschen in schwierigen Lebenssituationen ist auch anderswo bei der „Essbaren Stadt“ gedacht: In der örtlichen Justizvollzugsanstalt bauen Inhaftierte und Mitarbeiter Hochbeete, Insektenhotels und Vogelhäuschen, in der Arbeitstherapie wird mit Saatgut experimentiert – zunächst für den Eigengebrauch.
Urban Gardening in Köln: Buddeln zwischen Betonbauten - Ein Projekt, das ankommt

Jörn Hamacher erzählt aus dem sozialen Brennpunkt Porz-Finkenberg: „Mitten in der Wohnanlage hat eine Mitstreiterin von uns einen großen Acker mit Gemüsekulturen angelegt. Die Leute, die drumherum wohnen, können mitmachen, müssen aber nicht.“ Freitags wird verteilt, was geerntet wird. Jörn Hamacher: „Da gab es große Vorbehalte.“ Man befürchtete Vandalismus oder „dass sich die Leute einfach alles nehmen. Es hat sich rausgestellt, dass das nicht der Fall ist. Das Projekt funktioniert ganz wunderbar.“ Den Gemeinschaftssinn zu stärken – auch das ist eins der Ziele der Initiatoren.
Globale Erwärmung, schwindende Ressourcen: Was man von den Kölnern lernen kann

Leonie Rademacher ist sicher: „Der Wunsch nach Selbstversorgung ist mehr als eine Modeerscheinung. Die Möglichkeit des urbanen Gärtnerns ist auch ein Ventil. Man hat einen gewissen Einfluss, man kann etwas verbessern.“ Schon in der Corona-Krise haben viele Menschen ihrer Meinung nach gemerkt, „wie fragil das Versorgungssystem werden kann, wenn auf einmal Hefe und Mehl knapp werden.“
Was, wenn es nicht ausreichend Nahrungsmittel gibt, weil bei heißeren Temperaturen und global wachsender Bevölkerung die Ressourcen schwinden? Jörn Hamacher ordnet ein: „Zur jetzigen Zeit können wir nicht eine Stadt wie Köln komplett ernähren, mit dem, was wir hier im Stadtraum anbauen.“ Aber ein Langfrist-Ziel sei, „einen Großteil der Lebensmittelproduktion in die Stadt zurückzuholen.“ Auch wenn also noch Luft nach oben ist: Mit dem Ansatz kann Köln als Modell für andere Städte dienen.