Von asexuell bis transgender: Was heißt das eigentlich?LGBTIQ+: Das große Lexikon

Manchen geht es zu schnell, manchen zu langsam.
Aber fest steht: Unsere Gesellschaft und Sprache befinden sich in einem ständigen Wandel. Das gilt auch für Begriffe, die wir wählen, um uns selbst und andere Menschen zu beschreiben. Egal, ob ihr euer Wissen erweitern wollt, unsicher oder einfach neugierig seid: In diesem „Queer-ABC“ erklären wir einige der wichtigsten Begriffe aus den Bereichen Identität, Geschlecht und Sexualität in Kurzform, damit ihr euch einen Überblick verschaffen könnt.
Hinweis: Viele der erklärten Begriffe werden sowohl innerhalb als auch außerhalb der Communitys diskutiert und unterschiedlich interpretiert. Außerdem kann sich auch bei Wörtern, die schon lange genutzt werden, mit der Zeit eine andere oder zusätzliche Bedeutung ergeben. Diese Liste erhebt deshalb keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Allgemeingültigkeit!
Agender
Als agender („geschlechtslos“ bzw. ungeschlechtlich“) bezeichnen sich Personen, die sich keinem Geschlecht (siehe Gender) zugehörig empfinden und/oder sich keiner Geschlechteridentität zuordnen. Manche wählen als Selbstbezeichnung auch „neutral“.
Allosexuell
Der Begriff „allosexuell“ (griech. allo = „anders, verschieden“) bezeichnet Menschen, die generell sexuelle Anziehung zu anderen Menschen empfinden, bildet also einen Gegenpart zu „asexuell“. Der Begriff entstand in der asexuellen Community und ermöglicht eine Bezeichnung nicht asexueller Menschen, ohne dass diese als „die Norm“ gelten und Asexualität als „Abweichung“ von dieser Norm.
Ally
Ein Ally (englisch = „Verbündete*r) ist im LGBGTIQ+-Kontext eine Person, die sich selbst nicht zur Community zählt, aber deren Anliegen und Bedürfnisse unterstützt sowie sich für ihre Rechte einsetzt. Dabei handelt es sich in der Regel um eine cisgeschlechtliche, heterosexuelle Person. Allys sind bereit, das eigene Denken und Handeln zu hinterfragen, sich beständig zu informieren und aus Fehlern zu lernen, um so LGBTIQ+-Personen bestmöglich zu unterstützen und Diskriminierung zu verhindern – zum Beispiel auch im Gespräch mit anderen nicht-queeren Personen.
Asexuell
Asexuelle Menschen verspüren kaum oder keine sexuelle Anziehung zu anderen und haben in der Regel kein Verlangen nach sexueller Interaktion. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie sich generell keine körperliche Nähe wünschen, nie sexuelle Erlebnisse haben oder sich nicht verlieben können. Es handelt sich nicht um eine bewusste Entscheidung „gegen“ Sex, während prinzipiell ein Verlangen danach besteht, wie es etwa beim Zölibat der Fall ist.
Bisexuell
Bisexuelle Personen (lat. Vorsilbe bi- = „zwei, beide, doppelt“) fühlen sich sexuell und/oder romantisch zu Menschen zweier oder mehrerer Geschlechter hingezogen. So kann sich zum Beispiel eine bisexuelle Frau sowohl zu Männern als auch Frauen hingezogen fühlen. Begrifflich überschneidet sich „Bisexualität“ teilweise mit „Pansexualität“ (siehe unten).
Cisgender/Cismann/Cisfrau
Als Cisgender bzw. cisgeschlechtlich (lat. Vorsilbe cis- = „diesseits“) werden Menschen beschrieben, die sich ihrem biologischen Geschlecht zugehörig fühlen, das ihnen bei ihrer Geburt aufgrund ihrer körperlichen Merkmale zugewiesen wurde. Der Gegenbegriff zu Cisgender ist Transgender bzw. trans*. In der Gesellschaft wird Cisgeschlechtlichkeit nach wie vor in der Regel als die „Norm“ betrachtet.
Coming-out
Bei einem Coming-out (engl.: „herauskommen“) macht eine Person ihre eigene sexuelle und/oder geschlechtliche Identität selbstbestimmt öffentlich. In der Regel durchleben nur LGBTQ+-Menschen diesen Prozess, da es in der Gesellschaft noch immer weitestgehend als die (nicht erklärungsbedürftige) Norm gilt, heterosexuell und cisgender zu sein. Ein Coming-out muss sich nicht zwangsweise an das gesamte Umfeld richten; so kann eine Person etwa dem Freundeskreis und den Eltern erklären, bisexuell zu sein, ihr Arbeitsumfeld aber nicht darüber informieren. Außerdem entscheidet sich ein solches äußeres Coming-out vom inneren, bei dem eine Person sich zunächst über die eigene Identität bewusst wird.
Das selbstbestimmte Coming-out ist nicht zu verwechseln mit dem Begriff„Outing/outen“ – so kann beispielsweise ein schwuler Mann gegen seinen Willen von anderen geoutet werden.
Demisexuell
Eine demisexuelle Person (französisch „demi“= „halb“) lässt sich auf dem Spektrum zwischen allo- und asexuell verorten. Sie kann sexuelle Anziehung zu einem anderen Menschen empfinden, aber nur, wenn sie zuvor eine emotionale Bindung zu diesem aufgebaut hat. Viele demisexuelle Menschen fühlen sich nur selten sexuell zu anderen hingezogen, weshalb sie oft zur asexuellen Community gezählt werden.
FLINTA*
Die Abkürzung FLINTA* steht für Frauen, Lesben, inter*, nichtbinäre, trans* und agender Personen. Sie wird häufig im Bezug auf Räume und Veranstaltungen genutzt, um anzuzeigen, dass Cismänner dort nicht präsent sein sollen. Der Hintergrund hierfür ist, einen geschützten Bereich zum Austausch in einer patriarchalischen, also in vielen Bereichen männerdominierten Gesellschaft, zu schaffen.
Gender
Der englische Begriff „gender“ unterscheidet sich vom englischen „sex“. Im Deutschen werden beide Wörter gleich übersetzt: mit „Geschlecht“. Während „sex“ sich allerdings auf das biologische Geschlecht, also rein körperliche Merkmale wie die Genitalien, stützt, beschreibt „gender“ vielmehr das Geschlecht, das wir fühlen, mit dem wir selbst uns identifizieren bzw. das wir in der Gesellschaft leben, also das soziale und kulturelle Geschlecht.
Genderfluid
Genderfluide Menschen fühlen sich nicht nur einem Geschlecht zugehörig, sondern bewegen sich vielmehr auf einem Spektrum dazwischen. Wie eine genderfluide Person sich fühlt, präsentiert und wahrgenommen werden will, ist individuell verschieden. So kann sich eine genderfluide Person zum Beispiel eine gewisse Zeit lang eher als männlich identifizieren und so auftreten, an anderen Tagen wiederum eher weiblich – oder auch als keines von beidem. Der Begriff „genderfluid“ hat Überschneidungen mit dem Begriff „nonbinär“ bzw. „non-binary“ (siehe unten).
Gendernonkonform/genderqueer
In unserer Gesellschaft bestehen bestimmte allgemeine Vorstellungen davon, was typische Ausprägungen der sozialen Geschlechter Mann und Frau sind (siehe „heteronormativ“). Diese Ideen und Erwartungshaltungen verändern sich im Laufe der Zeit – so galten etwa im 18. Jahrhundert andere Kriterien dafür, was „typisch männlich“ ist, als heute.
Genderkonform beschreibt ein Verhalten oder eine Person, die den aktuellen allgemeinen Vorstellungen weitestgehend entspricht. Gendernonkonform oder genderqueer hingegen beschreibt ein Verhalten oder Aussehen, das von diesen Vorstellungen abweicht. Der Begriff dient zum Beispiel manchen nichtbinären oder trans* Personen als Selbstbeschreibung.
Geschlechtsangleichung
Bei einer geschlechtsangleichenden Operation handelt es sich im weitesten Sinne um einen Eingriff, bei dem körperliche Merkmale so verändert werden, dass sie dem psychosozialen Geschlecht entsprechen, mit dem sich eine trans* Person identifiziert. Dazu gehören etwa die Entfernung der weiblichen Brust beziehungsweise ein Aufbau durch Implantate, die Entfernung von Gebärmutter und Eierstöcken, der Aufbau eines künstlichen Penis (Penoid) oder die Schaffung einer sogenannten Neovagina aus dem Penis.
Geschlechtsangleichende Operationen können auch an intersexuellen Personen (siehe unten) durchgeführt werden. Handelt es sich um ein Kind, sind diese seit 2021 laut Gesetz explizit verboten, wenn sie nicht dem Schutz von Gesundheit und Leben dienen.
Der oft synonym genutzte Begriff „Geschlechtsumwandlung“ wird von den meisten trans* Personen abgelehnt: Er setzt voraus, dass die Person vorher einem anderen Geschlecht angehörte. „Anpassung“ oder „Angleichung“ drückt hingegen aus, dass äußere Merkmale dem erlebten Geschlecht angeglichen werden.
Geschlechtsanpassende Maßnahmen können abgesehen von Operationen auch eine hormonelle Therapie sowie kosmetische Behandlungen (z. B. Laser-Haarentfernung, Filler etc.) sein.
Heterosexuell
Als heterosexuell (altgriechisch heteros = „anders“) gelten in unserer Gesellschaft Männer, die sich emotional und/oder sexuell ausschließlich zu Frauen hingezogen fühlen und Frauen, die sich emotional und sexuell ausschließlich zu Männern hingezogen fühlen.
Heteronormativ
„Heteronormativ“ bedeutet, dass die beiden Geschlechter Mann und Frau sowie Heterosexualität als Normalität und weitere Identitäten (sowohl geschlechtlich als auch sexuell) als davon abweichend betrachtet werden. Dass unsere Gesellschaft in den weitesten Teilen heteronormativ ist, spiegelt sich in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens wider – etwa in der Damen/Herren-Aufteilung von Mode, Toiletten und Umkleidekabinen. Erst seit 2018 ist es z. B. möglich, als rechtlich gültiges Geschlecht neben „männlich“ oder „weiblich“ auch die Option „divers“ eintragen zu lassen.
Der Diskriminierung von z. B. homosexuellen, trans* oder inter* Menschen liegt eine heteronormative Weltanschauung zugrunde.
Homosexuell
Homosexuelle Menschen (altgriechisch homós = „gleich“) fühlen sich emotional und/oder sexuell zu Menschen des eigenen Geschlechts hingezogen. In der Regel werden „schwul“ und „lesbisch“ als Eigenbezeichnungen bevorzugt (siehe unten).
Inter*/intergeschlechtlich
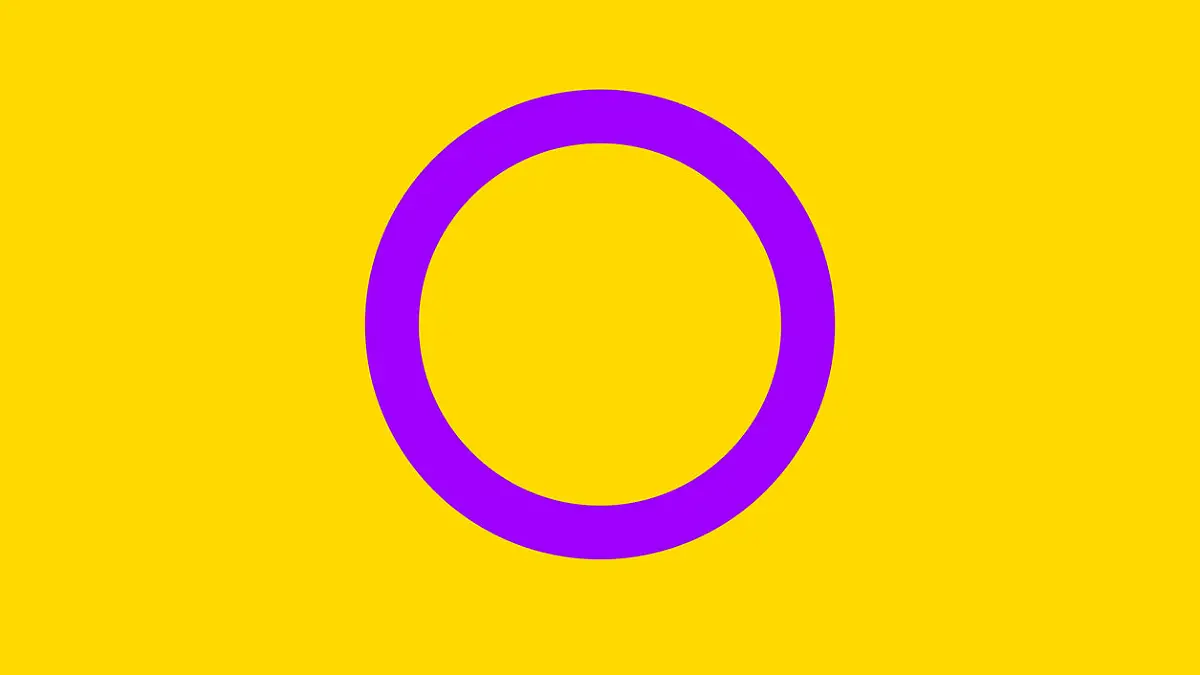
Inter* Personen (lateinisch für „zwischen“) haben körperliche Merkmale, die von der medizinischen Annahme der Zweigeschlechtlichkeit, also „männlich/weiblich“, abweichen. Sie haben also in unterschiedlicher Ausprägung Anteile von beidem. Dies kann zum Beispiel die Geschlechtsorgane, die Körperbehaarung, die Hormone oder den Chromosomensatz betreffen. Das Sternchen hinter inter* soll darstellen, dass der Begriff eine Vielfalt von Geschlechtsidentitäten und Sexualitäten umfasst: Inter* Personen können sich z. B. als männlich, weiblich oder nichtbinär identifizieren und dementsprechend als schwul, hetero, bi etc.
Lesbisch
Lesbische Frauen fühlen sich sexuell und/oder emotional zu Menschen des eigenen Geschlechts hingezogen, also Frauen.
LGBTIQ+

LGBTIQ+ steht als aus dem Englischen übernommene Abkürzung für lesbian (lesbisch), gay (schwul), bisexual (bisexuell), trans*, inter* und queer. Die Abkürzung ist eine Erweiterung von LGBT. Das „+“ stellt dar, dass der Sammelbegriff weitere sexuelle und geschlechtliche Identitäten einschließt, die sich nicht in einem der Anfangsbuchstaben bzw. der Bezeichnung dahinter wiederfinden.
Nichtbinär/non-binary/enby

Unsere Gesellschaft beruht größtenteils auf einer „binären“ Geschlechterordnung (lateinisch binus = „doppelt“, „je zwei“), das heißt, es werden in der Regel nur zwei Geschlechter gesellschaftlich anerkannt: männlich und weiblich. „Nichtbinär“ bzw. englisch „non-binary“ (kurz „enby“) ist demnach eine Sammelbezeichnung für alle Menschen, die sich nicht oder nicht ausschließlich mit einem dieser beiden Geschlechter identifizieren. Viele nichtbinäre Menschen sehen sich selbst als trans* an, andere wiederum nicht. Inwiefern sich das Nichtbinärsein im äußeren Erscheinungsbild der Personen zeigt, ist individuell verschieden.
Die allgemein verbreitete Bedeutung von Begriffen wie hetero- oder homosexuell funktioniert nur, wenn man von einer binären Geschlechterordnung ausgeht (siehe heteronormativ).
Pansexuell
Als „pansexuell“ (griechische Vorsilbe pan = „ganz, alles“) bezeichnen sich Menschen, die sich emotional und/oder sexuell zu anderen Menschen hingezogen fühlen – unabhängig von deren Geschlecht. Eine pansexuelle Person könnte sich also zum Beispiel ebenso in eine trans*, inter* oder nichtbinäre Person verlieben wie in eine Cisfrau oder einen Cismann.
Der Begriff „Pansexualität“ überschneidet sich zum Teil mit „Bisexualität“: Viele verstehen „Bisexualität“ als nicht ausschließlich auf die Geschlechter Mann und Frau bezogen.
Polyamor
Polyamore Menschen können sich gleichzeitig zu mehreren Menschen emotional und/oder sexuell hingezogen fühlen. Eine polyamore Beziehung beschränkt sich demnach nicht auf zwei Beteiligte, sondern kann mehrere Partnerschaften auf einmal umfassen. In der Regel wissen alle involvierten Personen darüber Bescheid und sind damit einverstanden.
Polyamore Beziehungen können unterschiedliche Formen haben: So können zum Beispiel drei Männer zusammen eine Partnerschaft zu dritt führen, oder ein Paar führt eine Partnerschaft und darüber hinaus weitere Beziehungen zu anderen Personen.
Polyamorie ist nicht zu verwechseln mit Polygamie, der Ehe mit mehreren Personen.
Queer
„Queer“ umfasst als Sammelbegriff viele Arten von Geschlecht, Sexualität und/oder Identität. Das englische Wort für „eigenartig, merkwürdig, seltsam“, das ursprünglich meist im negativen Sinn verwendet wurde, hat sich zu einer positiven Selbstbezeichnung entwickelt. „Queer“ kann demnach alles beschreiben, was nicht der allgemeinen Norm entspricht – in unserer Gesellschaft also der Zweigeschlechtlichkeit und der „traditionellen“ Beziehungsform zwischen Mann und Frau (siehe heteronormativ). So können sich – aber müssen nicht – beispielsweise schwule oder asexuelle Personen zur queeren Community zählen ebenso wie trans*, genderfluide oder non-binary Personen.
Questioning
„Questioning“ (englisch = „fragend, infragestellend“) wird als Selbstbezeichnung von Menschen genutzt, die sich bezüglich ihrer Sexualität und/oder Geschlechtsidentität (noch) nicht sicher sind und/oder keine passende Bezeichnung für sich gefunden haben.
Trans*/trans Frau/trans Mann
Als „trans*“ (lateinisch = „jenseits) bezeichnen sich Menschen, die sich nicht oder nicht nur mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt aufgrund ihrer körperlichen Merkmale zugewiesen wurde. Das Sternchen drückt dabei aus, dass es diverse Arten des Trans-Seins gibt; der Begriff bezieht sich demnach nicht nur auf Frauen, die mit männlichen Geschlechtsmerkmalen geboren wurden (trans Frau) bzw. auf Männer, die mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren wurden (trans Mann). So gibt es zum Beispiel auch non-binary oder genderfluide Personen, die sich als trans* bezeichnen.
Manche trans* Personen haben den Wunsch nach geschlechtsangleichenden Maßnahmen - wie z. B. die Entfernung bzw. ein Aufbau der weiblichen Brust oder die Einnahme von Hormonen - beziehungsweise haben diese bereits umgesetzt, andere wiederum nicht. Auch die Art und Anzahl dieser Maßnahmen sowie der Kleidungsstil sind individuell und somit keine Voraussetzung dafür, trans* zu sein.
Transgender/transgeschlechtlich/transident

„Transgender“ wurde aus dem Englischen übernommen. Die Verwendung des Worts gender = „soziales Geschlecht“ drückt aus, dass es hier um mehr Aspekte als das biologische Geschlecht (Genitalien etc.) geht, das erlebte Geschlecht also mit einbezogen wird. Die deutsche Übersetzung „transgeschlechtlich“ kann diese erweiterte Bedeutung nur teilweise wiedergeben.
Mit dem Begriff „transident“ soll verdeutlicht werden, dass es beim trans* Sein in erster Linie um die eigene Identität geht und nicht, wie es bei „transsexuell“ schnell verstanden werden könnte, um die Ausrichtung der eigenen Sexualität.
Wie „trans*“ können „transgender“ bzw. „transident“ als Sammelbegriffe eine Vielzahl von Identitäten beschreiben: Menschen, die sich als weiblich identifizieren, nachdem sie bei der Geburt als männlich eingeordnet worden sind, bzw. Menschen, die bei der Geburt als weiblich eingeordnet worden sind, sich aber als männlich identifizieren. Aber auch Personen, die sich mit beiden Geschlechtern oder keinem identifizieren, können sich als transgender bzw. transident bezeichnen.
Transition
Als Transition wird der Prozess beschrieben, den eine trans* Person durchläuft, um ihr bei der Geburt zugewiesenes und/oder soziales Geschlecht dem erlebten Geschlecht anzugleichen. Dazu können zum Beispiel ein Coming-out, das Tragen von männlich bzw. weiblich wahrgenommener Kleidung, die Einnahme von Hormonen, geschlechtsangleichende kosmetische Maßnahmen und/oder Operationen, die Änderung des Namens und/oder die Änderung des Geschlechts im Geburtsregister zählen.
Jede Transition ist individuell und wird nach unterschiedlichen Kriterien als „vollständig“ empfunden.
Transsexuell
„Transsexuell“ ist ein medizinisch-rechtlicher Begriff. Während manche Personen ihn für die Selbstbeschreibung wählen, lehnen andere ihn ab: Zum einen, weil er zwar so klingt, aber nichts mit der sexuellen Orientierung einer Person zu tun hat, sondern vielmehr mit ihrer Identität; zum anderen, weil Transsexualität im medizinischen Zusammenhang lange als Beschreibung eines krankhaften Zustandes genutzt wurde.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO stufte „Transsexualismus“ bis 2021 als Persönlichkeitsstörung ein. In einer neuen Einordnung wird stattdessen seit 2022 von „gender incongruence“ („geschlechtliche Inkongruenz“) gesprochen, also einer Nichtübereinstimmung mit dem (bei der Geburt zugewiesenen) Geschlecht.
Am 1. November 2024 ersetzte das neue Selbstbestimmungsgesetz das in Deutschland bis dahin gültige Transsexuellengesetz. Die offizielle Änderung von Geschlechtseintrag und Vornamen wurde damit deutlich vereinfacht. Das Transsexuellengesetz stand aufgrund der hohen Kosten sowie der erforderten psychologischen Begutachtung, die viele Betroffene als entwürdigend empfanden, immer wieder in der Kritik.
Quellen
ABqueer e.V. (www.abqueer.de)
Bibliographisches Institut GmbH (www.duden.de)
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (www.regenbogenportal.de)
Bundeszentrale für politische Bildung (www.bpb.de)
Deutsches Institut für Sozialwirtschaft e.V. (www.echte-vielfalt.de)
i-PÄD Berlin Kompetenzstelle intersektionale Pädagogik (www.i-paed.de)
Lesben- und Schwulenverband (LSVD) e.V. (www.lsvd.de)
Projekt 100% MENSCH (www.100mensch.de)
Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg und Bildungsinitiative Queerformat (https://www.genderdiversitylehre.fu-berlin.de)


