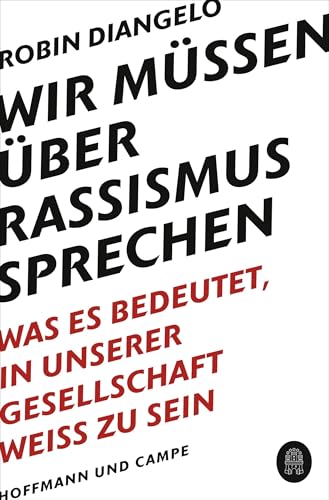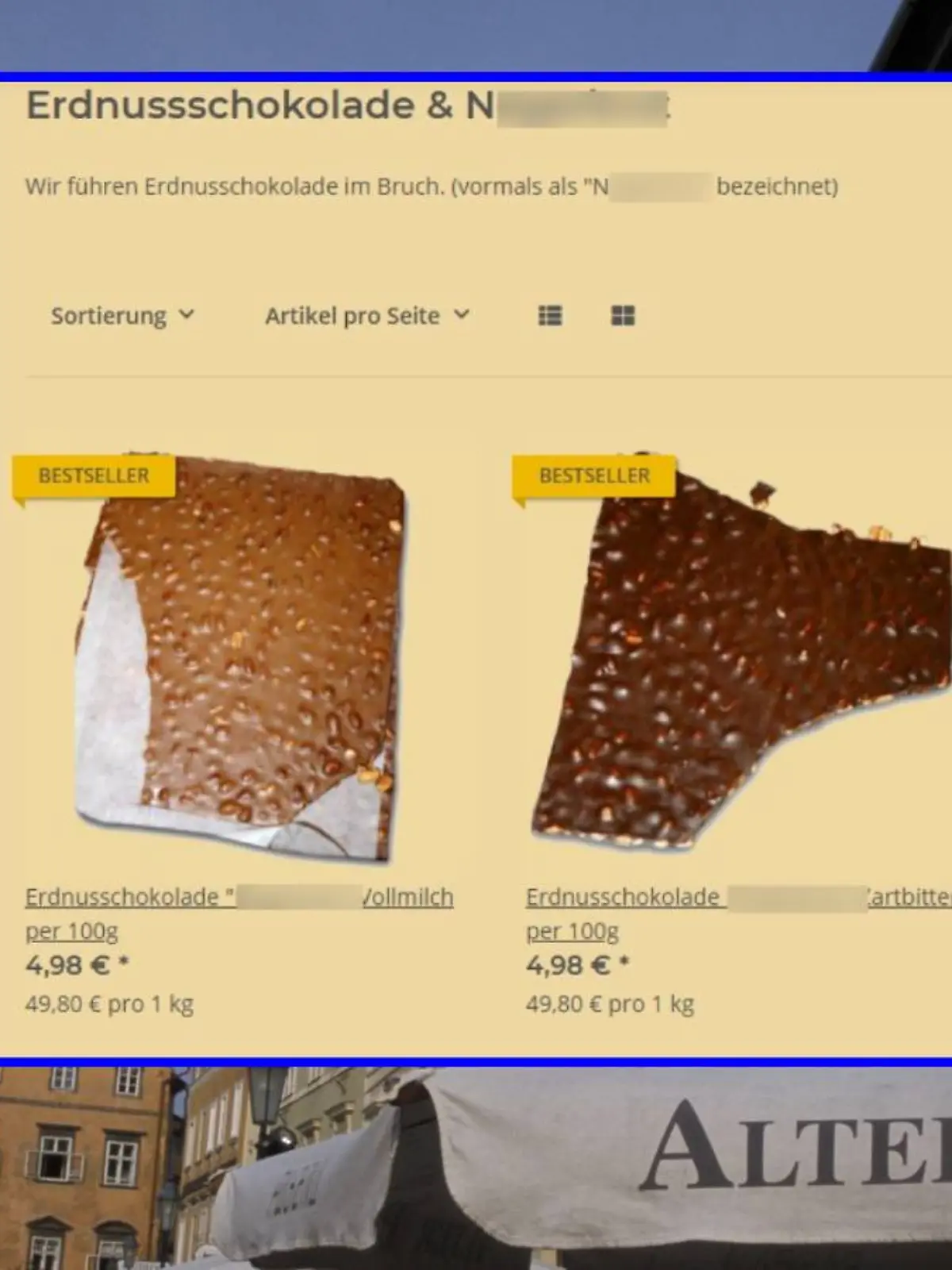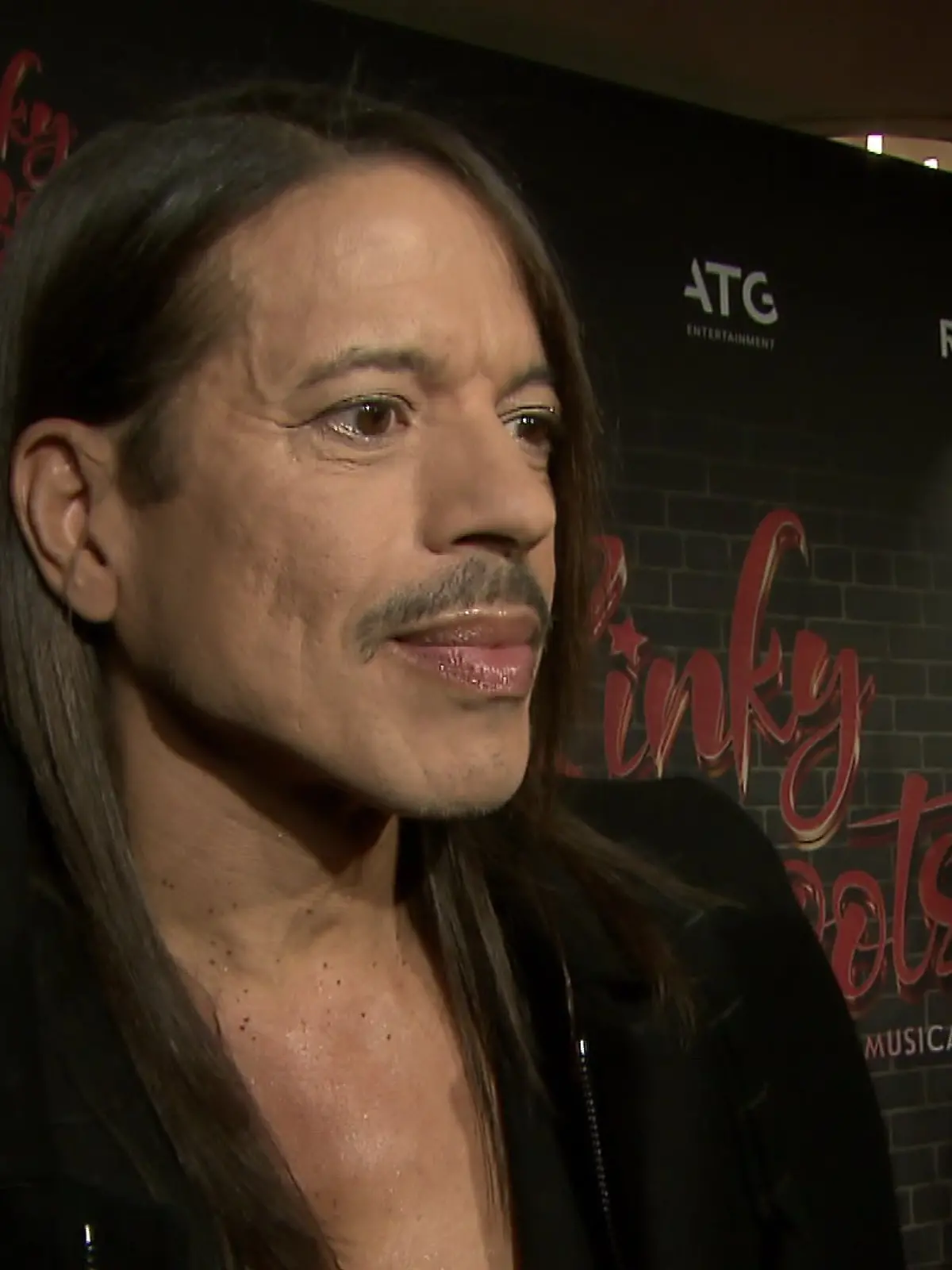Warum Debatten über Rassismus komplex sindRassismus heute: Alltagsrassismus, struktureller Rassismus und „White Fragility“ – was ist das?

Viele Menschen, die nicht tagtäglich rassistischen Ressentiments ausgesetzt sind, sind oft überfordert, wenn Rassismus-Opfer ihre Diskriminierungs-Erfahrungen teilen und öffentlich machen. Oft führt das Aufzeigen und Benennen von erlebtem Rassismus zu einem bestimmten Rechtfertigungsmuster, zu Erklärungsversuchen, man habe es doch gut gemeint, oder gar zu Gegenvorwürfen, man solle sich nicht so sehr anstellen. Viele Menschen sind auch schlichtweg verwirrt über neuere Begriffe und Bezeichnungen, die oft einen akademischen Hintergrund haben. Was ist also gemeint, wenn von strukturellem oder positivem Rassismus, „White Fragility“ oder „Othering“ gesprochen wird?
Alltagsrassismus – für einige unsichtbar, für andere die tägliche Dosis Diskriminierung
Es gibt – leider viel zu viele - sichtbare rassistische Übergriffe und Anfeindungen, von denen wir in den Medien erfahren und die Gott sei Dank von dem Großteil der Gesellschaft abgelehnt werden. Wenn Menschen wie in Hanau ermordet werden, nur weil sie eine Migrationsgeschichte haben, sind wir alle betroffen. Viele bekommen allerdings wenig davon mit, wie People Of Colour in Deutschland im Alltag Diskriminierungen erfahren, die sie immer wieder aus der Gesellschaft ausgrenzen.
Der Klassiker des Alltagsrassismus ist die Frage: „Wo kommst du her?“ Oftmals ist Frage nicht böse gemeint, und drückt sogar Interesse an der anderen Person oder deren angenommenen kulturellen Hintergrund aus. Die Frage impliziert jedoch im Umkehrschluss auch, dass die „Heimat“ der gefragten Person fern von Deutschland liegt. Für Menschen, die seit mehreren Generationen ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben, ist die Frage verletzend, auch weil sie in den meisten Fällen nur aufgrund äußerer Merkmale gestellt wird. Und wenn man die Frage ständig und wiederholt gestellt bekommt, wird der Eindruck immer wieder neu reproduziert, man gehöre „hier“ nicht her, obwohl man in Deutschland geboren wurde. Ähnlich verhält es sich mit eigentlich positiv gemeinten Aussagen wie „dafür sprichst du aber gut deutsch!“.
Alltagsrassismus macht sich leider auch anders bemerkbar. Zum Beispiel, wenn man allein wegen seines Aussehens am Eingang eines Clubs oder eine Disco abgewiesen, in Bus und Bahn abwertend angeschaut oder in vielen anderen Situationen aufgrund seiner Migrationsgeschichte herabgewürdigt wird. Rassistische Vorurteile und Stereotypen, die in Witzen, Büchern, Filmen und Serien immer wieder neu reproduziert werden, verstärken die Rassismus-Erfahrungen der Betroffenen noch zusätzlich.
Institutioneller & struktureller Rassismus – fremd im eigenen Land oder wenn der Nachname zu Benachteiligung führt
Wenn jemand aufgrund seines Namens keinen Termin zur Wohnungsbesichtigung bekommt, allein wegen seines Aussehens von der Polizei kontrolliert wird oder einem der Zugang für bestimmte Bildungseinrichtungen aufgrund der Herkunft der Eltern verwehrt wird, spricht man von strukturellem Rassismus. Diese Erfahrungen sind für viele Betroffen auch Teil des Alltags. Den Unterschied zum Alltagsrassismus herauszustellen, ist allerdings wichtig. Denn die staatlichen Institutionen wie Ämter, Schulen, Polizei oder Gerichte in diesem Land dürfen nicht diskriminieren. Dafür sorgt allein schon die Rechtsprechung in unserem Grundgesetz. Leider ist die Realität für viele People Of Colour in Deutschland oftmals eine andere.
Das „Racial Profiling“ durch die Polizei auf der einen Seite, ein lange Liste nicht aufgeklärter, rechtsterroristischer Morde und Anschläge gegen People Of Colour auf der anderen Seite, verdeutlichen den institutionellen Rassismus und Deutschland und geben Menschen mit Migrationshintergrund das Gefühl, nicht die gleichen Rechte zu haben. Unterschiedliche Rahmenbedingungen innerhalb des deutschen Bildungssystems sorgen dafür, dass People Of Colour erschwerten Zugang zu den freien, gesellschaftlichen Gütern und Ressourcen wie Arbeit und Gesundheit haben. Diese Benachteiligungen sind Teil einer ungleichen, rassistischen Machtstruktur, die leider auch in Deutschland bittere Realität ist, obwohl sie gesellschaftlich und juristisch so nicht vorgesehen ist.
Positiver Rassismus – wenn gut gemeint nicht gut ist
Ein weiterer Begriff, über den man in Diskussionen über Rassismus immer wieder stößt, ist positiver Rassismus, auch umgekehrte Diskriminierung genannt. Beides ist ebenfalls problematisch. Auch wenn viele es sogar gut meinen, werden dadurch leider bestehende und manchmal historisch sehr weit hergeholte Vorurteile und Rassismen bestätigt. Denn dadurch werden bestimmte Personen einer Personengruppe zugeteilt und aufgrund äußerer Merkmale positiver eingeschätzt als andere. Beispiel: Schwarzen Menschen wird oftmals nachgesagt, dass sie gut tanzen können. Von manchen wird es quasi fast schon erwartet. Asiaten können besonders gut Musikinstrumente spielen und sind besonders fleißig - und ja, Deutsche sind immer ordentlich und gründlich und so weiter.
Dadurch werden Menschen letztlich nur in rassistische Kategorien aufgeteilt. Man sollte einfach einmal hinterfragen, wie sich Menschen fühlen, die sich trotz ihrer Herkunft oder ihres Aussehens in diesen Kategorien nicht wiederfinden und wie ausschließend so ein Denken ist.
„White Fragility“ und „White Privilege“: wieso es (oft) ein Privileg ist, weiß zu sein

Die amerikanische Soziologin Dr. Robin DiAngelo führte in ihrem Buch „White Fragility: Why It’s So Hard for White People to Talk about Racism“ (Deutscher Titel: „Wir müssen über Rassismus sprechen: Was es bedeutet, in unserer Gesellschaft weiß zu sein“*) Begriffe wie „White Fragility“, „White Privilege“ und „Racial Stress“ in die Rassismus-Debatte mit ein. In ihrem kontrovers diskutierten Bestseller erklärt sie, wie „White Fragility“ (auf deutsch etwa: Weiße Zerbrechlichkeit oder Empfindlichkeit) Rassismus bestärkt. Doch was ist damit überhaupt gemeint?
Vereinfacht dargestellt: Die Art und Weise, wie Weiße, in der Regel von Rassismus nicht benachteiligte Menschen, über Rassismus sprechen oder gar nicht erst sprechen möchten, nennt DiAngelo „White Fragility“. Diese mache sich im Verhalten bemerkbar. DiAngelo hat verschiedene Muster beobachtet und herausgestellt: In Diskussionen über Rassismus mit People Of Colour würden „Weiße“ oftmals defensiv, entschuldigend, verteidigend, wütend oder gar nicht reagieren oder versuchen diese „Stress“-Situationen zu vermeiden oder ihnen fern zu bleiben. Sicherlich kennt fast jeder solche Reaktionsmuster bei Diskussionen im Freundeskreis oder in Social-Media-Chatforen. Die Rassismus-Erfahrungen Betroffener, um die es ja in erster Linie gehen soll, rücken dabei oft in den Hintergrund. Ein verständnisvoller Umgang über das Thema wird dadurch erschwert oder gar verhindert. Das fehlende Verständnis stärke am Ende die rassistischen Denkmuster, meint DiAngelo.
„White Privilege“ gibt der Tatsache einen Namen, dass weiße Menschen durch ihre Hautfarbe in der Gesellschaft oftmals unverdiente Vorteile innerhalb der Gesellschaft genießen, die sie selbst wiederum kaum oder gar nicht wahrnehmen, schlichtweg weil sie es so gewohnt sind. Das Erkennen dieses Privilegs anhand der Hautfarbe kann also helfen, in Diskussionen über Rassismus die Sicht des benachteiligten Gegenübers anders wahrzunehmen und anzuerkennen.
Kritisch angemerkt wird allerdings auch von Forschern, dass Weiße tatsächlich auch von Diskriminierungen aufgrund ihrer Herkunft betroffen sein können. Die Sichtweise von DiAngelo, die sich vor allem auf die Rassismusproblematik in den USA bezieht, lässt sich nicht immer eins zu eins auf Deutschland übersetzen. So können zum Beispiel auch Weiße Opfer von Fremdenfeindlichkeit werden und soziale Benachteiligungen erfahren: der rumänische Schichtarbeiter in einem deutschen Fleischverarbeitungsbetrieb nimmt sich selbst bestimmt nicht als sonderlich privilegiert wahr.
"Othering": warum man andere Menschen in Schubladen steckt
Andere in eine Schublade packen, das macht es oft einfacher in Auseinandersetzungen mit unterschiedlichen Kulturen und Ethnien. Dabei wird allerdings vergessen, dass die Einordnung nach Ethnien, Nationen, Kulturen oder Rassenkonstruktionen historisch gesehen vielleicht mal notwendig war, aber vor allem dazu diente, Machstrukturen zu schaffen und zu erhalten. Wenn Gruppen nach „wir“ und „sie“ aufgeteilt und wahrgenommen werden, spricht man von „Othering“. Dabei werden die Anderen meist negativ bewertet und somit entwertet. „Sie“ sind unzivilisiert, kriminell, dreckig oder zu faul, „wir“ nehmen uns dagegen als zivilisiert, anständig, sauber und fleißig war. Andersherum funktioniert es dagegen nur selten.
Beim „Othering“ wird Fokus auf die Unterschiede zwischen den Kulturen gelegt. Das Andere wird benannt, um das „wir“ hervorzuheben. Ein „wir“, das darüber hinaus geht, kann so nicht wahrgenommen werden.
Fazit:
Über Rassismus zu diskutieren ist offensichtlich nicht ganz so leicht. Die Begriffe, mit denen man konfrontiert wird, kommen oft aus dem wissenschaftlichen Feld der Soziologie. Und selbst da werden Debatten über Rassismustheorien mitunter hitzig geführt. Sich mit den Begrifflichkeiten auseinanderzusetzen, kann aber helfen zu verstehen, warum sich viele Menschen in Deutschland zu Recht über rassistische Diskriminierungen und strukturelle Benachteiligungen beklagen und ihre Stimmen lauter werden. Als Nicht-Betroffener sollte man zunächst diesen einen Rat befolgen: gut zuhören und die geschilderten Rassismus-Erfahrungen Betroffener ernst nehmen.
*Wir arbeiten in diesem Beitrag mit Affiliate-Links. Wenn Sie über diese Links ein Produkt kaufen, erhalten wir vom Anbieter eine Provision. Für Sie entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo und wann Sie ein Produkt kaufen, bleibt natürlich Ihnen überlassen.