Der Blick in den AbgrundWarum ist True Crime so geil?
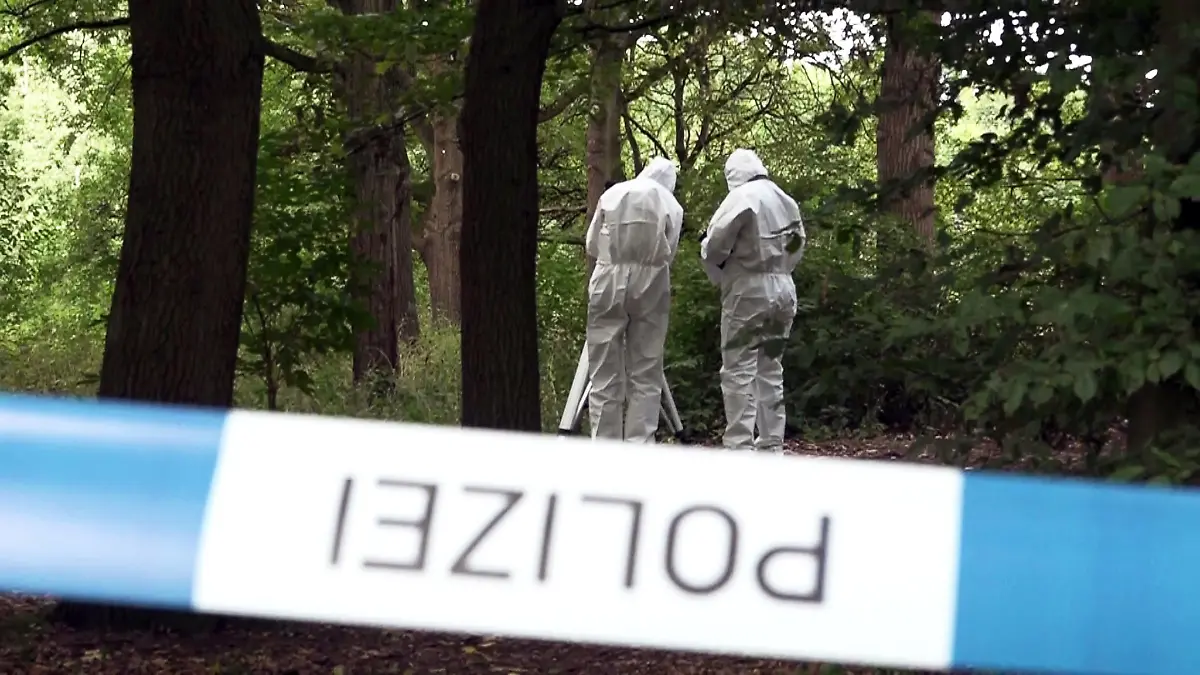
True Crime boomt, egal ob als Podcast, TV-Sendung oder Buch.
Verbrechen sind wahrscheinlich so alt wie die Menschheit. Selbst in der Bibel dauert es nicht lange, bis Blut fließt und Kain seinen Bruder Abel erschlägt. Die Geschichtsbücher sind voll von Mord und Totschlag.
Eigentlich gab es True Crime schon immer
Im ägyptischen Museum in Turin befindet sich eine alte Papyrusrolle, die den Mord an Pharao Ramses III. im Jahr 1155 v. Chr. beschreibt, die Geschichtsschreiber Nikolaos von Damaskus, Sueton und Plutarch berichten detailliert über die Ermordung von Julius Caesar im März des Jahres 44 v. Chr. Im Grunde True Crime in Form früher Geschichtsschreibung.
Verbrechen und Morde, die die Geschichte der Menschheit geprägt haben, fanden schon immer Aufmerksamkeit. Erste Berichte über Verbrechen an und von „gewöhnlichen“, unbekannten Menschen finden sich erstmals im 16. Jahrhundert. Sie ähneln am ehesten dem, was wir heute als „True Crime“ bezeichnen.
Truman Capote definiert ein Genre
Als Begründer des Genres, so wie wir es heute kennen, gilt der US-Schriftsteller Truman Capote mit seinem Roman „Kaltblütig“ (Originaltitel „In cold blood“, vorab 1965, offiziell 1966 erschienen). In diesem Buch beschreibt Capote den 1959 von Perry Edward Smith und Richard Eugene Hickock verübten Mord an der Farmer-Familie Clutter.
Nur wenig später, 1967, etablierte sich in Deutschland die Fernsehsendung „Aktenzeichen XY…ungelöst“, die noch immer im ZDF läuft. In den Jahren um die Jahrtausendwende ebbte das Interesse an True-Crime ab, mit dem Aufkommen des Podcasts erlebte das Genre aber ein ungeahntes Comeback und ist so beliebt wie nie zuvor. Der Podcast ist mittlerweile das beliebteste Format bei den True-Crime-Fans.

True Crime ist besonders bei Frauen beliebt
Doch was macht die Geschichten über tatsächlich geschehene Gräueltaten so beliebt, was macht ihre Faszination aus? Medien- und Rechtswissenschaften sind gleichermaßen an der Frage interessiert, so dass es mittlerweile einige Studien zu dem Thema gibt, dennoch sind manche Aspekte weitgehend unerforscht.
Aber es gibt ein paar Ansätze, zumindest, was die Nutzung von entsprechenden Podcast-Formaten angeht. Das erste Phänomen, das auffällt, ist, dass die Hörerschaft von True-Crime-Podcasts größtenteils weiblich ist. Einige Studien sprechen von 60 bis 80 Prozent, einer Studie zufolge lag der Anteil sogar bei 93 Prozent. Eine so eindeutige Geschlechterverteilung gibt es bei keinem anderen Genre.
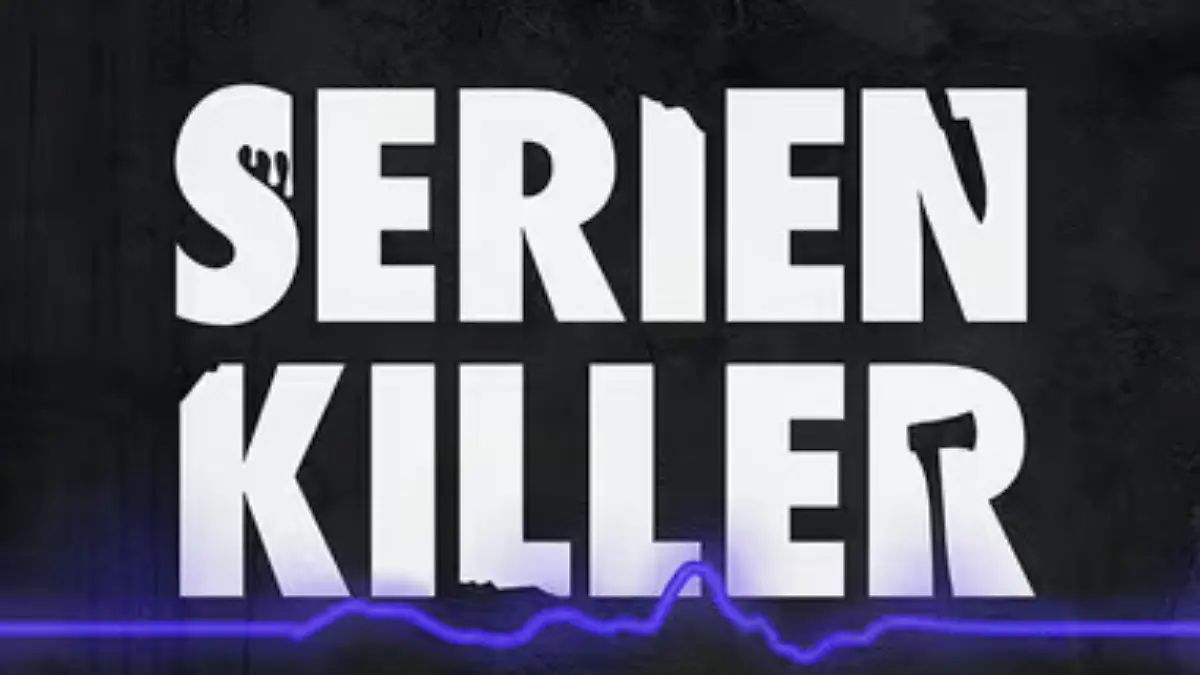
Lese-Tipp: 41 Jahre nach der Tat! Ex-Freund gesteht Tötung von Maria Köhler
Sensibilisiert True Crime für Gefahren?
Über die Gründe dafür gibt es kaum wissenschaftlich belastbare Studien, allerhöchsten kristallisieren sich ein paar Anhaltspunkte heraus: Frauen wird eine höhere Angst vor Verbrechen nachgesagt. Das Genre setzt auf Emotionen und Neugier, was Frauen möglicherweise eher anspricht. Frauen gelten zudem als empathischer, sie sorgen sich mehr um die Gefühle anderer. Zudem werden in den Podcasts in der Mehrzahl Fälle behandelt, bei denen das Opfer weiblich ist. Dass erhöht die persönliche Relevanz und das Identifikationspotenzial. So vermuten einige Psychologen, wie Psychotherapeutin Franca Cerutti, dass True-Crime-Formate helfen, Gefahrensituationen gegenüber sensibler zu sein. Das Nachvollziehen verschiedener Verbrechensszenarien im Kopf stärkt möglicherweise das Selbstvertrauen, da Verteidigungsstrategien mit einbezogen werden. Somit könnte die Auseinandersetzung mit wahren Verbrechen der Angstregulierung helfen. Vielleicht lieben wie True Crime einfach wegen des wohligen Schauers, der uns bei diesen Geschichten überkommt.


