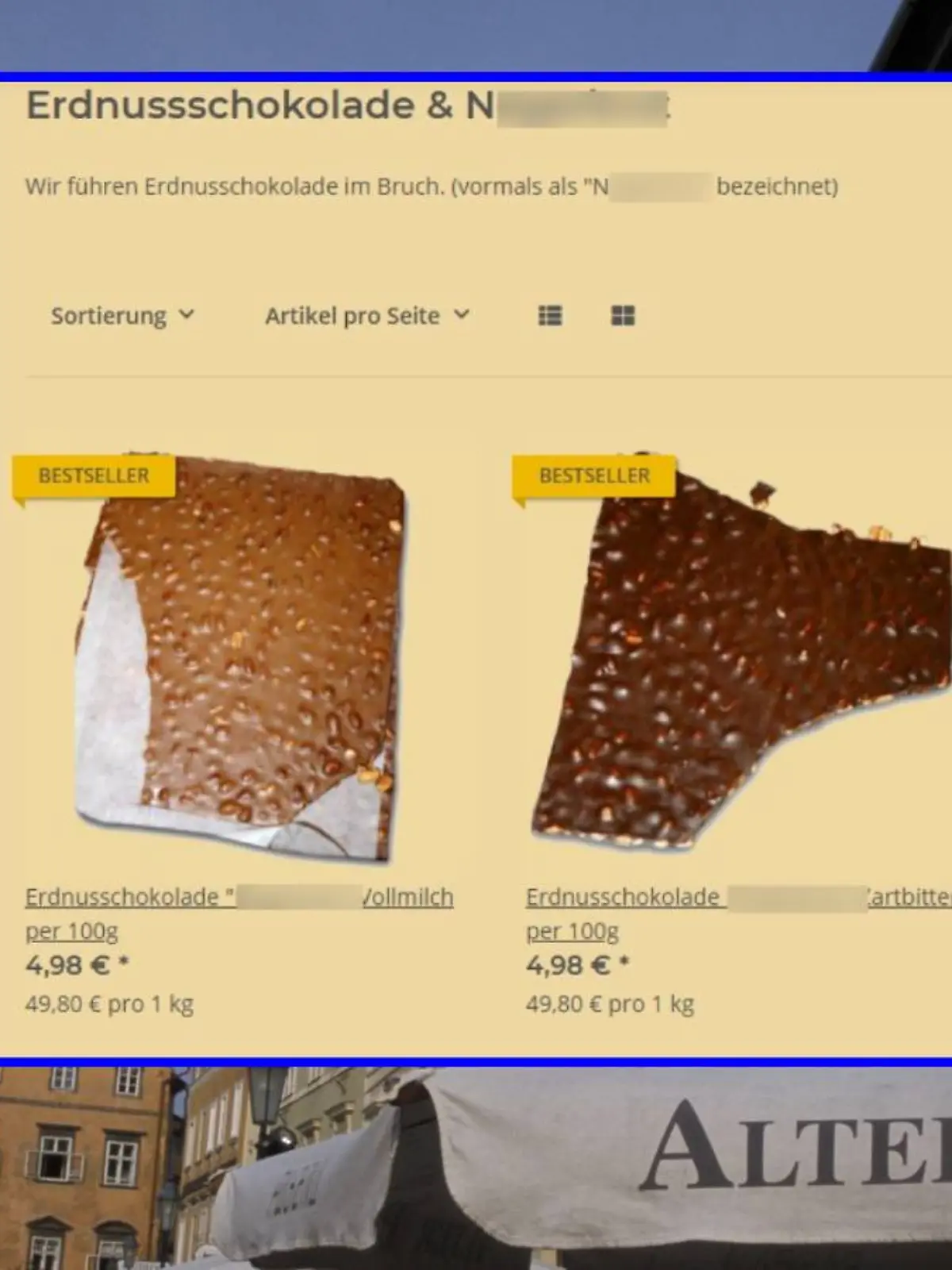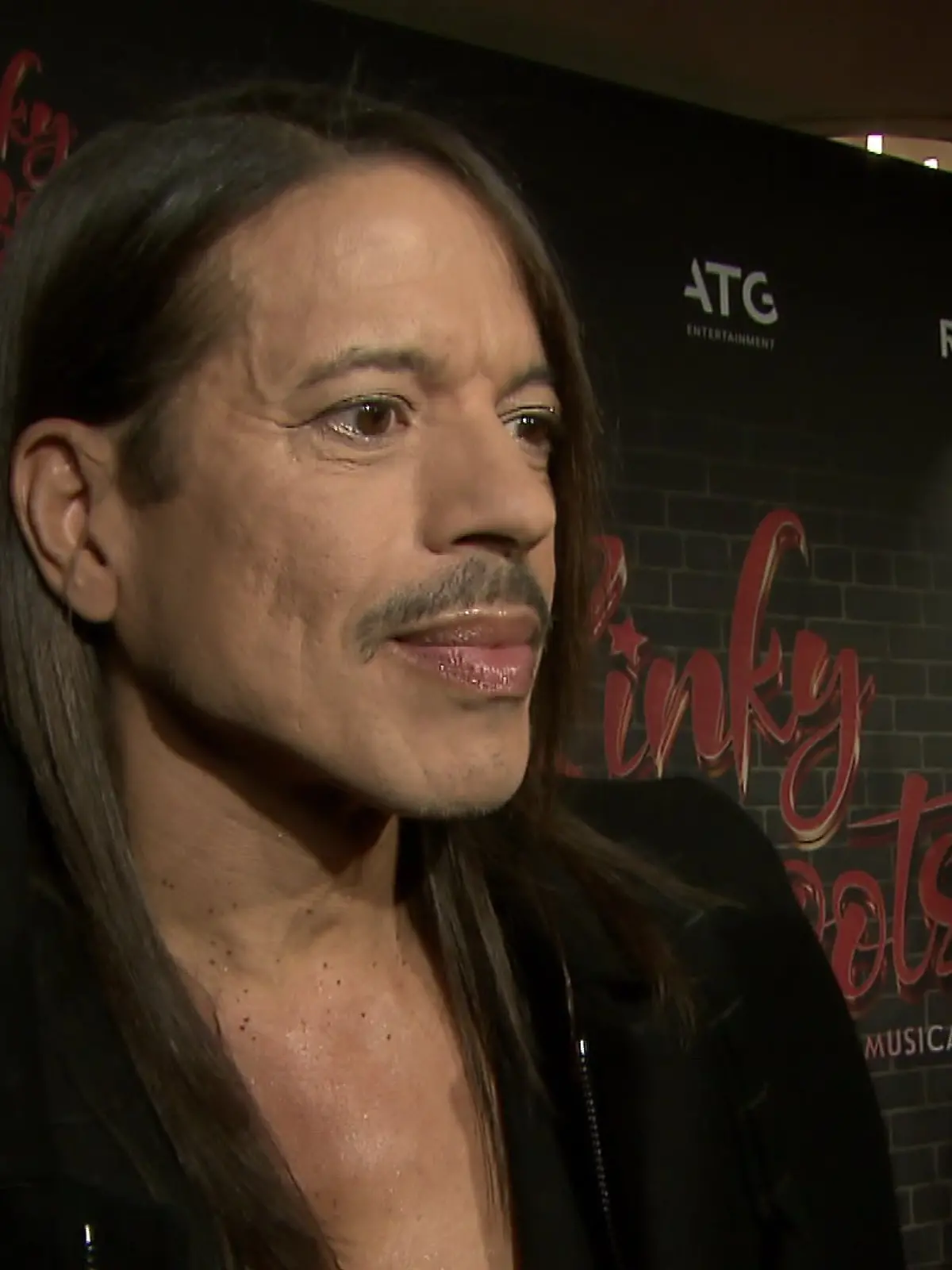Sprache formt DenkenWarum es wichtig ist, sich rassistische Begriffe bewusst zu machen
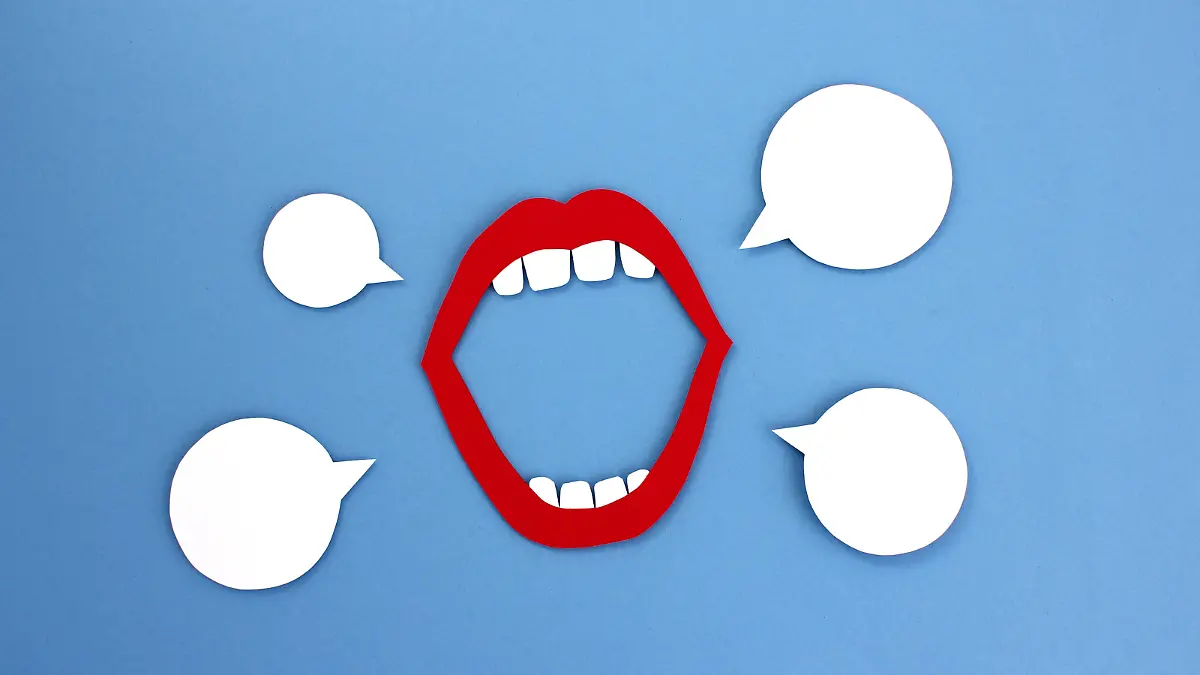
Rassismus geht uns alle etwas an. Er beginnt bereits in den Köpfen und das Denken in diesen Köpfen wird durch die Sprache geformt. Diese ist ein machtvolles Instrument, das unsere Denkweise, Erinnerung sowie gesamte Wahrnehmung prägt und steuert. Daher sollten wir uns über die Auswirkungen eines rassistischen Sprachgebrauchs bewusst werden.
Was ist überhaupt Rassismus?
Um rassistische Wörter zu erkennen, ist es wichtig zu wissen, was Rassismus eigentlich ist. Es handelt sich dabei um eine Ideologie, die das Jahrhunderte alte falsche Denkmuster bedient, nach dem Menschen aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder äußerlicher Merkmale andersaussehenden, meist weißen Menschen angeblich unterlegen sein sollen.
Es geht dabei nicht nur um Hass, sondern Rassismus kann auch in vermeintlich positiven Botschaften verpackt sein, in denen es um das „fremdartige“ Aussehen eines Menschen geht. Das wird auch als „positiver Rassismus“ bezeichnet, der trotz positiver Absichten für Betroffene verletzend sein kann. Jegliche Form der Einteilung von Menschen in biologisch vorbestimmte „Rassen“ ist rassistisch und biologisch falsch.
Rassismus kann nicht nur bewusst, offen und gewaltsam wie zur Zeit des Nazi-Regimes gelebt werden, sondern sich auch im unterschwelligen Alltagsrassimus verstecken. Dieser muss nicht gewollt sein, ist für Betroffene aber dennoch existent, wie die Medienwissenschaftlerin Dr. Maya Götz und ihr Team in einer aktuellen Studie für den Bayrischen Rundfunk herausfanden. Befragt wurden 1.461 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 19 Jahren zu ihren Erfahrungen mit alltäglichem Rassismus. 491 von ihnen hatten eine Zuwanderungsgeschichte. Heraus kam, dass sie mit zunehmendem Alter immer stärker von Alltagsrassismus betroffen waren.
So sind Fragen über ihre „wirkliche“ Herkunft, ob sie schon immer in Deutschland gelebt hätten und das Gefühl, aufgrund ihrer Hautfarbe als „andersartig“ wahrgenommen zu werden, für 6 von 10 der Befragten unangenehme Realität.
Lese-Tipp: Afrodeutsche, Farbige, Schwarze oder PoC – welche Bezeichnungen sind okay?
Warum sind manche Wörter rassistisch?
Manche Begriffe werden verwendet, ohne dass immer bewusst ist, was für einen Ursprung diese eigentlich haben. Daher lohnt es sich, genauer auf seinen Wortschatz zu schauen. Oft beinhaltet dieser Fremdbezeichnungen, mit denen Gruppen durch ihre Unterdrücker benannt wurden. Die Verwendung solcher Begriffe bedient dann koloniale Stereotypen und sorgt viele Jahrhunderte später noch immer für die Diskriminierung von Minderheiten. Viele dieser sprachlichen Überbleibsel aus der Kolonialzeit heben die damalige unterschiedliche Machtposition hervor. Herbeigeführt wurde sie durch Versklavung, Völkermord und Ausbeutung. Somit ist die Benutzung solcher Wörter problematisch, denn sie wurden gezielt als Abwertung erfunden.
Häufig verwendete rassistische Wörter und wie sie ersetzt werden können
Die aufgeführten Beispiele dienen zur Schaffung eines Überblicks und enthalten nur eine kleine Anzahl der existierenden rassistischen Begriffe.
‚Farbige‘, lieber: Schwarze, Schwarze Person, Person of Color (PoC), Afrodeutsche; ‚Farbig‘ stammt ebenfalls aus der Kolonialzeit und wird von PoC oft als abwertend empfunden.
‚Indianer‘, lieber: Erstbewohner Amerikas, First American, BIPOC (Black, Indigenous and Person Of Color) oder direkte Bezeichnung der Gesellschaft; Als Christoph Kolumbus einen neuen Weg nach Indien finden wollte, stieß er stattdessen auf den amerikanischen Kontinent. Die dortigen Bewohnenden bezeichnete er deshalb als ‚Indios‘, deren Land er daraufhin kolonisierte. Somit ist auch dieser Begriff ein Relikt aus der Kolonialzeit und eine Fremdbezeichnung.
‚Mischling‘, lieber: Schwarze Person, Person of Color; ‚Mischling‘ beinhaltet die Denkweise, es gebe genetische Unterschiede zwischen zwei ‚Rassen‘, die miteinander vermischt wurden.
‚Mohr‘, lieber: Schwarze, PoC, Benennung des Herkunftslandes; Ebenfalls eine Fremdbezeichnung aus der Kolonialzeit, in der Unwissen über unterschiedliche Gruppen herrschte und diente als Sammelbegriff.
‚N-Wort‘, lieber: Schwarz, Schwarze Person, Person of Color (PoC); Historisch stammt das Wort aus der weißen Herrschaft über versklavte Menschen. Es diente dazu, Schwarzen Menschen ihre Menschlichkeit abzuerkennen. Dadurch wurde deren Versklavung gerechtfertigt. Das ‚S‘ schreibt sich groß, um zu unterstreichen, dass damit nicht die Farbe, sondern Selbstbezeichnung dieser Gemeinschaft gemeint ist.
‚Rasse, rassig‘, lieber: nicht mehr verwenden. Der Begriff basiert auf der widerlegten Theorie der Einteilung von Menschen in „Rassen“ und sollte daher im alltäglichen Sprachgebrauch in Bezug auf Menschen vermieden werden. Wissenschaftler fordern seit 2019 die Streichung des Begriffs, da es für eine Rasseneinteilung von Menschen keine biologischen Gründe gibt. Genetische Studien haben gezeigt, dass kein einziges Gen einen Unterschied zwischen unterschiedlich aussehenden Gruppen beweist. Äußerliche Unterscheidungsmerkmale entstanden durch die körperliche Anpassung an die unterschiedlichen Wohnorte und die dortigen klimatischen Bedingungen.
‚Woher kommst du?‘ lieber: die Frage auslassen; Es ist zwar personen- und situationsabhängig, beinhaltet aber, dass manche Menschen „deutscher“ aussehen als andere und deshalb eine andere Herkunft angenommen wird. Die Frage beinhaltet die Nicht-Zugehörigkeit eines Menschen in unserer Gesellschaft und stößt sie damit von dieser aus.
‚Z-Wort‘, lieber: Sinto/Sintezza, Sinti, Sintie, Rom/Romni, Roma; Dieser Begriff wird als diskriminierend abgelehnt. Er ist eine pauschalisierende und abschätzige Fremdbezeichnung für eine gesellschaftliche Gruppe, die Unterdrückung und Herabwürdigung erlebt hat.
Sprachgewohnheiten aufzugeben ist für manche Menschen schwierig
Die eigenen Erinnerungen sind etwas Persönliches und Emotionales, das man ungern verändern möchte. Das Aufgeben von als stets positiv wahrgenommenen Traditionen fällt schwer. Zudem müssen sich Menschen eingestehen, jahrelang ein rassistisches Wort benutzt zu haben, obwohl sie sich als anti-rassistisch betrachten.
Es erfordert Selbstreflexion und den Willen, aktiv zu werden. Manche Menschen fühlen sich dadurch schnell belehrt oder sehen den Änderungswunsch als persönlichen Angriff. Niemand möchte sich für Rassismus verantwortlich fühlen. Auch schwingt oft die Weigerung mit, die Macht von Sprache und ihre diskriminierende oder verletzende Wirkung anzuerkennen. Es folgt eine Unsicherheit darüber, wie etwas stattdessen gesagt werden kann.
Konservative Vorstellungen über die Sprache und Schwierigkeiten, sich in die Gefühle der verletzten Person hineinzuversetzen, können ebenfalls Gründe für Unmut sein. Was für einen selbst nicht schlimm ist, könne dieser Denkweise zufolge für einen anderen Menschen auch nicht so schlimm sein.
Darum ist es wichtig, über Rassismus im Sprachgebrauch Bescheid zu wissen
Sprache besitzt die Macht, auf eigene und fremde Gedanken und Emotionen einzuwirken, sie formt unsere Wirklichkeit und kann dabei helfen, Inklusion herbeizuführen. Worte werden häufig unbewusst genutzt, ohne dass deren Anwendung und ihre Auswirkung auf andere sofort klar ist. Worte können verletzen, vernichten, aber auch glücklich machen und stärken. Sie beeinflussen unsere Empfindungen und Emotionen.
Ein Mensch hat auf seine Hautfarbe, Herkunft, und seine Körpergröße keinen Einfluss. Fremdbezeichnungen und sprachliche Unterscheidung können für Ausgrenzung sorgen und Menschen abwerten. Menschengruppen sollten deshalb selbst entscheiden dürfen, wie sie genannt werden und niemand sollte sich das Recht herausnehmen, dies für sie zu bestimmen. Rassismus beginnt nämlich nicht erst mit physischer Gewalt, sondern bereits in den Köpfen und Mündern, wenn Worte leichtfertig verbreitet und weiterverwendet werden, von denen man weiß, dass sie für einige Menschengruppen schädlich und verletzend sind.
Selbst, wenn es nicht böse gemeint ist: Menschen können mit diesem Begriff schlimme Erfahrungen verbinden, an die sie nicht erinnert werden möchten. Jeder Gebrauch rassistischer Wörter bedient rassistische Denkmuster und nur weil etwas „immer so“ gemacht wurde, bedeutet es noch lange nicht, dass es deswegen weitergeführt werden muss.
Lösungswege, mit denen wir rassistische Wörter beseitigen können
Wenn die weiße Mehrheitsgesellschaft sich über Rassismus in Begriffen bewusst wird und diese Denk- und Sprachmuster auflöst, führt das zur Verbesserung unserer Gesellschaft. Hilfreich ist es, bei Unsicherheit über einen Begriff seine Entstehungsgeschichte und historische sowie soziale Kontexte zu beleuchten. Sich über die Macht der Sprache klarwerden, die nicht neutral sein kann. Verallgemeinerungen sollten stets hinterfragt werden. Sobald ein Bewusstsein für rassistische Wörter besteht, sollte auf nicht-rassistische Alternativbezeichnungen zurückgegriffen werden.
Nächstes Mal, wenn man also von der rassistischen Geschichte eines vielgenutzten Begriffs hört, könnte man sich vornehmen, es in Zukunft anders zu sagen. Es ist okay, nicht alles zu wissen. Es ist aber rassistisch, Worte weiter zu verwenden, von denen man weiß, dass sie herabwürdigend, beleidigend und hierarchisierend für andere Menschen sein können. Hier beginnt die Eigenverantwortung.