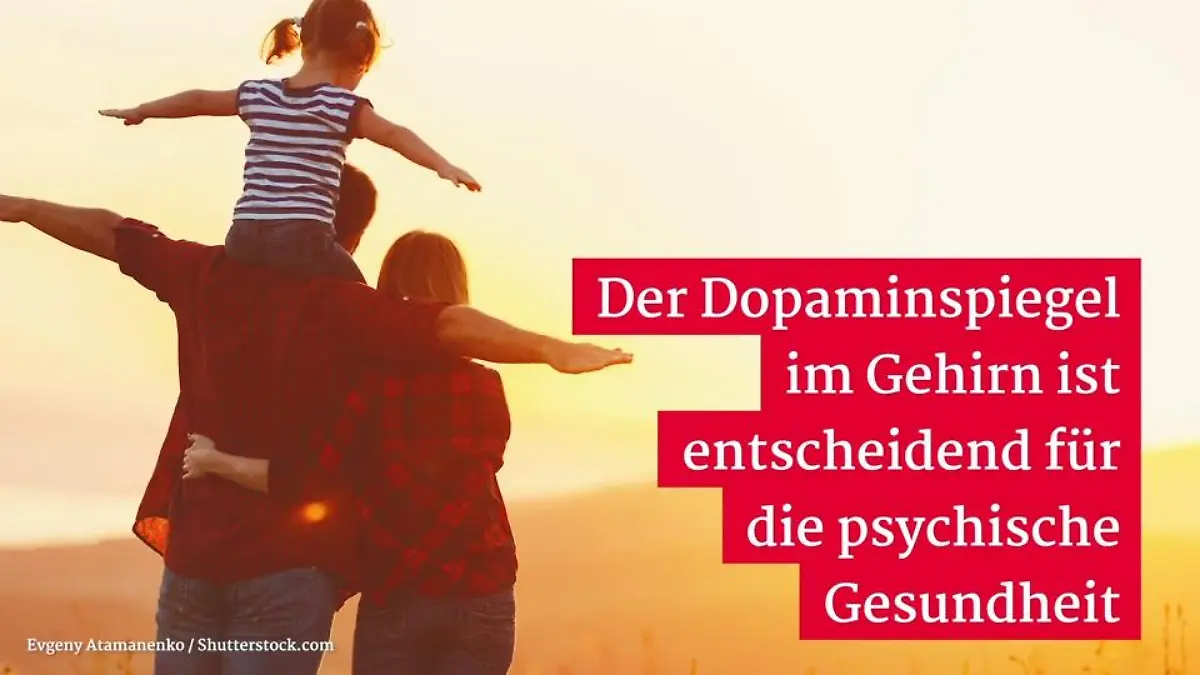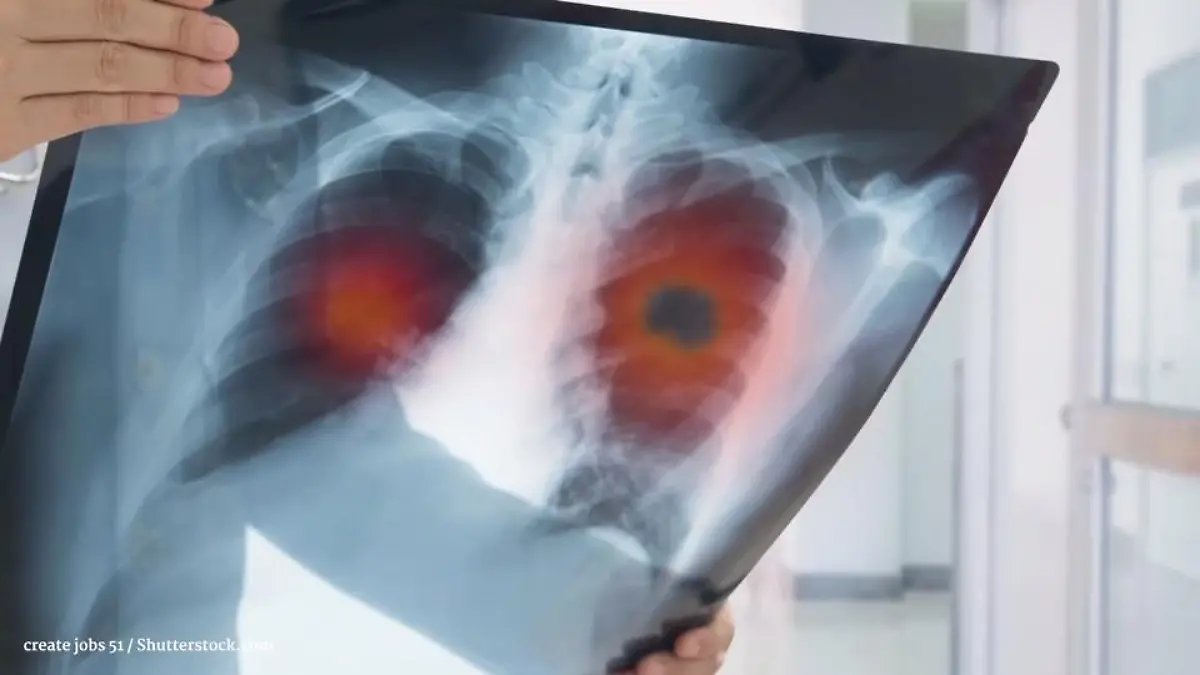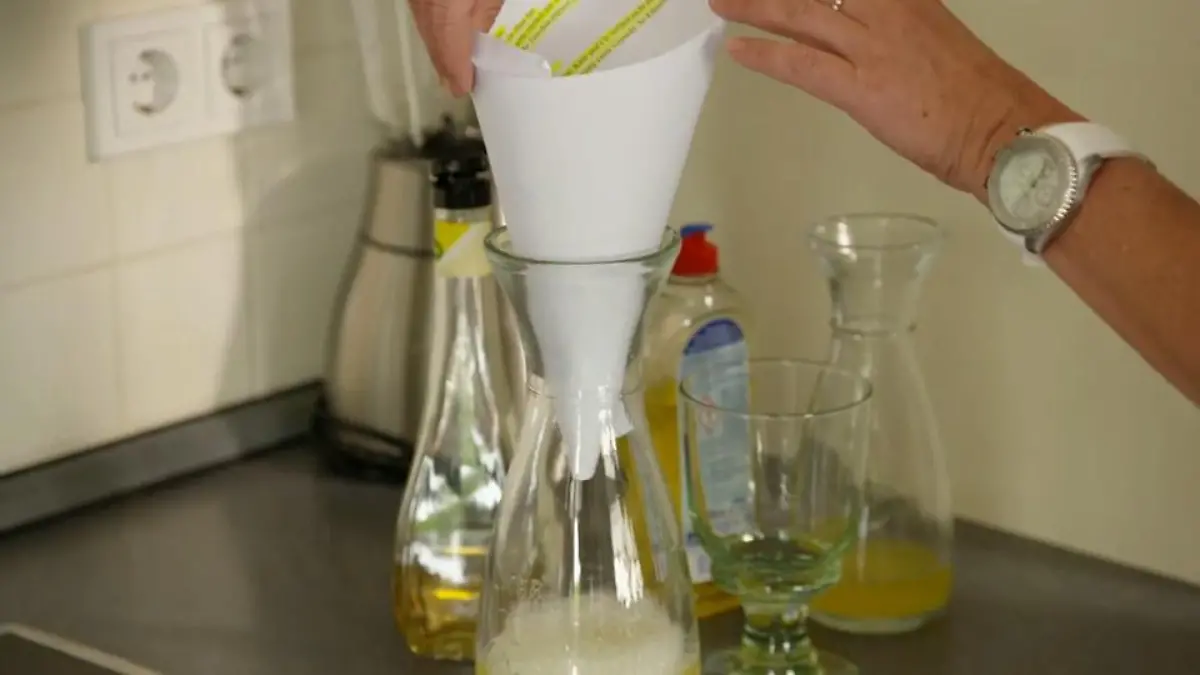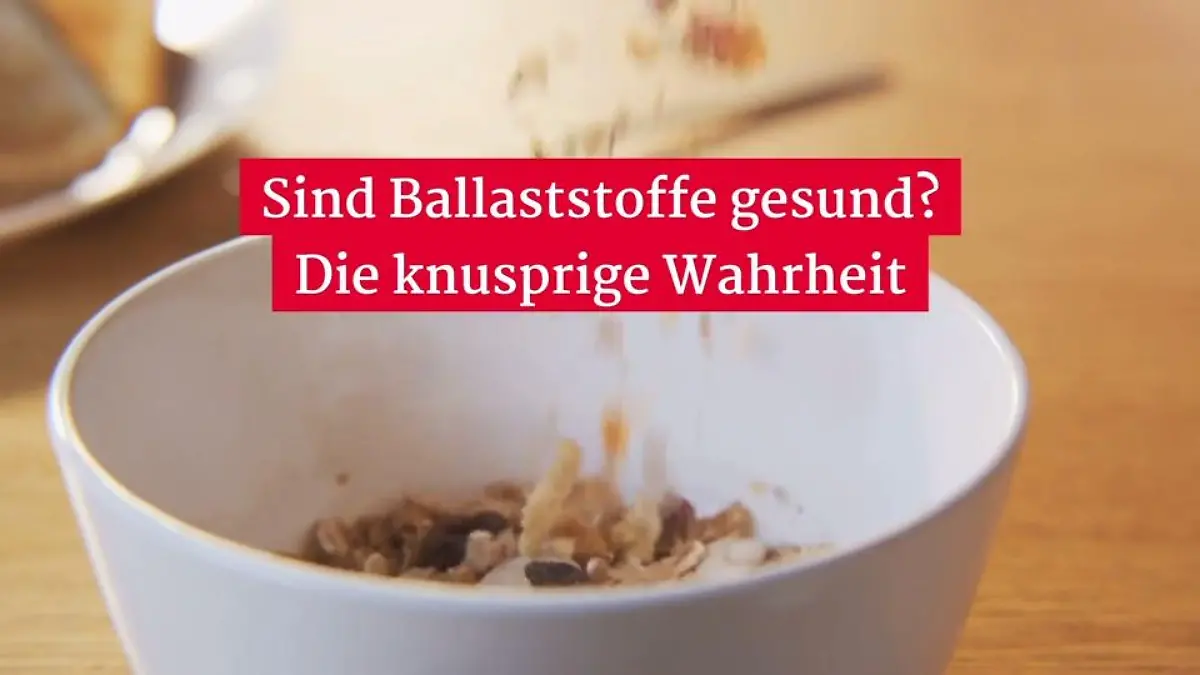Ein wichtiger Teil des KnochengerüstGesundheitslexikon: Wirbelsäule
Die Wirbelsäule bzw. das Rückgrat bildet zusammen mit den Rippen und dem Brustbein das Rumpfskelett. Für den Körper übernimmt sie bedeutende Aufgaben: Sie schützt das Rückenmark, trägt den Schädel und die Rippen und stützt den Schultergürtel und die Beckenknochen.
Die Wirbelsäule als komplexes Konstrukt
Sie ist eine doppel-s-förmige, bewegliche und im aufrechten Stand senkrecht gelagerte Säule, die aus 33 oder 34 Wirbeln besteht: sieben Halswirbeln, zwölf Brustwirbeln, fünf Lendenwirbeln, üblicherweise fünf zum Kreuzbein verschmolzenen Sakralwirbeln (sie bilden zusammen mit dem Darm- und Schambein das Becken) sowie den Wirbeln, die zum Steißbein verschmolzen sind. Ab der Verbindung zwischen zweitem und drittem Halswirbel und bis zur Verbindung zwischen letztem Lendenwirbel und Kreuzbein finden sich die 23 faserknorpligen Bandscheiben bzw. Zwischenwirbelscheiben. Diese und die Doppel-S-Form sind dazu da, Erschütterungen abzufangen. Die Struktur lässt sich folgendermaßen darstellen: Der Abschnitt der Halswirbelsäule ist leicht nach vorn gewölbt (Lordose), der der Brustwirbelsäule nach hinten (Kyphose), der der Lendenwirbelsäule wieder nach vorn und das Os sacrum bzw. Kreuzbein nach hinten. Entlang, innerhalb und zwischen den Wirbeln verlaufen stabilisierende Bänder. Ihre Stabilität und die gleichzeitige Beweglichkeit verdankt die Wirbelsäule ihrem komplexen Zusammenspiel mit bestimmten Muskeln.
Der Aufbau der Wirbel
Bei freien, also nicht verschmolzenen Wirbeln (mit Ausnahme des ersten und zweiten Halswirbels) sind folgende Teile zu nennen: Wirbelkörper, Wirbelbogen, Dornfortsatz, zwei Querfortsätze, zwei obere Gelenkfortsätze und zwei untere Gelenkfortsätze. Die Wirbellöcher bilden zusammen den Wirbelkanal, in welchem sich das Rückenmark befindet. Die vom Rückenmark austretenden Spiralnervenwurzeln verlassen den Wirbelkanal durch ihr jeweiliges Zwischenwirbelloch. Kleine Wirbelgelenke verbinden die einzelnen Wirbel untereinander.
Eine besondere Form haben der erste Halswirbel (Atlas) und der zweite Halswirbel (Axis): Der erste Halswirbel weist keinen eigentlichen Wirbelkörper auf, er ähnelt in seiner Form einem Ring (mit Gelenkflächen für die Hinterhauptskondylen); als Quasi-Wirbelkörper tritt der Zahnfortsatz des zweiten Halswirbels auf. Das Zusammentreffen von Hinterhaupt und erstem Halswirbel bildet das erste bzw. obere Kopfgelenk, das Zusammentreffen von erstem und zweitem Halswirbel das zweite bzw. untere Kopfgelenk.
Die Brustwirbel weisen für das Tragen der Rippen am Wirbelkörper und an den Querfortsätzen spezielle Gelenkflächen auf. Das Kreuzbein bildet mit dem Hüftbein den Beckengürtel. In Bezug auf die übliche Verschmelzung von fünf Wirbeln gibt es Ausnahmefälle: Der fünfte Lendenwirbel kann mit dem Kreuzbein verschmolzen sein und es kommt manchmal vor, dass der erste Kreuzbeinwirbel nicht verschmolzen ist.
Anzeige:Gesunderhaltung der Wirbelsäule
Durch die Doppel-S-Form, die Wirbelgelenke, das Bandsystem und die Bandscheiben vermag die Wirbelsäule trotz ihrer knöchernen Wirbelkörper die mit einem aufrechten Gang verbundenen Belastungen auszugleichen. Allerdings ist ihre intakte Funktionsweise ein wertvolles Gut, Über- und Fehlbelastungen sollten daher stets vermieden werden. Um die Wirbelsäule gesund zu erhalten, ist eine adäquate Bewegung erforderlich, denn nur diese führt zu einer funktionellen Erhaltung bzw. Kräftigung der stabilisierenden Muskeln (auch in tieferen, wirbelkörpernahen Bereichen). Das richtige Maß an Bewegung sorgt zudem dafür, dass sich die Bandscheiben ausreichend mit Nährstoffen versorgen können und der die Lage der Wirbelkörper sichernde Bandapparat elastisch bleibt.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel kann einen Besuch beim Arzt nicht ersetzen. Er enthält nur allgemeine Hinweise und darf daher keinesfalls zu einer Selbstdiagnose oder Selbstbehandlung herangezogen werden.