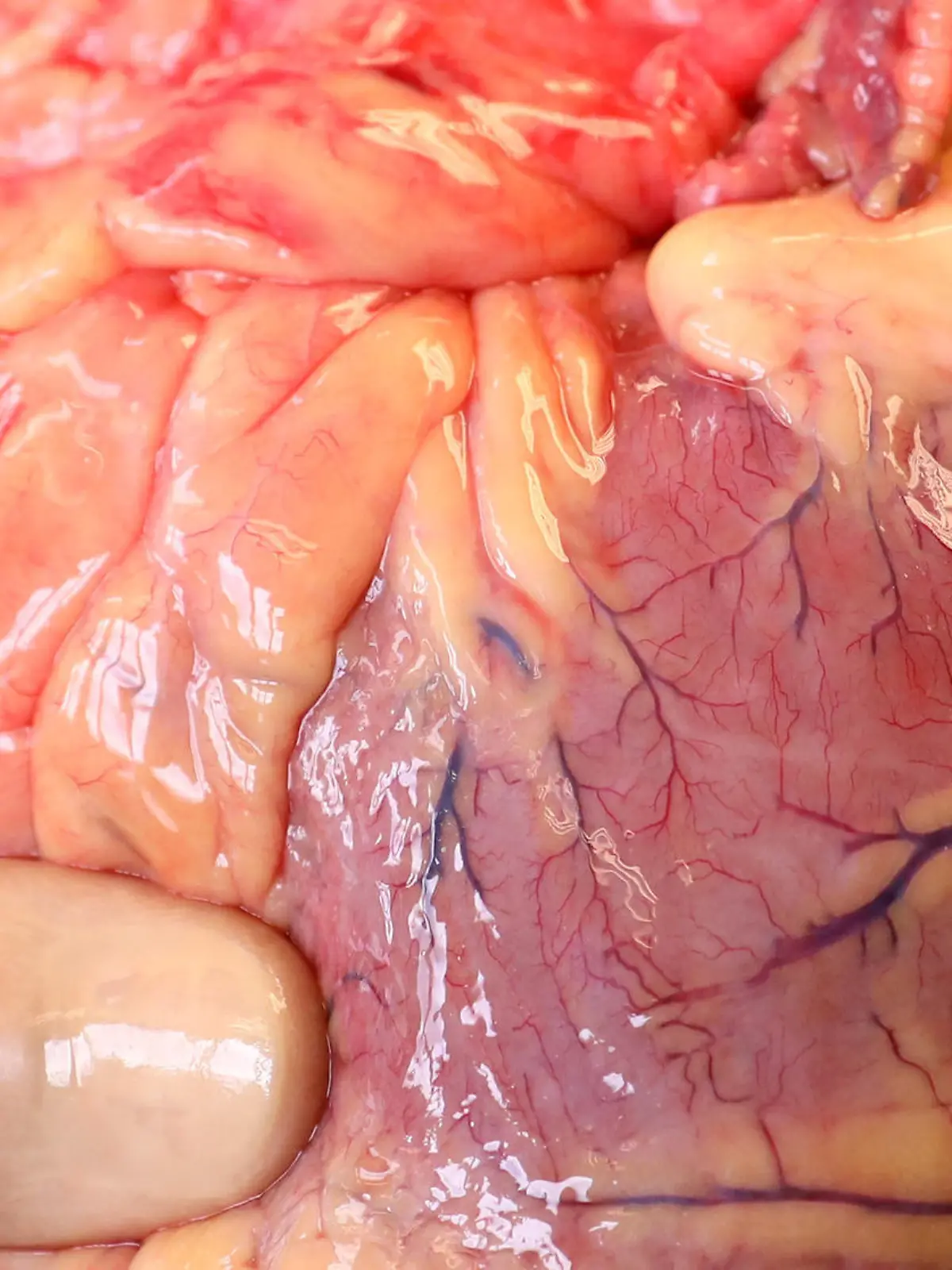Ärztlichen MaßnahmeGesundheitslexikon: Indikation (Heilanzeige)

Indikation ist ein Lehnwort aus dem Lateinischen und leitet sich vom Verb ‚indicare‘ mit der wörtlichen Übersetzung ‚anzeigen‘ ab. In der medizinischen Fachsprache ist die Indikation als Heilanzeige zu verstehen und bezieht sich so auf die Behandlungsschritte, die für einen Patienten bestimmten Gesundheitszustandes angezeigt sind. Abhängig vom Gesamtzustand des Patienten besteht eine spezifische Indikation auf bestimmte Behandlungsverfahren.
Arten der Indikation
Mit der Indikation wird jeweils angegeben, welche Behandlungsschritte angezeigt sind und dem Patienten nutzen. Unterschiedliche Arten der Heilanzeige haben sich im medizinischen Sprachgebrauch etabliert. Bei einer Notfallindikation handelt es sich um ärztliche Maßnahmen, die bei lebensbedrohlich akuten Krankheitsbildern angezeigt sind. Zu den wichtigsten Notfallindikationen zählen Notfalloperationen. Auch die vitale Heilanzeige bezieht sich auf Behandlungsmaßnahmen bei lebensbedrohlichen Krankheitsbildern wie beispielsweise bestimmten Herzerkrankungen. Von diesen Arten der Indikation ist die absolute Indikation zu unterscheiden. Mit der absoluten Heilanzeige sind Therapien gemeint, die negative Krankheitsauswirkungen auf die Gesamtgesundheit des Patienten minimieren. Eine relative Indikation bezieht sich dagegen auf Maßnahmen, die dem Patienten eines bestimmten Krankheitsbildes Vorteile verschaffen können. Anders als die absolute Indikation ist die relative Indikation nicht zwingend notwendig. Von einer ursächlichen Indikation ist wiederum dann die Rede, wenn es um Maßnahmen zur ursächlichen und damit heilenden Behandlung eines Krankheitsbildes geht. Das Gegenteil dieser Heilanzeige ist die symptombezogene Indikation, die sich statt auf ursächliche Behandlungsschritte auf symptomatische Behandlungsmaßnahme bezieht.
Unterschied von Kontraindikation und dem Vermerk „keine Indikation“
Kontraindikation und der Vermerk „keine Indikation“ drücken nicht dasselbe aus. Wenn „keine Indikation“ auf eine bestimmte Behandlungsmaßnahme besteht, verschafft die jeweilige Behandlung dem Patienten eines bestimmten Krankheitsbildes keine Vorteile. Keine Indikation besteht zum Beispiel auf Gerinnungshemmer bei Harnwegsinfektionen, da sie die Symptome des Infekts unter keinen Umständen bessern. Allerdings muss der Patient nicht mit verheerenden Auswirkungen rechnen, wenn er Behandlungen ohne Indikation erhält. Mit der Kontraindikation sind dagegen Maßnahmen zur Behandlung gemeint, die für den Patienten eines bestimmten Krankheitsbildes mit negativen Auswirkungen verbunden sind. Der Ausdruck Krankheitsbild bezieht sich an dieser Stelle auf den allgemeinen Gesundheitszustand des Patienten. So kann eine Operation an stark fettleibigen Patienten zum Beispiel kontraindiziert sein, obwohl sie eine vorliegende Erkrankung heilen könnte. Die Kontraindikation ergibt sich in diesem Fall aus dem Risiko des Herzstillstands, dem extrem übergewichtige Personen bei operativen Eingriffen ausgesetzt sind. Kontraindikationen können sich außerdem in Bezug auf unterschiedliche Medikamente ergeben. Die Wechselwirkungen von Medikamenten können bei bestimmten Medikamentenkombinationen zum Beispiel zu einem Kreislaufkollaps oder Herzstillstand führen. Ärzte wägen für jede Behandlung den zu erwartenden Nutzen und die Risiken für den Patienten ab. Wenn die Risiken den Nutzen übersteigen, ist die Behandlung nicht indiziert. Die Indikation und Kontraindikation unterscheiden sich von Patient zu Patient. Obwohl zwei Menschen mit derselben Diagnose das Krankenhaus erreichen, müssen sich ihre Heilanzeigen und Kontraindikationen also nicht entsprechen.