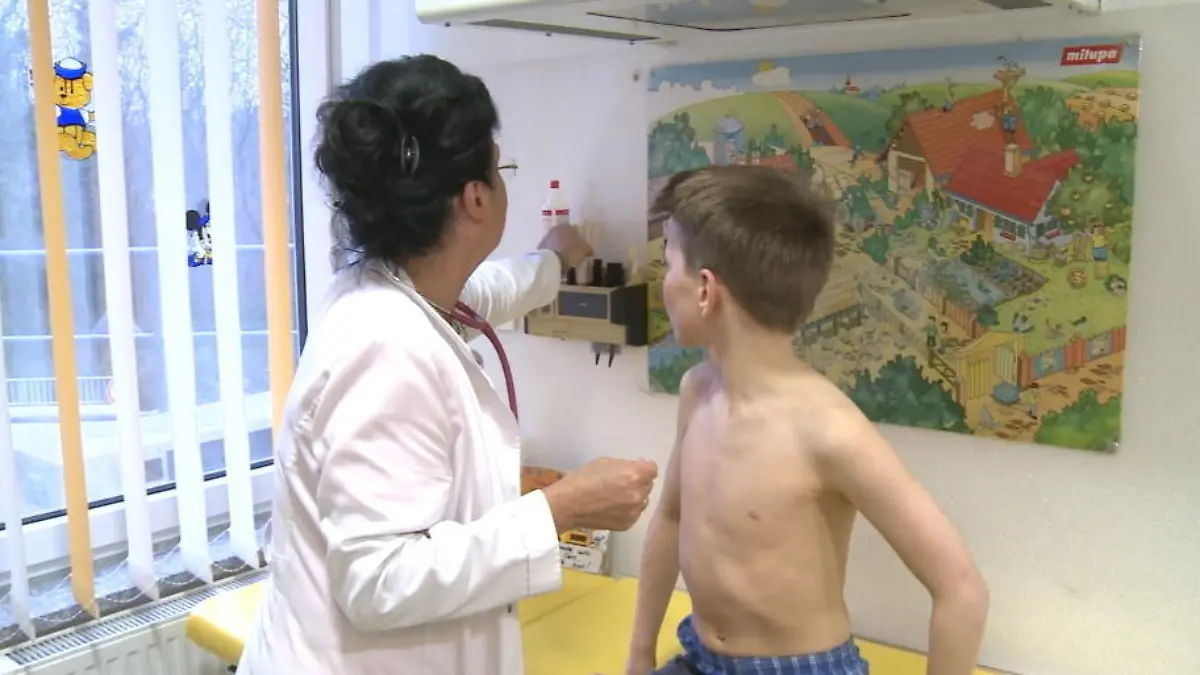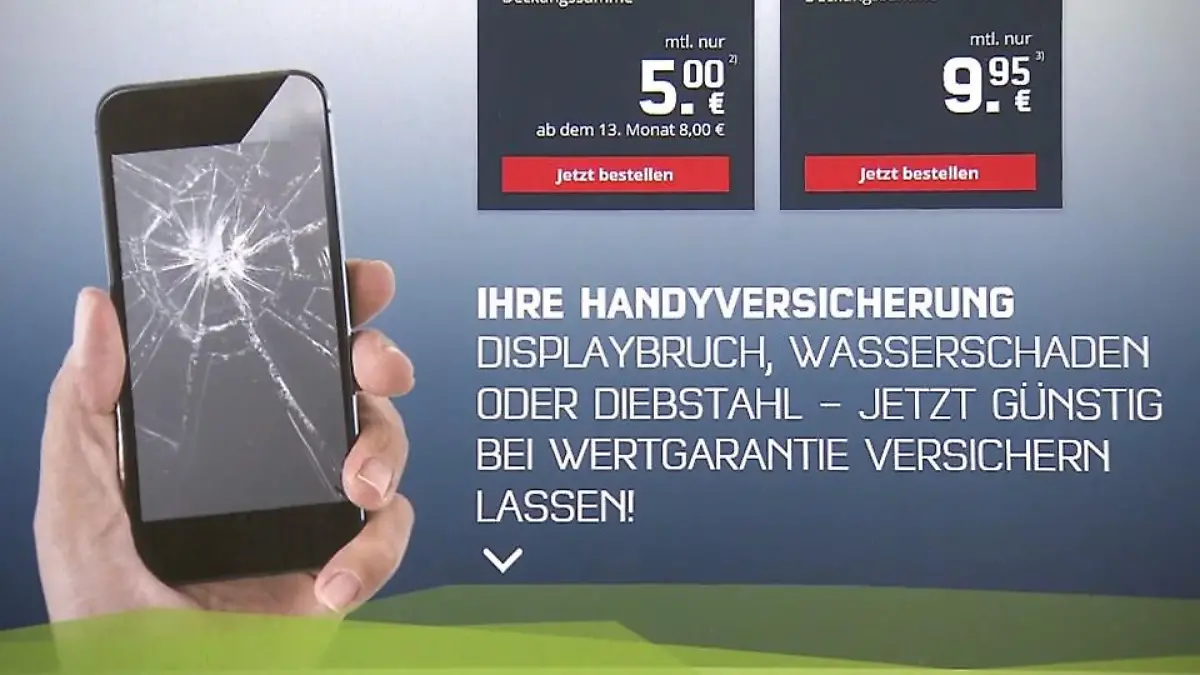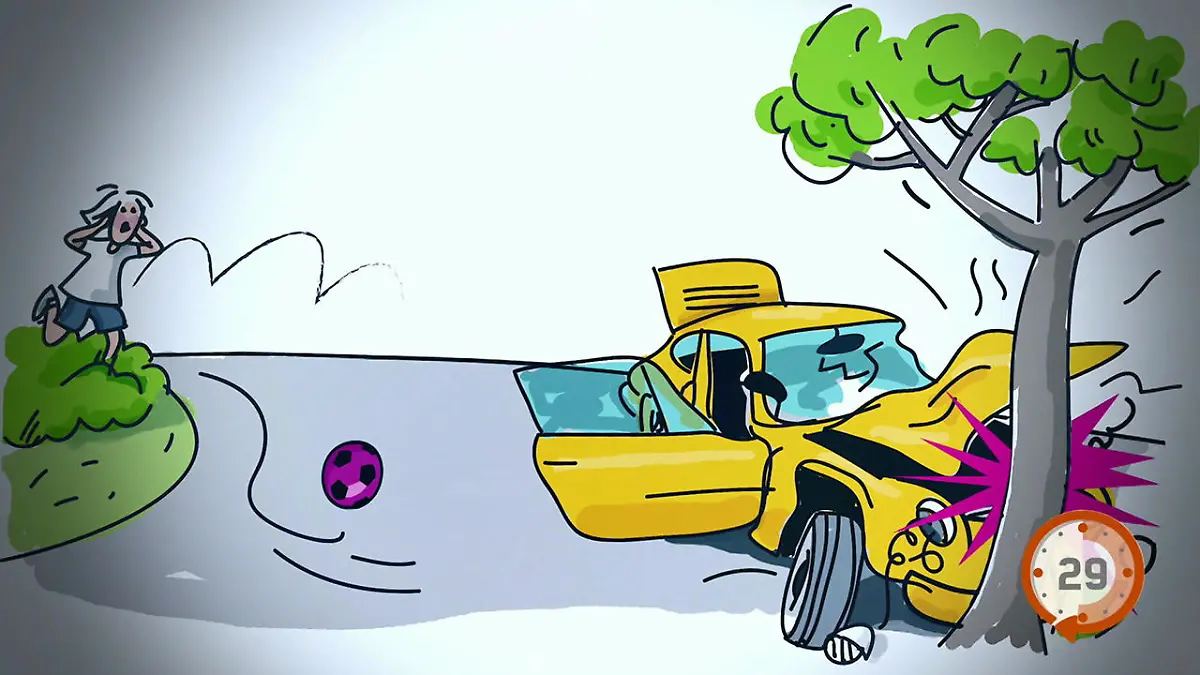Bräuche rund um den 1. Mai erklärtWarum gibt es eigentlich Tanz in den Mai, Maibäume, Hexenfeuer und Co.?

Alles neu macht der Mai!
Und das Beste ist: In vielen (dörflichen) Regionen Deutschlands wird schon mit einer Party in den Wonnemonat gestartet. Für viele ist Tanz in den Mai ein Muss, es wird gefeiert und in den frühen Morgenstunden ein Maibaum aufgestellt. Aber warum ist das eigentlich so? Wir erklären euch, was die wichtigsten Bräuche bedeuten!
Liebesbeweis UND beliebte Dorf-Tradition: Das hat es mit dem Maibaum und dem Maiherz auf sich
Der wohl bekannteste Mai-Brauch ist das Aufstellen des Maibaums, auch wenn dies in vielen Regionen anders gelebt wird. Unter anderem im Nordrhein-Westfalen, im Rheinland und in Bayern stellen verliebte Männer vor dem Haus ihrer Auserwählten einen mit bunten Bändern und einem roten Herz geschmückten Baum auf.
Alle vier Jahre können sich die Männer aber eine Pause gönnen, denn im Schaltjahr sind die Frauen an der Reihe, ihrem Liebsten einen Maibaum zu stellen.
Übrigens erfreuen sich statt eines Maibaums auch (selbstgebastelte) Maiherzen großer Beliebtheit!
Lese-Tipp: Was Verliebte über den Maibaum wissen sollten
Auch in anderen Bundesländern stellt man Maibäume auf – oft aber dann an einem zentralen Ort im Dorf oder der Gemeinde. Die bis zu 30 Meter hohen Bäume werden bunt bemalt, prachtvoll geschmückt und bei einer feierlichen Zeremonie am 30. April aufgestellt. Der Baum wird dann die ganze Nacht von den jungen Männern aus dem Ort bewacht. Im Süden ist man nämlich ein Held, wenn man es schafft, einen Baum aus dem Nachbardorf zu klauen. Der muss dann von den Beklauten mit einem Fest oder mehreren Litern Bier für die Maibaum-Gauner ausgelöst werden. In einigen Teilen des Freistaates gibt es darüber hinaus noch das „Maibaum-Kraxeln“. Dabei versuchen junge Männer, mit bloßen Händen und Füßen den Stamm so hoch wie möglich empor zu klettern.
1. Mai = Walpurgisnacht! HIER stehen jetzt Hexen-Puppen vor dem Haus

Im Harz fiebern die Menschen schon nach Weihnachten der Walpurgisnacht zum 1. Mai entgegen. Sie verkleiden sich als Hexen und stellen sich Hexen-Puppen vor das Haus.
Die Walpurgis-Feiern gehen ursprünglich auf heidnische Frühlingsfeste zurück. Später versuchte die Kirche, den Feiern einen neuen Inhalt zu geben. Sie ließ am 30. April den Geburtstag der heiligen Walburga feiern, der Schutzpatronin gegen Aberglauben und Geister.
Heute ist die Walpurgisnacht nicht nur eine große Touristen-Attraktion, sondern nach wie vor auch für viele Einheimische ein Grund zum Feiern. Auch auf dem Brocken – dem sagenumwobenen Blocksberg – treffen sich die Hexen und andere magische Wesen, um in den Mai zu feiern. Die meisten sind aber vermutlich kostümiert.
Anzeige:Und was genau ist jetzt „Tanz in den Mai”?
Die moderne Variante der Walpurgis-Feierlichkeiten ist der Tanz in den Mai. Am Abend des 30. Aprils versammeln sich Menschen, um den Monat Mai und damit den Beginn der warmen Zeit des Jahres zu begrüßen und trinken dabei gerne das ein oder andere Glas Alkohol, oft gibt’s ganz traditionell Maibowle.
Lese-Tipp: Maibowle selber machen mit diesem einfachen Rezept
In einigen Regionen wird der „Tanz in den Mai“ auch Hexenfeuer oder Maifeuer genannt – und dieses wird auch tatsächlich entfacht, ähnlich wie das Osterfeuer. Dieses Feuer hat allerdings etwas mit der Liebe zu tun. Denn wenn am Ende einer Nacht das Feuer heruntergebrannt ist, wird Verliebten, die über die Feuerstelle springen, Glück versprochen.
Video-Tipp: Mit nur sieben Zutaten eine leckere Maibowle zaubern!
Warum in der Mainacht auch schon mal Klopapier und Rasierschaum die Straßen bedecken
Nicht nur Hexen treiben ihren Schabernack in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai, auch Gruppen von Jugendlichen lassen sich jedes Jahr in der sogenannten Freinacht den ein oder anderen Streich einfallen. Wer jetzt denkt, dass die jungen Menschen dabei von den Hexen der Walpurgisnacht beeinflusst wurden, liegt allerdings falsch.
Ursprung der Freinacht-Streiche mit viel Klopapier und Rasierschaum sind alte Musterungstermine zum 1. Mai. Bevor für die jungen Männer mit dem Eintritt in den Militärdienst fernab der Heimat der „Ernst des Lebens“ begann, nutzten viele Burschen noch eine Nacht die Gelegenheit, mit Streichen für die Nachbarschaft ein letztes Mal unvernünftig und kindisch zu sein.
Bis heute hat sich die Tradition gehalten und hinterlässt jährlich am 1. Mai Straßensperren aus Klopapier, Rasierschaum an der Türklinke und Lücken im Zaun.
Doch aufgepasst, die Freinacht ist nicht automatisch ein Freibrief für Vandalismus und jeder Spaß hat seine Grenzen!
Und dann gibt’s da natürlich auch noch den Maikönig und die Maikönigin
In Franken küren seit dem Mittelalter die Bewohner am 1. Mai das schönste Mädchen des Ortes zur Maikönigin. Und dann wird die Auserwählte auch noch versteigert und anschließend an den Meistbietenden oder einen gewählten Maikönig übergeben. Aber keine Angst, das Geld geht immerhin an die Königin höchstpersönlich, und nach so einem Feiertag gibt's bestimmt genug Orte, an denen man es wieder ausgeben kann. Früher wurde der erzielte Gewinn aus der Versteigerung allerdings noch den weniger begehrten Damen einer Ortschaft zur Unterstützung bei der Aussteuer überlassen.