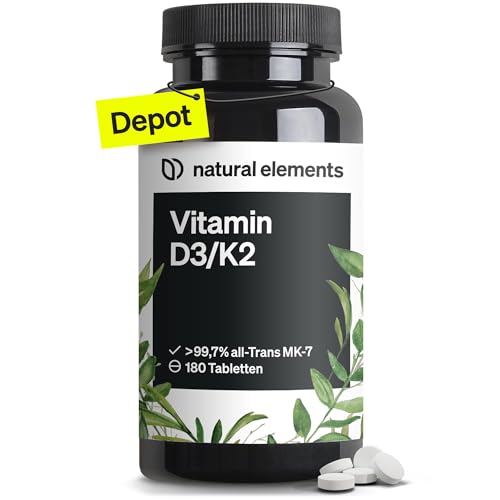Dr. Yael Adler im RTL-Interview Diese Zuckeralternativen fördern die Gesundheit

Was ist gesunde Ernährung?
Darüber streiten sich seit jeher die Geister. Welche Fette sind nun gut oder schlecht? Sind Zucker und Zuckerersatzstoffe böse? Und können Proteine auch bei Krankheiten wie Hashimoto Thyreditis helfen? Die bekannte Hautärztin Dr. Yael Adler klärt in ihrem neuen Buch „Genial ernährt” auf und schafft im Interview mit RTL.de schon einmal Klarheit über Ernährungsmythen.
RTL.de: Wie viel Eiweiß braucht man und wovon hängt der Eiweißbedarf ab?
Dr. Yael Adler: Es gibt da unterschiedliche Richtwerte. Man kann pauschal sagen, dass 10 bis 20 Prozent der Kalorienzufuhr über Proteine geliefert werden können und sollten. Die häufige Angabe von 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist der untere Rand des Richtwerts. Oft liegt der Bedarf aber höher etwa bei 1,3-1,6 Gramm pro Kilogramm – insbesondere im Wachstum, im Alter, bei Infektionen, wenn man Stress hat oder Sport treibt. Auch in der Schwangerschaft und Stillzeit ist der Proteinbedarf erhöht. Man sollte vor allem auf die Proteinqualität achten.
Welche Proteine sind dann zu bevorzugen?
Tierisches Protein ist häufig etwas besser bioverfügbar. Ab dem Alter von 65 Jahren können tierische Proteine besonders helfen, da in diesem Alter der Muskelabbau stark zunimmt. Vor diesem Alter sollten jedoch pflanzliche Proteine überwiegen, da sie mit einem geringeren Risiko für chronische Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes und bestimmte Krebsarten verbunden sind und zudem entzündungshemmende sowie darmfreundliche Eigenschaften besitzen. Generell sollte die tägliche Proteinmenge auf zwei bis drei Mahlzeiten verteilt werden. So stehen die Aminosäuren – aus denen Proteine bestehen – dem Körper gleichmäßig zur Verfügung.
Was wären dann gute pflanzliche Proteinquellen?
Soja, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Pilze, Pseudogetreide wie Quinoa, Buchweizen oder Amaranth, Nüsse und Saaten und sogar Brokkoli. Pflanzliche Proteine sollte man klug kombinieren, um alle essentiellen (lebensnotwendigen) Aminosäuren aufzunehmen. Auch wenn die Gesamtmenge an Eiweiß im Blut ausreichend ist, kann das Fehlen einer bestimmten essenziellen Aminosäure zum limitierenden Faktor werden. In diesem Fall kann der Körper keine vollständigen Proteine synthetisieren, obwohl andere Aminosäuren ausreichend vorhanden sind. Diese unvollständige Proteinbiosynthese kann wichtige körperliche Prozesse beeinträchtigen, da der Körper keine funktionalen Proteine mehr in ausreichender Menge aufbauen kann. Zusätzlich übernehmen viele Aminosäuren – unabhängig von ihrer Rolle im Proteinkomplex – zentrale Aufgaben im Stoffwechsel, Immunsystem und Hormonhaushalt, die bei einem Mangel ebenfalls gestört sein können.
Für wen sind Proteinshakes geeignet und für wen nicht?
Proteinshakes – insbesondere mit Whey-Protein – sind im Fitnessbereich beliebt, da sie den Muskelaufbau fördern und die Regeneration beschleunigen. Ein zentraler Mechanismus dabei ist die Aktivierung des Zellschalters mTORC1 (mechanistic Target of Rapamycin Complex 1), der Wachstum und Zellneubildung stimuliert. Besonders Whey-Protein mit seinem hohen Leucingehalt aktiviert mTORC1 sehr effektiv. Kurzfristig ist das für Muskelwachstum erwünscht – doch eine chronisch erhöhte mTORC1-Aktivität, etwa durch dauerhaft hohe Eiweißzufuhr, kann langfristig das Risiko für Zivilisationskrankheiten wie Übergewicht, Typ-2-Diabetes, bestimmte Krebsarten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und möglicherweise auch neurodegenerative Erkrankungen wie Demenz erhöhen.
Braucht man zusätzliche Proteine, wenn man ins Fitnessstudio geht?
Beim normalen Breitensport ist eine zusätzliche Eiweißzufuhr in der Regel nicht notwendig, da der Bedarf meist gut über eine ausgewogene Ernährung gedeckt werden kann. Sinnvoll können Proteinshakes jedoch für Menschen mit erhöhtem Eiweißbedarf sein – etwa für Leistungssportler, ältere Menschen ab etwa 65 Jahren zur Vorbeugung von Muskelabbau, oder auch für Personen mit eingeschränkter Nahrungsaufnahme, Untergewicht oder in der Genesungsphase nach Krankheiten. Auch Vegetarier oder Veganer profitieren möglicherweise von ergänzendem Protein, wenn es schwierig ist, alle essenziellen Aminosäuren über die Ernährung abzudecken.
Sind vegane Proteinshakes genauso gut?
Vegane Proteinshakes – zum Beispiel auf Basis von Erbsen, Reis oder Hanf – aktivieren mTORC1 schwächer als Whey-Protein, liefern aber dennoch ausreichend Bausteine für die Regeneration und moderaten Muskelaufbau. Menschen mit Nieren- oder Lebererkrankungen sollten übrigens immer vorher mit dem Arzt sprechen, da eine erhöhte Eiweißzufuhr diese Organe zusätzlich belasten kann.
Stimmt es, dass Proteine auch bei Krankheiten wie Hashimoto-Thyreoiditis oder Long Covid helfen können?
Proteine und Aminosäuren könnten auch bei Erkrankungen wie Hashimoto-Thyreoiditis und Long Covid unterstützend wirken, insbesondere bei Symptomen wie Erschöpfung, Entzündungen, Muskelabbau und gestörter Immunregulation. Zwar gibt es bislang noch keine umfangreiche, belastbare Studienlage zum gezielten therapeutischen Einsatz, jedoch bestehen biologisch plausible Ansätze und erste positive Hinweise.
Welche Proteine wären bei Hashimoto-Thyreoiditis wichtig?
Bei Hashimoto-Thyreoiditis spielt die Aminosäure L-Phenylalanin eine wichtige Rolle, da sie im Körper zu Tyrosin umgewandelt wird – ein essenzieller Baustein für die Schilddrüsenhormone T3 und T4. Ein Mangel könnte sich daher negativ auf die Hormonproduktion auswirken. Auch Tryptophan, gemeinsam mit seiner Zwischenstufe 5-HTP (5-Hydroxytryptophan), ist bedeutsam: Als Vorläufer des Neurotransmitters Serotonin kann es helfen, depressiven Verstimmungen entgegenzuwirken, die bei Hashimoto häufig auftreten. Serotonin wird zudem in Melatonin umgewandelt – einem Hormon, das den Schlaf-Wach-Rhythmus reguliert, Zellschutzfunktionen erfüllt und die Mitochondrienaktivität verbessert. Ein weiterer möglicher Ansatz ist der Einsatz von Glutamin, das eine schützende Wirkung auf die Darmschleimhaut haben kann. Das ist besonders relevant im Zusammenhang mit einem möglichen Leaky-Gut-Syndrom, das bei Autoimmunerkrankungen wie Hashimoto gelegentlich auftritt. Auch Glycin, eine häufig unterschätzte Aminosäure, wirkt entzündungshemmend, beruhigend auf das Nervensystem und unterstützt die Entgiftung der Leber sowie die Kollagensynthese, was es besonders bei chronischen Entzündungszuständen interessant macht. Ergänzend zur Aminosäurenversorgung kann es bei Hashimoto hilfreich sein, gezielt bestimmte Mikronährstoffe zu ergänzen – insbesondere Vitamin D3, Omega-3-Fettsäuren und Selen, da sie eine regulierende Wirkung auf das Immunsystem und die Schilddrüsenfunktion entfalten können
Wie sieht es bei Long Covid aus?
Bei Long Covid stehen Aminosäuren wie Leucin im Fokus, da sie die Muskelregeneration fördern und zur Energiegewinnung beitragen können. Zudem gelten Carnitin und Arginin als vielversprechend. Carnitin unterstützt die Funktion der Mitochondrien – der sogenannten Zellkraftwerke, die bei Long Covid häufig beeinträchtigt sind. Arginin fördert die Durchblutung und kann helfen, Herz-Kreislauf-Symptome und körperliche Schwäche zu lindern.
Welche Kohlenhydrate sind generell zu bevorzugen?
Glukose aus Kohlenhydraten ist die wichtigste Energiequelle unseres Körpers, insbesondere für das Gehirn, das täglich rund 120 Gramm Glukose benötigt. Nervenzellen und rote Blutkörperchen sind vollständig auf Glukose angewiesen. In Zeiten von Fasten oder sehr kohlenhydratarmer Ernährung produziert der Körper Ketonkörper, um das Gehirn mit Energie zu versorgen und gleichzeitig den Abbau von Muskeleiweiß zu vermeiden – ein sinnvoller Schutzmechanismus, besonders bei Stress, intensiver geistiger Arbeit oder sportlicher Belastung. Muskelzellen speichern Kohlenhydrate als Glykogen, das bei körperlicher Aktivität mobilisiert wird. Eine ausreichende Zufuhr von Kohlenhydraten bewahrt daher die Muskulatur vor Abbau und unterstützt Regeneration und Leistungsfähigkeit.
Gesundheitlich besonders wertvoll sind komplexe Kohlenhydrate aus unverarbeiteten, ballaststoffreichen Lebensmitteln. Sie führen zu einem langsamen Blutzuckeranstieg, sorgen für gleichmäßige Insulinausschüttung und fördern langanhaltende Sättigung. Gleichzeitig liefern sie Ballaststoffe, die die Darmgesundheit verbessern, den Cholesterinspiegel senken, die Blutzuckerregulation unterstützen und sogar das Risiko für Darmkrebs senken können. Im Gegensatz dazu führen einfache Zucker – wie sie in Süßwaren, Softdrinks oder Weißmehlprodukten vorkommen – zu einem raschen Blutzuckeranstieg, gefolgt von einem starken Abfall, was Heißhunger, Müdigkeit und Stimmungsschwankungen auslösen kann.
Ist die Fructose in Obst und Säften nun gut oder schlecht?
Bei Fructose kommt es stark auf die Quelle und Menge an. In ganzen Früchten, die reich an Ballaststoffen und Antioxidantien sind, ist Fructose in moderaten Mengen unproblematisch und sogar gesundheitsförderlich. Problematisch wird es, wenn Fructose in konzentrierter Form aufgenommen wird – etwa durch Obstsaft, Obstmus oder industriell zugesetzten Fructosesirup. Diese Produkte enthalten kaum Ballaststoffe, gelangen schnell ins Blut und belasten insbesondere die Leber, da Fructose ausschließlich dort verstoffwechselt wird. In hoher Dosis kann dies zur Entwicklung einer nicht-alkoholischen Fettleber, Insulinresistenz oder Störung des Fettstoffwechsels beitragen. Zudem wird Fructose nicht insulinreguliert – das bedeutet, sie löst kein direktes Sättigungssignal aus, was eine übermäßige Kalorienaufnahme begünstigen kann.
Was halten Sie von glutenfreier Ernährung?
Das ist ein Ernährungstrend. Für Menschen ohne Glutenunverträglichkeit oder -sensitivität ist eine glutenfreie Ernährung aus wissenschaftlicher Sicht nicht nötig und nicht sinnvoll – und kann sogar problematisch sein, da man auf viele wertvolle Lebensmittel verzichtet. Unter anderem wird es dadurch schwieriger, ausreichend Ballaststoffe und Mineralstoffe aufzunehmen.
Was ist Gluten eigentlich?
Gluten ist das sogenannte Klebereiweiß im Weizen, es kommt aber auch in Roggen, Gerste und Dinkel vor. Es besteht aus den beiden Proteinstrukturen Gliadin und Glutenin, die für die typische Teigelastizität und Klebrigkeit beim Backen sorgen. Es gibt keinen erwiesenen gesundheitlichen Vorteil, Gluten zu meiden, wenn keine medizinische Notwendigkeit wie Zöliakie oder eine Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität vorliegt.
Sind glutenfreie Produkte also kein guter Ersatz für Weizen und Co.?
Viele glutenfreie Produkte enthalten weniger Ballaststoffe, B-Vitamine, Folsäure, Eisen und Magnesium. Sie sind oft stark verarbeitet und bestehen überwiegend aus stärkelastigen Zutaten wie Mais-, Reis- oder Kartoffelstärke. Diese Produkte haben zudem meist einen höheren glykämischen Index, was zu Blutzuckerspitzen führen kann. Wer also keine Glutenunverträglichkeit hat, muss nicht auf Gluten verzichten.
Ist Zucker nun problematisch?
Es kommt immer auf die Dosis an – und darauf, in welcher Form Zucker konsumiert wird. Die gesundheitlichen Probleme, die im Zusammenhang mit Zucker stehen, entstehen nicht durch den natürlichen Zucker in Obst oder Milch, sofern diese in moderaten Mengen gegessen werden. Kritisch wird es vor allem bei freiem und zugesetztem Zucker – also Zucker, der industriell verarbeiteten Lebensmitteln beigefügt wird. Dieser liefert leere Kalorien, enthält keine Mikronährstoffe, hat eine hohe Energiedichte und gelangt viel zu schnell in den Blutkreislauf.
Wie viel Zucker darf man essen ohne gesundheitsschädliche Wirkungen zu befürchten?
Empfohlen wird, dass Kinder maximal 5 Prozent und Erwachsene maximal 10 Prozent ihrer täglichen Kalorienzufuhr in Form von freiem Zucker aufnehmen. Freie Zucker sind alle Zuckerarten, die Lebensmitteln zugesetzt werden (z. B. Haushaltszucker, Fructosesirup) sowie die von Natur aus in Säften, Sirup, Honig und Fruchtmus enthaltenen Zucker.
Was ist das Problem bei freien Zuckern?
Zucker sorgt für einen raschen Blutzuckeranstieg, was zu einer starken Insulinausschüttung führt. In der Folge sinkt der Blutzuckerwert schnell wieder ab – und das kann zu Heißhunger, Müdigkeit und Reizbarkeit führen. Ein dauerhaft hoher Zuckerkonsum fördert die Entwicklung einer Insulinresistenz – das bedeutet, das Insulin kann den Zucker nicht mehr effektiv in die Körperzellen transportieren, obwohl diese Energie bräuchten. Auf diese Weise kann sich ein Typ-2-Diabetes entwickeln. Darüber hinaus lässt Zucker den Körper schneller altern, da er wichtige Eiweißstrukturen (Proteine) im Gewebe verklebt (Stichwort: Glykierung). Zudem begünstigt er Entzündungsprozesse im Körper. Auch das Mikrobiom im Darm leidet unter einem zu hohen Zuckerkonsum: Die Vielfalt der Darmbakterien nimmt ab, und entzündungsfördernde Keime werden begünstigt. Das kann unter anderem zur Entstehung eines sogenannten „Leaky Gut“ beitragen – also eines durchlässigen Darms, bei dem schädliche Stoffe unkontrolliert in den Körper gelangen und dort Entzündungen auslösen.
Ein weiteres Problem: Zucker wirkt im Gehirn wie ein Suchtmittel. Im Belohnungszentrum wird Dopamin ausgeschüttet – ähnlich wie bei Alkohol oder Nikotin. Besonders Kinder sind anfällig – ein hoher Zuckerkonsum in den ersten Lebensjahren prägt das Essverhalten oft dauerhaft negativ. Zudem bleibt Zucker eine Hauptursache für Karies – vor allem durch ständigen Konsum über den Tag verteilt. Freier Zucker ist zwar kein Gift, wenn er in kleinen Mengen konsumiert wird. Aber er ist problematisch, weil er in der Natur so konzentriert, nicht vorkommt – und weil er in zahllosen Lebensmitteln versteckt ist. Typische Quellen für versteckten Zucker sind: Softdrinks, Energydrinks, Fruchtsäfte, – Fruchtjoghurts, Quarkspeisen, Cerealien, Fertigsoßen, Ketchup, Salatdressings und sogar deftige Produkte wie eingelegtes Gemüse, saure Gurken, Müsliriegel oder Vitamin-Gummis
Gibt es dann überhaupt Zuckerarten, die man bedenkenlos konsumieren kann?
Ich bin eine Anhängerin natürlicher Süße. Glycin ist eine süß schmeckende Aminosäure, die nicht nur süßt, sondern auch positiv auf das Gehirn und den Schlaf wirkt und für den Kollagenaufbau gebraucht wird. Auch Inulin, Yaconwurzelpulver sowie natürliche Gewürze wie Zimt, Vanille oder Kakao sind empfehlenswert – ebenso getrocknete Früchte wie Datteln oder Trockenpflaumen, die neben ihrer Süße auch Ballaststoffe und Mikronährstoffe liefern.
Wie sieht das bei Honig aus?
Honig gilt zwar als „natürlich“, ist aber in größeren Mengen ebenfalls problematisch, da er sehr süß ist und einen hohen Fruktoseanteil enthält.
Häufig ist auch von intelligenten Zuckern als Alternative die Rede. Was steckt dahinter?
Als sogenannte „intelligente Zucker“ gelten Tagatose und Galactose: Tagatose ist zahnpflegend, kann die Darmflora stärken und senkt den glykämischen Index der gemeinsam eingenommenen Mahlzeit. Galactose kommt natürlicherweise in der Muttermilch vor und kann durch Fermentation aus Maisstärke gewonnen werden. Galactose hilft beim Aufbau von Gehirnzellen, verbessert deren Kommunikation und versorgt vor allem demente Zellen, die oft eine Insulinresistenz aufweisen, mit Energie – denn Galactose kann insulinunabhängig verwertet werden. Auch die Schleimhäute profitieren: Es wird mehr Schleim produziert, was etwa für den Darm- und Atemwegsschutz von Vorteil ist. Darüber hinaus gibt es Forschungen, die nahelegen, dass diese Zuckerarten sogar in der Krebstherapie eine unterstützende Rolle spielen könnten. Auch Allulose – ein seltener Zucker – zeigt vielversprechende Wirkungen. Sie kann antientzündlich wirken, den Blutzuckerspiegel kaum beeinflussen und positiv auf die Gehirnfunktion wirken sowie die Leber schützen.
Welche Fette sind gut?
Fette sind ein essenzieller Bestandteil unserer Ernährung. Sie sorgen nicht nur für Sättigung und dienen als Geschmacksträger, sondern sind auch notwendig für die Aufnahme fettlöslicher Vitamine wie Vitamin A, D, E und K. Dabei kommt es jedoch entscheidend auf die Qualität der Fette an. Gesunde Fette enthalten überwiegend einfach oder mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die sich positiv auf den Stoffwechsel auswirken, den LDL-Cholesterinspiegel senken, die Zellmembranen geschmeidig halten und das Herz-Kreislauf-System schützen. Solche hochwertigen Fette finden sich unter anderem in Olivenöl, Rapsöl, Avocados, Nüssen und Samen.
Besonders wertvoll sind die Omega-3-Fettsäuren, vor allem EPA und DHA, die in fettem Seefisch wie Lachs, Makrele oder Hering sowie in Algenöl enthalten sind. Diese wirken entzündungshemmend, blutdruckregulierend, triglyceridsenkend, fördern die Durchblutung, unterstützen die Funktion von Herz, Gehirn und Gefäßen – und gelten sogar als lebensverlängernd, da sie das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und andere chronische Erkrankungen reduzieren können. Pflanzliche Omega-3-Quellen wie Leinsamen, Walnüsse oder Chiasamen enthalten Alpha-Linolensäure (ALA), die im Körper erst in die wirksameren Formen EPA und DHA umgewandelt werden muss – ein Prozess, der nur zu etwa fünf Prozent effizient abläuft.
Welche Fette sollte man lieber meiden und warum?
Problematisch sind dagegen ungesunde Fette, insbesondere Transfettsäuren und industriell gehärtete Fette, wie sie in vielen stark verarbeiteten Lebensmitteln, Snacks und Fertigbackwaren vorkommen. Diese Fette fördern chronische Entzündungen, können die Insulinsensitivität verschlechtern und erhöhen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auch ein Übermaß an Omega-6-Fettsäuren – wie sie in Sonnenblumen- oder Maiskeimöl vorkommen – kann kritisch sein, da ein ungünstiges Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 (wie es in der westlichen Ernährung oft der Fall ist) das Entzündungsgeschehen im Körper verstärken kann. Ideal wäre ein Verhältnis von 1:1 bis 1:5, tatsächlich liegt es jedoch häufig bei 1:10 bis 1:20.
Wie sieht das bei Butter aus?
Gesättigte Fette, wie sie in Butter, Käse, Fleisch oder Kokosöl vorkommen, sind in moderaten Mengen unbedenklich, solange sie Teil einer natürlichen, abwechslungsreichen Ernährung sind. Anders sieht es bei stark verarbeiteten Produkten wie Wurstwaren oder frittierten Speisen aus, die meist ungünstige Fettkombinationen enthalten und gemieden werden sollten.
Welche Öle sind gut zum Braten geeignet?
Beim Erhitzen von Ölen ist der sogenannte Rauchpunkt entscheidend. Dieser gibt an, bis zu welcher Temperatur ein Öl hitzestabil bleibt, ohne sich zu zersetzen und gesundheitsschädliche Stoffe zu bilden. Wird ein Öl über seinen Rauchpunkt erhitzt, entstehen dabei schädliche Substanzen wie Acrylamid, Acrolein und freie Radikale. Gleichzeitig gehen Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe verloren. Ein hoher Rauchpunkt liegt bei etwa 230 Grad Celsius – ein Beispiel dafür ist raffiniertes Rapsöl. In der kaltgepressten Form ist Rapsöl dagegen nicht hitzestabil und daher nicht zum Braten geeignet.
Zum Braten geeignet sind auch Sonnenblumenöl (raffiniert), Ghee (geklärte Butter) oder Avocadoöl (hat einen sehr hohen Rauchpunkt von ca. 250 °C). Ein besonders empfehlenswertes Öl für das schonende Braten bei mittleren Temperaturen ist natives Olivenöl extra (extra vergine). Es wird kalt gepresst und enthält Polyphenole, die antioxidativ und entzündungshemmend wirken – ideal für die mediterrane Küche.
Mit welchen Ölen sollte man lieber nicht braten?
Nicht geeignet zum Erhitzen sind hitzelabile Öle wie: Leinöl, Kürbiskernöl, Walnussöl oder Hanföl. Diese empfindlichen Öle sollte man nicht erhitzen, sondern ausschließlich kalt verwenden, z. B. für Salate, Dips oder zum Verfeinern von Speisen.
Viele Menschen leiden unter Blähungen. Woran liegt das?
Blähungen sind weit verbreitet und können viele Ursachen haben. Zunächst sollte man herausfinden, was genau dahintersteckt. Häufig handelt es sich um Unverträglichkeiten oder Allergien – etwa eine Laktoseintoleranz, eine Fruktosemalabsorption, eine Sorbitunverträglichkeit, Glutensensitivität oder eine sogenannte FODMAP-Intoleranz. FODMAPs sind bestimmte Zuckerarten, die im Darm schlecht aufgenommen werden und dort Gärprozesse verursachen können – was zu Blähungen, Bauchschmerzen oder Durchfall führt. Dazu gehören z. B. Laktose, Fruktose, Fruktane, sowie Zuckeralkohole wie Sorbit oder Xylit.
Auch eine zu schnelle Ernährungsumstellung auf ballaststoffreiche Kost kann den Darm überfordern und vorübergehend zu Blähungen führen. Weitere Ursachen sind zu hastiges Essen, bei dem viel Luft geschluckt wird, oder eine veränderte Darmflora durch Arzneimittel, insbesondere Antibiotika. Zusätzlich spielen Stress, Bewegungsmangel, schlechter Schlaf, industriell verarbeitete Lebensmittel, Pestizide und Mikroplastik eine Rolle bei der Entstehung von Verdauungsbeschwerden. Auch Zuckeralkohole wie Xylit oder Sorbit, die häufig in Light-Produkten enthalten sind, können Blähungen verursachen, da sie im Dickdarm fermentiert werden. Verstopfung kann ebenfalls zu Gasansammlungen und Gärungsprozessen führen.
Was kann gegen Blähungen dann helfen?
Um Blähungen zu lindern, empfiehlt es sich, langsam zu essen, gründlich zu kauen, regelmäßig zu trinken und sich täglich zu bewegen – insbesondere nach dem Essen, um die Verdauung anzuregen. Auch Magnesium kann helfen, da es die Muskulatur des Darms entspannt. Wichtig ist, die Zufuhr von Ballaststoffen langsam zu steigern und sich das Ziel von etwa 30 Gramm pro Tag zu setzen. Ebenso hilfreich ist es, etwa 30 verschiedene Pflanzenarten pro Woche in die Ernährung einzubauen – also eine bunte Vielfalt an Gemüse, Obst, Kräutern, Hülsenfrüchten, Vollkorn und Nüssen.
Zu Beginn können blähende Lebensmittel wie Zwiebeln, Kohlarten, Knoblauch, Rohkost, Früchte und Bierhefe gemieden werden. Nach einer gewissen Eingewöhnungszeit werden sie meist wieder besser vertragen. Gut verträglich sind Akazienfasern, die die Darmflora stärken, ohne stark zu blähen. Auch grobe Körner in Vollkornprodukten können zunächst durch Haferflocken oder Hirse ersetzt werden.
Welche Hausmittel empfehlen Sie?
Hausmittel gegen Blähungen wie Fenchel-, Anis- oder Kümmeltee, aber auch Pfefferminz- und Ingwertee, eine Wärmflasche oder eine Bauchmassage können wohltuend wirken.
Wie kann man die Darmflora wieder stärken?
Zur Stärkung der Darmflora sind probiotische Lebensmittel wie Joghurt, Kefir, Sauerkraut, Kimchi oder fermentiertes Gemüse geeignet. Diese enthalten lebende Bakterien. Ergänzend dazu fördern präbiotische Lebensmittel – also „Futter“ für gute Darmbakterien – ein gesundes Mikrobiom. Dazu gehören Wurzelgemüse, Bittersalate, erkaltete Kartoffeln, Flohsamenschalen, Leinsamen, Chiasamen, Pilze, Haferkleie, Akazienfasern und vieles mehr.
Was macht der Arzt?
Wenn die Beschwerden länger anhalten oder sehr stark sind, sollte eine Stuhlanalyse durchgeführt werden – etwa zur Abklärung von Parasiten oder Helicobacter pylori. Auch eine Magen-Darm-Spiegelung kann sinnvoll sein. Therapeutisch kommen je nach Ursache Entschäumer, Verdauungsenzyme oder bei Bedarf Laktasepräparate zum Einsatz. Bei bakterieller Fehlbesiedlung (SIBO) kann auch eine antibiotische Behandlung erforderlich sein.
Wer unter einem Reizdarmsyndrom leidet, kann zusätzlich von Hypnosetherapie, Psychotherapie, Meditation, Stressbewältigung und regelmäßiger Bewegung profitieren. Insgesamt gilt: achtsames Essen, eine vielfältige, pflanzenbasierte Ernährung, genügend Bewegung, guter Schlaf und der bewusste Umgang mit Stress sind die besten Voraussetzungen für eine gesunde Verdauung – und gegen lästige Blähungen.
Welche Nahrungsergänzungsmittel sind im Hinblick auf Anti-Aging empfehlenswert?
Die Wirkung vieler Nahrungsergänzungsmittel im Bereich Anti-Aging ist bisher noch nicht umfassend wissenschaftlich belegt, doch es gibt einige Substanzen, die als vielversprechend gelten und auch von Anti-Aging-Mediziner:innen selbst gerne verwendet werden. Dazu zählt Alpha-Ketoglutarat, ebenso wie Spermidin, das besonders durch seine Wirkung auf die Zellreinigung (Autophagie) bekannt ist. Spermidin soll dabei helfen, Demenz vorzubeugen, die Mitochondrien zu schützen, die Telomere zu verlängern, das Immunsystem zu stärken, die Gehirnleistung zu verbessern und insgesamt zellverjüngend zu wirken.
Auch andere Stoffe werden im Zusammenhang mit gesunder Zellalterung genannt, darunter Resveratrol, Taurin, exogene Ketone, Kreatin sowie Coenzym Q10, das die ATP-Produktion in den Mitochondrien unterstützt – also die Energieversorgung in den „Kraftwerken“ unserer Zellen. Besonders viel Aufmerksamkeit erhalten außerdem NAD, NADH und NMN (letzteres ist nur in den USA als offizielles Nahrungsergänzungsmittel frei erhältlich), auch bekannt als Coenzym 1. Diese Verbindungen sollen die zelluläre Energieproduktion erhöhen und die sogenannten Langlebigkeitsenzyme wie die Sirtuine aktivieren, die für Reparaturprozesse und gesunde Zellfunktion wichtig sind.
Darüber hinaus gelten auch Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D3, Kollagen sowie grüner Tee und Matcha-Pulver als empfehlenswerte Ergänzungen – vor allem wegen ihrer entzündungshemmenden, gefäßschützenden und antioxidativen Eigenschaften. Trotzdem bleibt klar: Die wirksamste Grundlage für gesundes Altern ist nicht ein einzelnes Präparat, sondern eine pflanzenbasierte, bunte Ernährung, ausreichend hochwertiges Eiweiß, tägliche Bewegung, erholsamer Schlaf und liebevolle soziale Kontakte. All diese Faktoren wirken nachweislich lebensverlängernd – ganz ohne Kapsel.
*Wir arbeiten in diesem Beitrag mit Affiliate-Links. Wenn ihr über diese Links ein Produkt kaufen, erhalten wir vom Anbieter eine Provision. Für euch entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo und wann ihr ein Produkt kauft, bleibt natürlich euch überlassen.