Eine primäre KopfschmerzerkrankungGesundheitslexikon: Cluster-Kopfschmerz (Cluster Headaches)
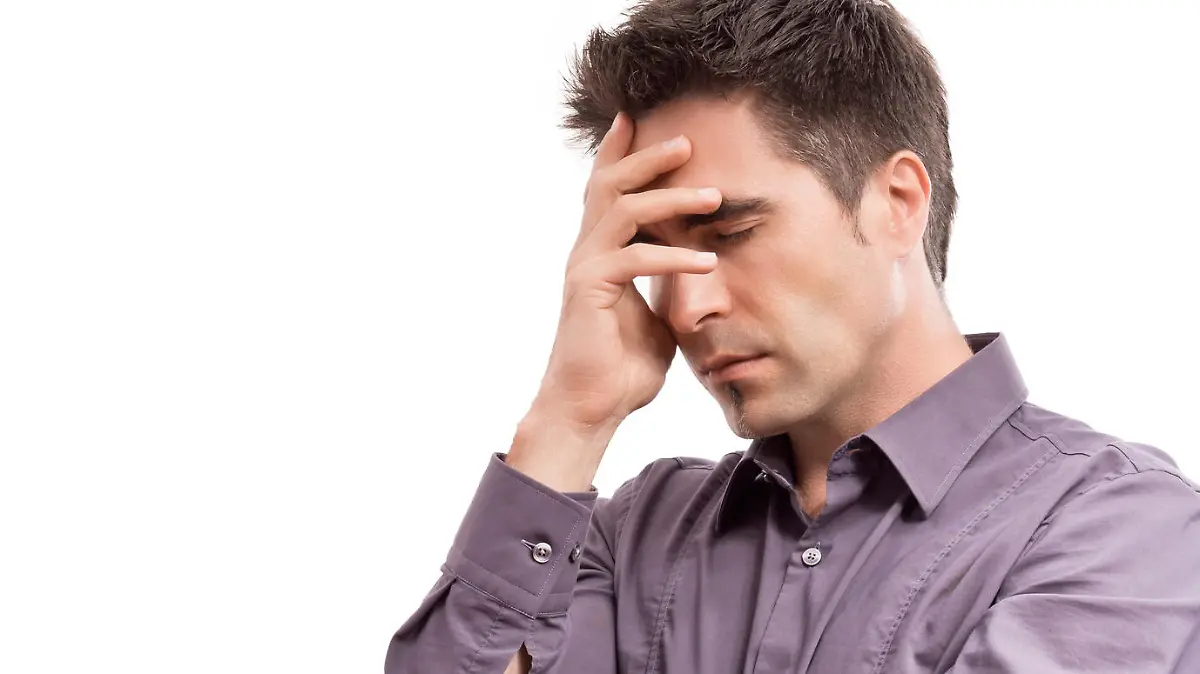
Der Cluster-Kopfschmerz, der auch als Bing-Horton-Syndrom bekannt ist, kann Menschen jedes Geschlechts und Alters treffen. In Deutschland sind circa 120.000 Menschen betroffen - vor allem Männer zwischen 20 und 40 Jahren. Insbesondere die Menschen, die sehr oft von Cluster-Kopfschmerzen ereilt werden, können durch die Häufigkeit und Stärke des Schmerzes eine Depression entwickeln.
Was ist der Cluster-Kopfschmerz?
Beim Cluster-Kopfschmerz handelt es sich um intensive Kopfschmerzattacken, die auf einer Seite auftreten. Viele Betroffene beklagen eine verminderte Lebensqualität, die aus den immer wiederkehrenden Kopfschmerzen resultiert. Die zeitlichen Abstände zwischen den Anfällen variieren von Mensch zu Mensch. Teilweise können mehrere Monate zwischen den Episoden liegen - bei anderen Personen machen sich die Schmerzen fast täglich bemerkbar. Die Dauer einer Attacke dauert meistens zwischen 15 und 180 Minuten. Dies kann sich auch mehrmals pro Tag wiederholen. Schulmediziner gehen von einer genetischen Disposition aus, da bei etwa zwei bis sieben Prozent aller Erkrankten eine Häufung des charakteristischen Kopfschmerzes in der Familie festzustellen ist.
Ursachen und Symptome
Die Auslöser für den Cluster-Kopfschmerz sind der Schulmedizin weitestgehend unbekannt. Generell wird angenommen, dass das Krankheitsbild einer Dysfunktion biologischer Rhythmen zugrunde liegt. Dies wird dadurch begründet, dass die Schmerzen zumeist in den Morgenstunden, unmittelbar nach dem Einschlafen, im Frühling und im Herbst vorkommen. Zudem wurde in zahlreichen Studien belegt, dass Cluster-Kopfschmerz-Patienten eine verstärkte Aktivität im Bereich des Hypothalamus aufweisen. Auch externe Einflüsse - beispielsweise Nikotin, Alkohol, Käse oder Schokolade - können die Symptomatik intensivieren. Flimmerlicht, gefäßerweiternde Medikamente und Sport können den Cluster-Kopfschmerz ebenfalls begünstigen. Neben dem starken, einseitigen Schmerz kann der Cluster-Kopfschmerz mit anderen Symptomen einhergehen, zum Beispiel mit tränenden und geröteten Augen, Lidschwellungen oder einer laufenden Nase. Auch die Bildung von Schweiß auf der Stirn ist möglich.
Diagnose von Cluster-Kopfschmerz
Die Feststellung von Cluster-Kopfschmerz kann in der hausärztlichen Praxis oder im stationären Rahmen erfolgen. Eine ausgiebige Anamnese ist von größter Bedeutung - allein daran kann der Schulmediziner erkennen, ob es sich um den spezifischen Kopfschmerz handelt. Die Diagnose erfolgt auf rein klinischer Ebene. Neben der Befragung unterzieht sich der Patient einer Überprüfung der Licht- und Muskelreflexe. Anhand der genauen Ergebnisse kann der Arzt ermitteln, ob ein Cluster-Kopfschmerz vorliegt. Bei keiner klar erkennbaren Diagnose kann auch eine Kernspintomografie des Gehirns erfolgen. Hierbei können etwaige andere Krankheitsbilder, beispielsweise Tumore, ausgeschlossen werden.
Therapie und Vorbeugung
In den meisten Verläufen gestaltet sich die Behandlung von Cluster-Kopfschmerz kompliziert. Dies liegt daran, dass sich zwar die Symptome mithilfe diverser Schmerzmittel, die auch zur Behandlung anderer Kopfschmerzen eingesetzt werden, lindern lassen, die Ursache sich aber kaum behandeln lässt. Eine tatsächliche Heilung ist (bisher) unmöglich. Neben der medikamentösen, schmerzlindernden Behandlung sind auch alternative Methoden möglich: Hierzu gehören Akupunktur, Biofeedback und Entspannungsübungen. Diese Methoden helfen aber nur den wenigsten Betroffenen. Dem Cluster-Kopfschmerz lässt sich - aus schulmedizinischer Perspektive - nicht vorbeugen. Generell können aber regelmäßige Entspannungsübungen und die Vermeidung externer Noxen dazu beitragen, die Symptome einzudämmen.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel kann einen Besuch beim Arzt nicht ersetzen. Er enthält nur allgemeine Hinweise und darf daher keinesfalls zu einer Selbstdiagnose oder Selbstbehandlung herangezogen werden.