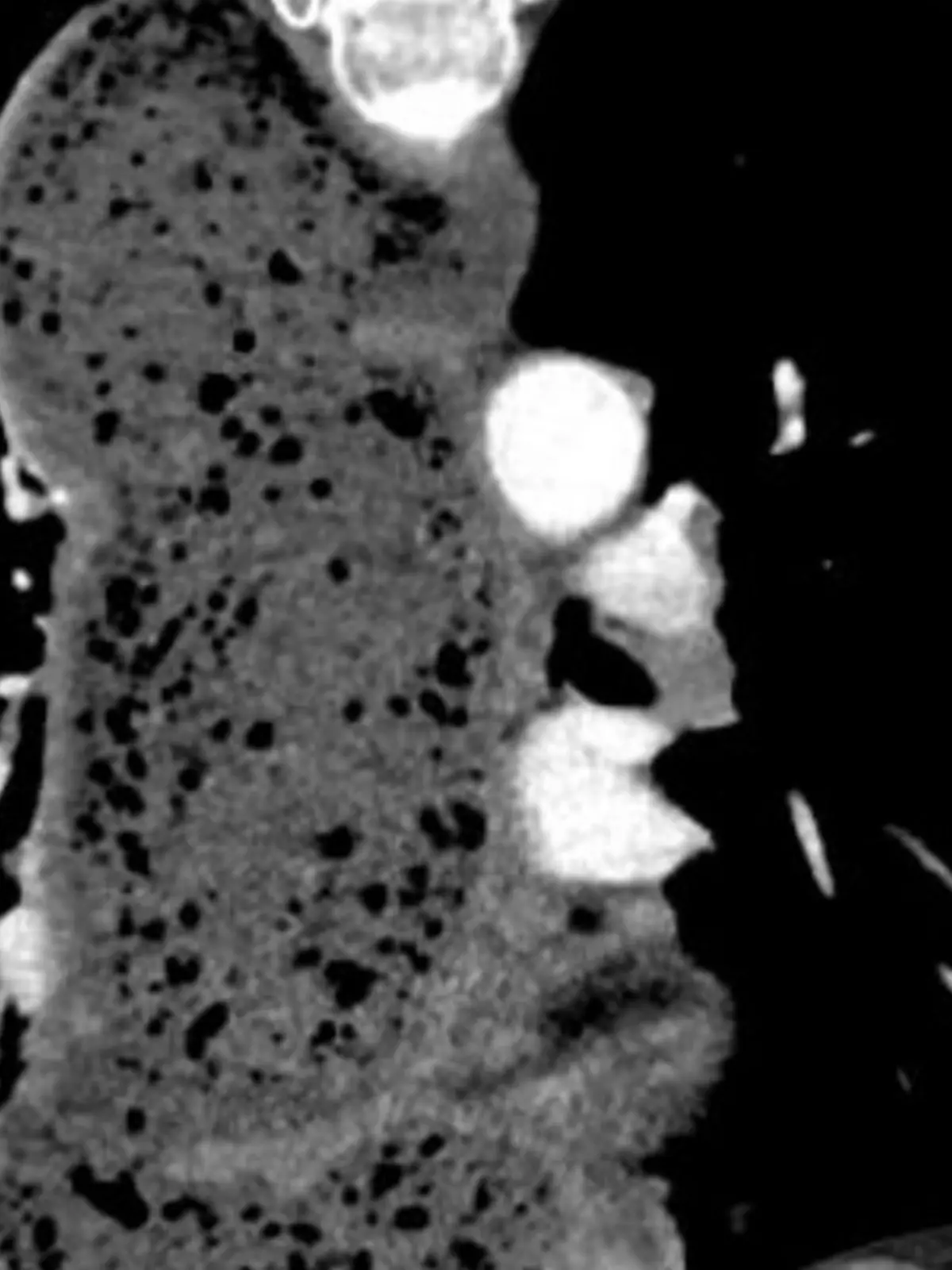Schmetterlingskind MathildaUnheilbarer Gendefekt: Eltern dürfen ihr Baby nicht umarmen

Es ist unfassbares Leid, das man im Gespräch mit Daniel Kenst spürt. Er und seine Lebensgefährtin Carolin Ortmaier sind die Eltern der kleinen Mathilda. Das erst sechs Monate alte Baby leidet an Epidermolysis bullosa dystrophica, einer blasenförmigen Ablösung der Haut. Mathilda ist ein sogenanntes Schmetterlingskind, ihre Haut ist so empfindlich wie die Flügel eines Schmetterlings. Mathildas Eltern wollen auf die Krankheit aufmerksam machen und so die Chancen auf mehr Forschung und mögliche Heilung erhöhen.
Erschütternde Diagnose am dritten Tag nach der Geburt

Die Geburt der kleinen Mathilda im Juli 2022 war für ihre Eltern einer der glücklichsten Momente in ihrem Leben. Doch das Glück währte nicht lang – bereits nach wenigen Stunden tauchten am Körper des Säuglings erste Auffälligkeiten auf, die kleine Mathilda hatte Hautfetzen im Mund und Blasen am Fingernagel. Am nächsten Tag hatten sich auch am Rücken große Blasen gebildet. Am dritten Tag dann die erschütternde Diagnose: Das Baby leidet an Epidermosysis Bullosa, der Schmetterlingskrankheit. Was sich so harmlos anhört, ist unheilbar, ein sehr seltener Gendefekt. „Wir fühlen uns, als hätten wir am Tag der Geburt eingeatmet und konnten bis jetzt nicht ausatmen“, beschreibt der gelernte Kinderpfleger Daniel Kenst seine Gefühle im Gespräch mit RTL.
Kein Kuscheln, kein Streicheln - alles verursacht große Schmerzen

Vier Monate nach der Geburt die nächste Hiobsbotschaft. Mathilda hat die schlimmste Form der Schmetterlingskrankheit, der Epidermolysis Bullosa dystrophica. Die Hautkrankheit betrifft nicht nur die äußeren Hautschichten, sondern auch die inneren Schleimhäute. Betroffene leiden starke Schmerzen. Weil Baby Mathilda ständig Wunden hat, die schlecht verheilen, ist außerdem das Hautkrebsrisiko deutlich erhöht. Auch besteht die Möglichkeit, dass sie erblindet. Die meisten betroffenen Kinder sind spätestens ab dem vierten bis fünften Lebensjahr auf einen Rollstuhl angewiesen, weil ihre Zehen verwachsen und sie nicht mehr laufen können.
Schon jetzt sind erste Anzeichen zu erkennen, dass sich auch Mathildas Finger verformen und zusammenwachsen, schildert ihr Vater Daniel Kenst mit tränenerstickter Stimme. „Unser Leben hat sich komplett verändert, es gleicht einem Kampf gegen Windmühlen, man kann die Krankheit nicht stoppen, nicht heilen, man kann allenfalls Linderung betreiben. Wir können Mathilda nicht richtig drücken, sie nicht streicheln, alles verursacht große Schmerzen.“
Als würde man Glasscherben oder Reisnägel schlucken
Auch die Nahrungsaufnahme ist schwierig. Carolin Ortmaier kann ihre kleine Tochter nicht stillen, hierbei könnten neue Wunden entstehen. Die Zubereitung eines Fläschchens dauert zwei – vier Stunden, weil sich die Eltern immer wieder vergewissern müssen, dass ihrer Kleinen nichts passiert. Ältere Schmetterlingskinder, die schon beschreiben können, wie sich Essen für sie anfühlt, sagen, es sei als würde man Glasscherben oder Reißnägel schlucken. Einmal im Jahr müssen diese Kinder deshalb zu einer Speiseröhrendehnung zum Arzt. Ohne diese könnten sie nicht mehr essen. Wenn die Kinder vier oder fünf Jahre alt sind, bekommen sie zusätzliche Nahrung über eine Sonde. Die Kinder haben einen viermal höheren Kalorienbedarf als gesunde Kinder, allein die Wundheilung verbraucht sehr viel Energie.
Notärzte kannten die Krankheit nicht

Dreimal bereits hatte Mathilda einen Atemstillstand: Große Blasen im Mund verhinderten die Atmung. Die herbeigerufenen Notärzte konnten nicht helfen, weil sie die Krankheit nicht kannten, nicht wussten, wie sie Mathilda behandeln sollten. Glücklicherweise platzten die Blasen von alleine oder kollabierten in sich zusammen. Wenn das nicht geschehen wäre, Mathilda wäre erstickt.
Dass die Krankheit so selten auftritt und so wenig darüber bekannt ist, macht es schwierig für Carolin und Daniel, adäquate Hilfe zu bekommen. Das betrifft auch die Anschaffung von Spielzeug und Kleidung. Alles muss so sein, dass sich Mathilda nicht daran verletzten kann. So kann sie beispielsweise keine „normalen“ Babybodys tragen, sondern braucht spezielle Modelle aus Seide. Kleidung, wie sie Brandopfer tragen. Sie sollte möglichst weder schwitzen noch frieren in ihrer Kleidung, denn all das löst neue Blasen und damit große Schmerzen aus. Das alles kostet sehr viel Geld und belastet die junge Familie zusätzlich.
Keine Chance auf Heilung

Die Schmetterlingskrankheit gehört zu den sogenannten seltenen Erkrankungen. Nur zwei bis drei von 100.000 Menschen leiden unter dem schweren Gendefekt. Zur Zeit gibt es noch keine Chance auf Heilung.
Kurz vor Weihnachten zieht die Familie um – von Landshut nach Freilassing. Dort ist sie näher an einer Klinik in Salzburg, die sich auf die Behandlung der Schmetterlingskinder spezialisiert hat. Hier bekommen Betroffene Unterstützung in allen Lebenslagen. Wundschwestern und Ärzte beraten die Eltern zur Pflege ihrer Kinder, sie erhalten psychologische und praktische Hilfe. Das Klinikpersonal und andere betroffene Eltern, die sie dort getroffen haben, seien mittlerweile wie eine zweite Familie, sagt Kenst. Der Austausch mit anderen Betroffenen hilft dabei, sich auf das Leben mit der Krankheit einzustellen. „Es verändert Dein Leben, man muss sich von dem Leben, das man sich für sich und sein Kind erträumt hat, komplett verabschieden. Wir waren beide sehr aktiv, waren Gleitschirmflieger und sind auf Berge gestiegen. Das wollten wir mit unserem Kind unternehmen. Doch jetzt gibt es ein neues Leben. Das gilt es zu entdecken.“
Jetzt erst recht!
Es falle schwer zuzusehen, wie das eigene Kind leidet, sagt Kenst. Aber es gäbe so viele Kinder, die gerettet werden müssen. Deshalb sei es so wichtig, die Krankheit bekannter zu machen, dafür zu sorgen, dass weiter geforscht wird an Therapien und möglichst auch Heilungschancen. Doch weil die Krankheit so selten ist, wird wenig Geld und Zeit in die Forschung gesteckt.
Carolin ist Grundschullehrerin in Elternzeit, Daniel ist Kinderpfleger und Rettungssanitäter. Beide widmen sich nun allerdings in Vollzeit der Pflege ihrer kleinen Tochter. Ohne die große – auch finanzielle – Unterstützung von Freunden und Verwandten würde es die kleine Familie kaum schaffen. Private Initiativen wie der Verein via-humanity in Regensburg kümmern sich darum, Spenden zu sammeln, damit Kindern wie Mathilda bald geholfen werden kann.
Auf der Spendenseite appellieren Mathildas Eltern im Namen ihrer kleinen Tochter: „Bitte spendet für die DEBRA AUSTRIA, das EB-Haus in Salzburg, aber auch an Fachkliniken wie Hannover und Freiburg oder die DEBRA Deutschland. Macht bitte diese Krankheit bekannt, damit Kinder wie ich nicht so früh und qualvoll sterben müssen.“
Doch gleichzeitig sei Mathilda „sehr lustig drauf und lache, quatsche mit Mama und Papa viel. Carolin Ortmaier und Daniel Kenst versuchen, Mut und Hoffnung nicht zu verlieren: „Wir sagen uns: Jetzt erst recht! Wir haben nicht viel Zeit. Wir wissen nicht, ob es ein Morgen für unsere Tochter gibt. Man kämpft und hofft auf die Forschung.“