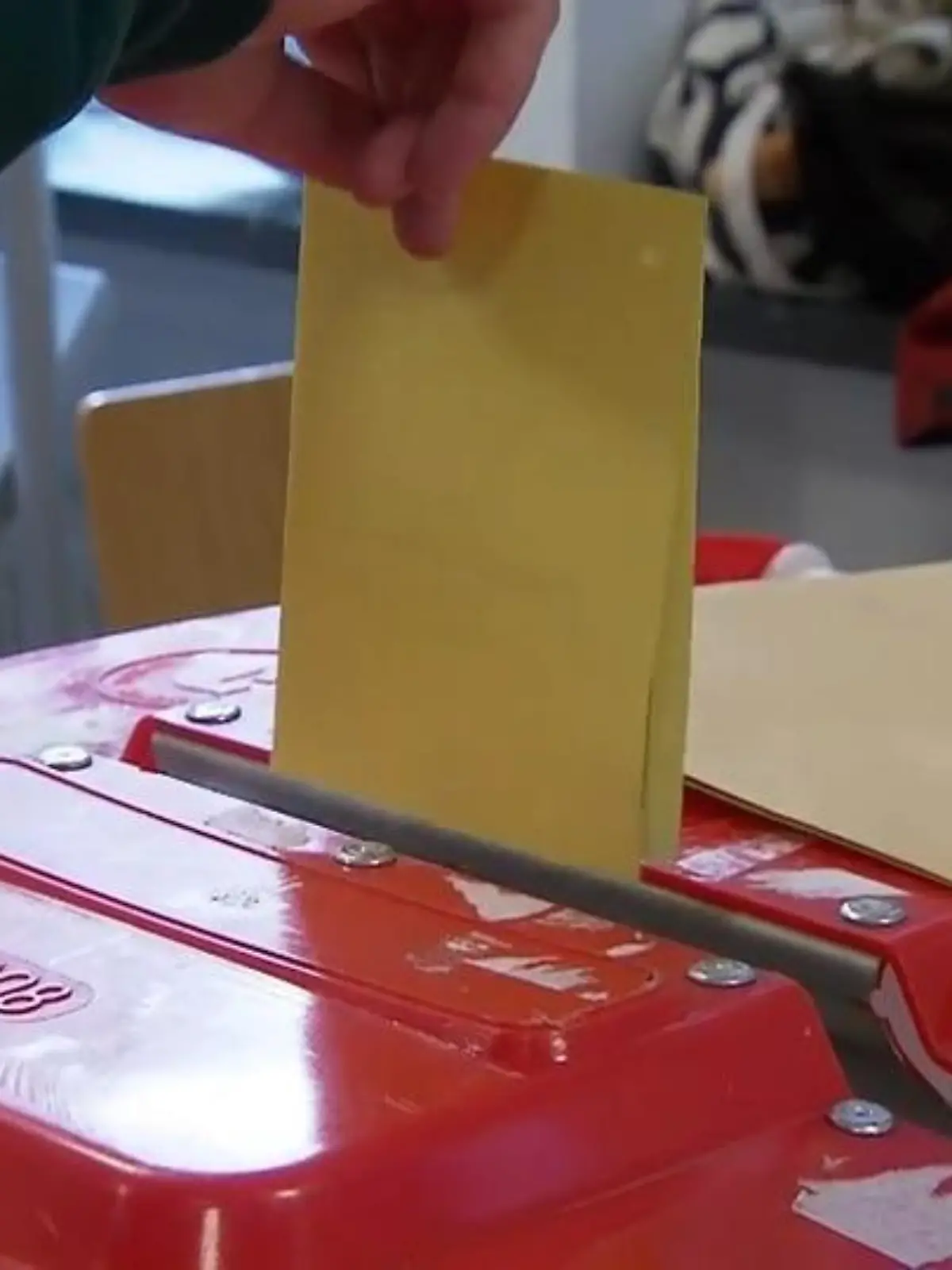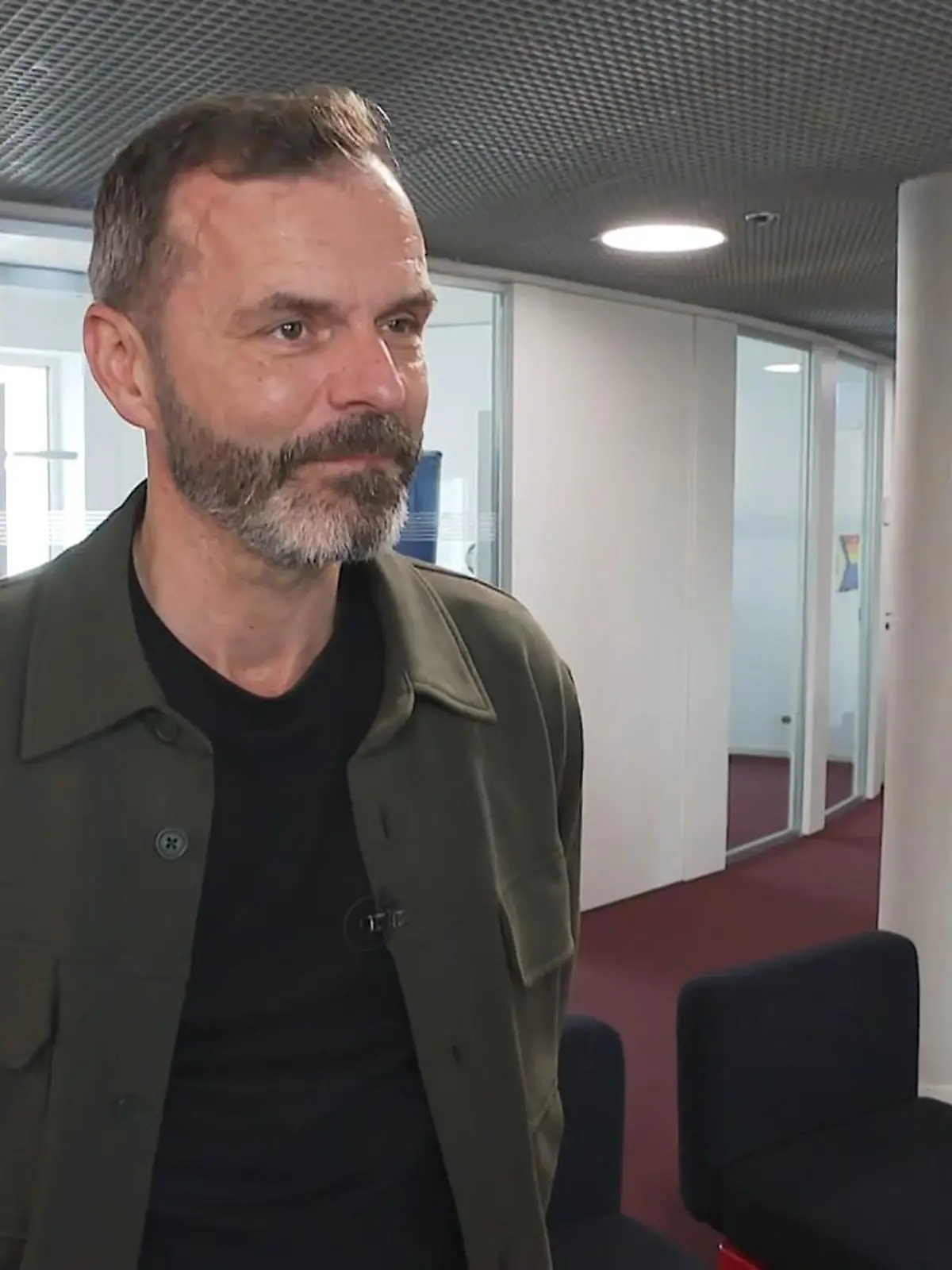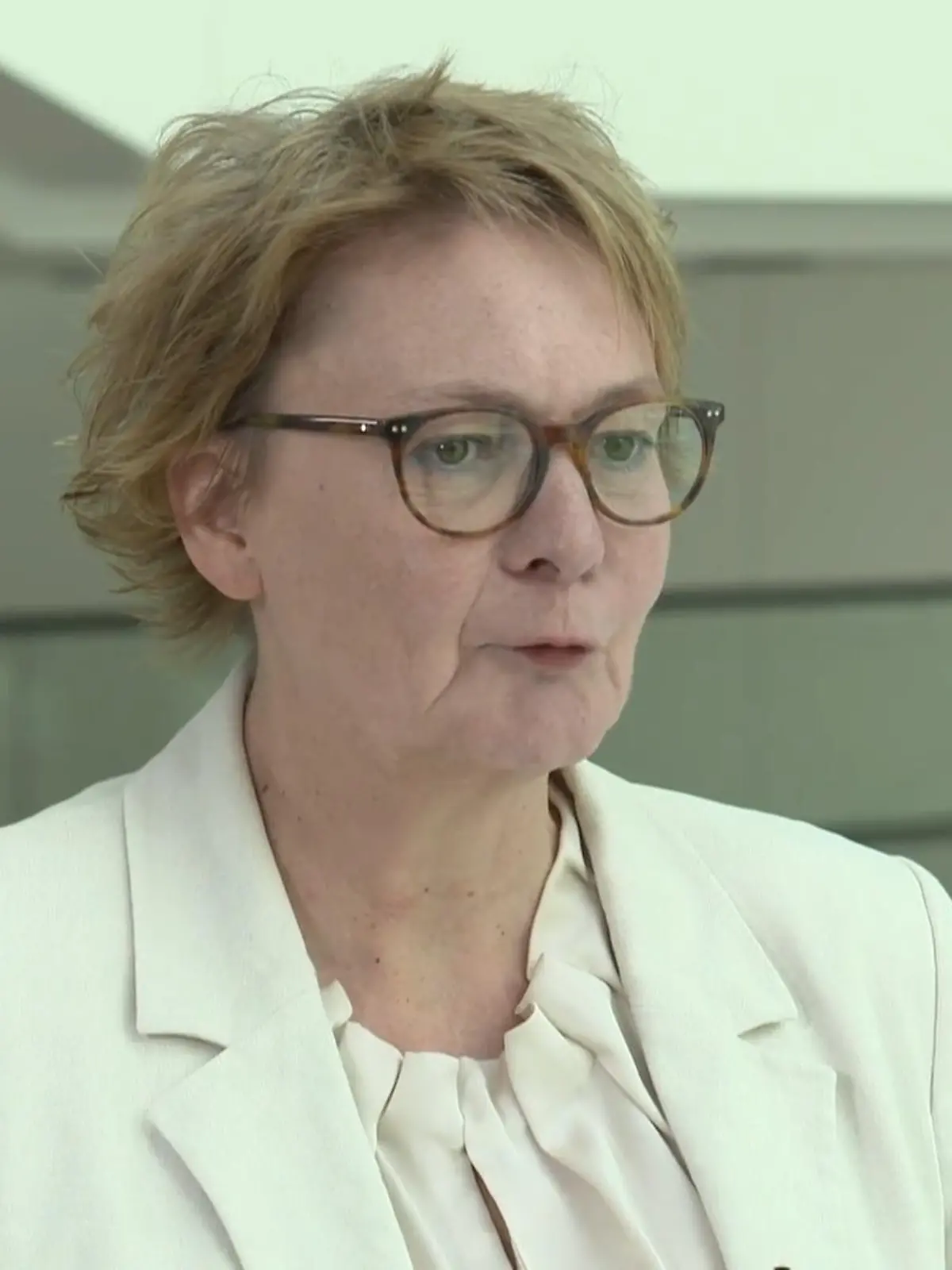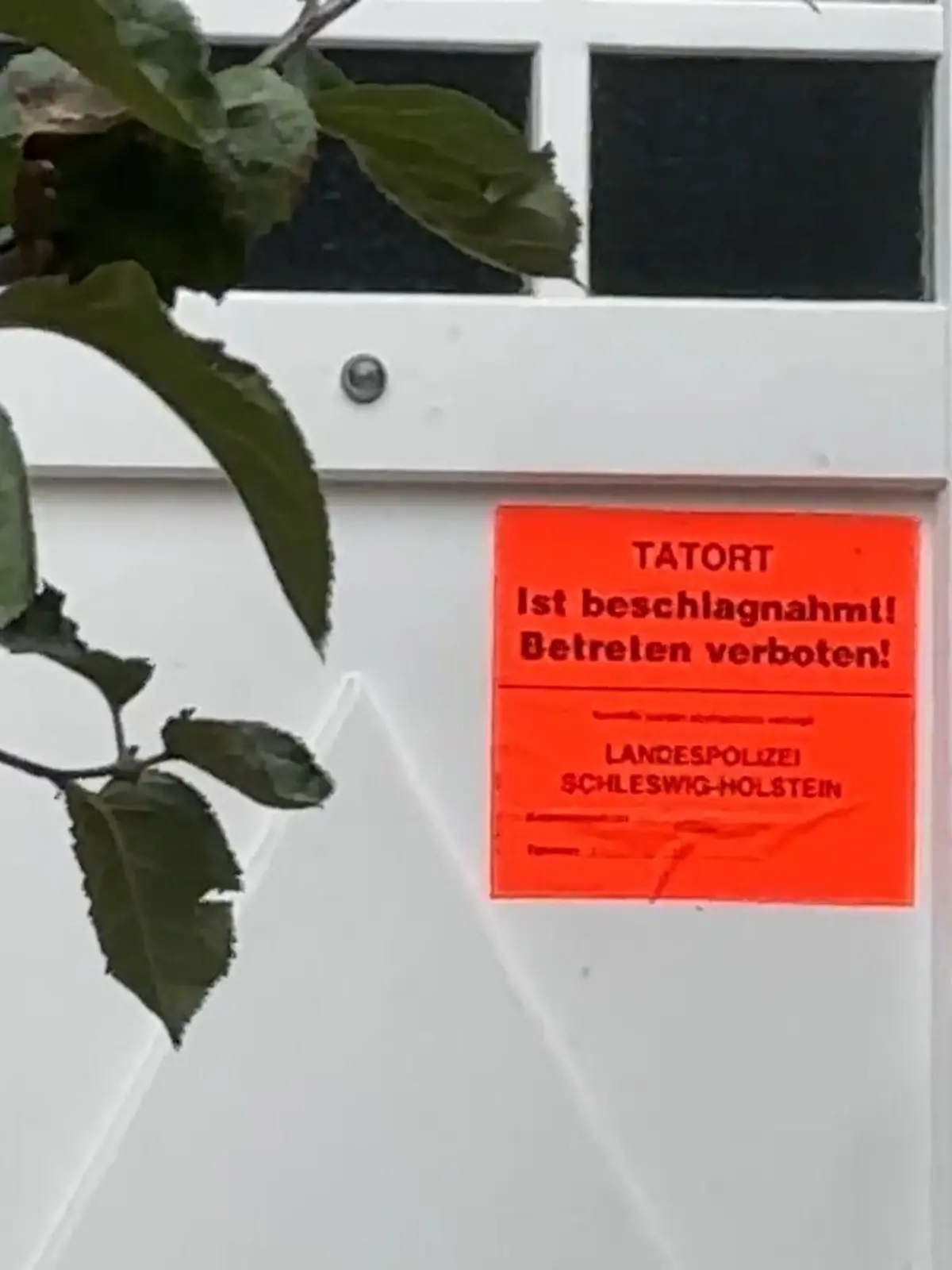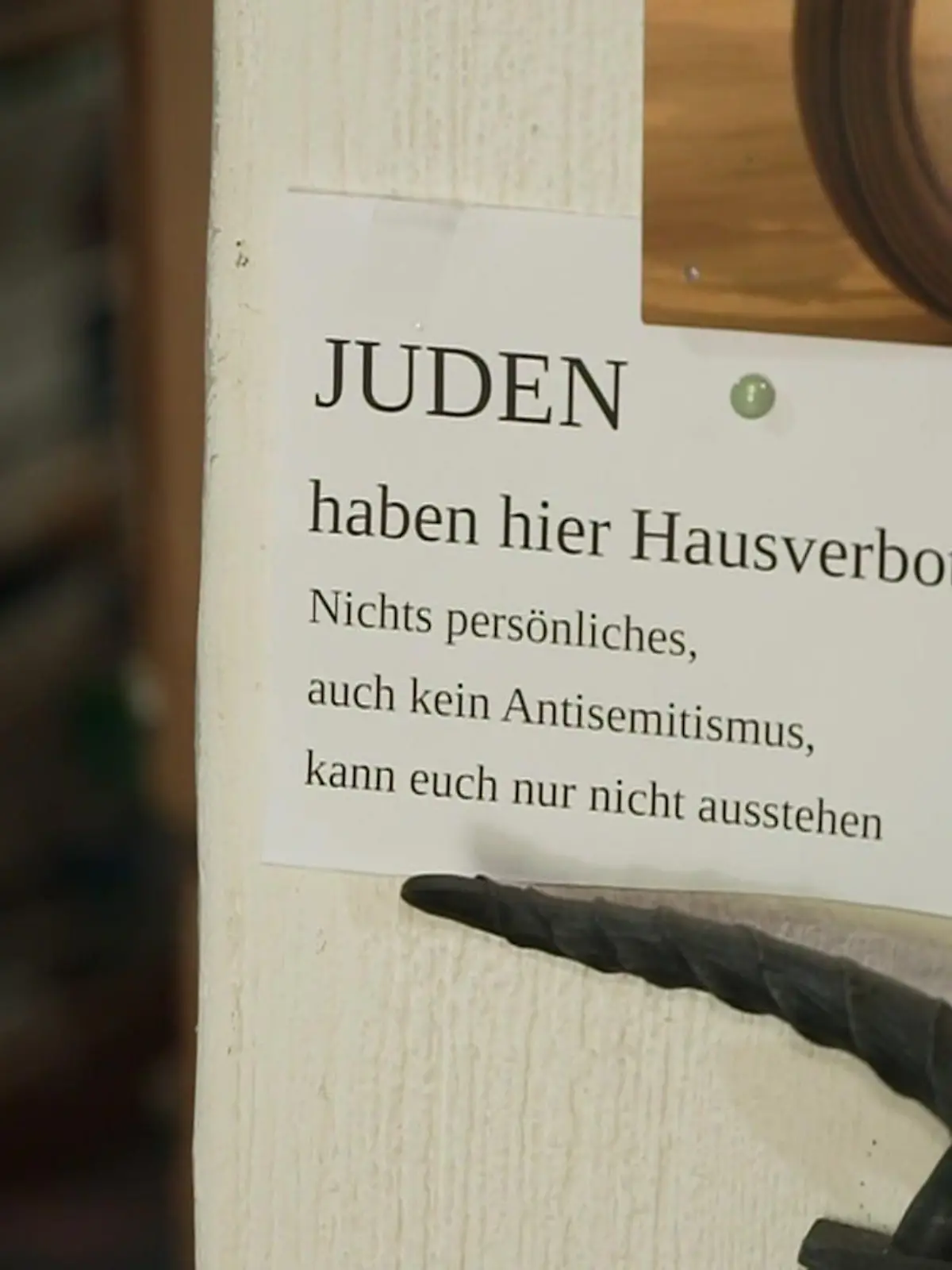Die Debatte um die Wiedereinführung der Wehrpflicht erregt die Gemüter: Soll der Wehrdienst auf Freiwilligkeit basieren oder soll die allgemeine Wehrpflicht wieder eingeführt werden, sollen auch Frauen rekrutiert werden und wer soll eigentlich überhaupt verpflichtet werden bzw. bringt ein Losverfahren mehr Gerechtigkeit?
"Also Auslosen, finde ich keine gute Lösung. Ich denke, wenn, dann sollte es freiwillig passieren."
"Das sind Konflikte, die sehr vermeidbar sind. Und da ist die Frage: Inwiefern soll die neue Generation, die relativ wenig damit zu tun hat, tatsächlich dafür dann geradebiegen müssen?"
"Schöner wäre es natürlich, wenn es freiwillig läuft. Aber in der heutigen Zeit befürchte ich, dass es nicht funktionieren wird. Und dann wird man wahrscheinlich früher oder später wieder eine Wehrpflicht einführen müssen oder die Ausgesetzte wieder einsetzen."
Die Stimmung im Norden spiegelt, zumindest unter denen, mit denen wir heute in Hamburg sprechen, auch bundesweite Trends wider. Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage für den Stern sind 54 Prozent der Deutschen für ein verpflichtendes Wehrdienstmodell, 41 Prozent sind dagegen, 5 Prozent äußern keine Meinung.
Doch gerade junge Menschen, die von einer Pflicht betroffen wären, lehnen den Wehrdienst mehrheitlich ab.
Die meisten Befürworter einer Wehrpflicht finden sich mit 61 Prozent in der Altersgruppe 60+. Bei den 18- bis 29-Jährigen sind dagegen 63 Prozent gegen einen militärischen Pflichtdienst. Doch Militärexperten beobachten auch regionale Unterschiede.
Prof. Gary Schaal, Helmut-Schmidt-Universität
„Je betroffener man von Wehrpflicht ist, desto eher ist man dagegen (...) Der Norden ist insgesamt skeptischer in Bezug auf Wehrpflicht als der Süden. Wenn man so in den 1990 er Jahren zurückgeht, lagen die Zahlen für Wehrpflichtverweigerung im Norden immer 15 bis 20 % über denen im Süden."
Insgesamt reicht das derzeitige Interesse am Dienst oder einer Ausbildung bei der Bundeswehr nicht aus, um Deutschland wehrhaft zu machen. Frage wäre, inwiefern eine höhere Akzeptanz innerhalb der gesamten Gesellschaft realistisch ist.
Prof. Gary Schaal, Helmut-Schmidt-Universität
"Ich glaube, es gibt zwei Antworten darauf. Das eine ist: Die Bundeswehr muss als Arbeitgeber attraktiver werden. Wenn die Bundeswehr attraktiv ist, dann werden die Bürgerinnen und Bürger auch bereit sein, zur Bundeswehr zu gehen. Es gibt in Europa, in Norwegen, in Schweden tatsächlich Armeen, die sind viel akzeptierter. Also das ist sozusagen das eine. Und das Zweite ist es muss ein gesellschaftlicher Konsens sein, wie bedroht Deutschland ist und aus dem Gefühl von Bedrohung heraus so etwas Ähnliches wie ein Ethos der Bereitschaft, dass man die Demokratie in Deutschland verteidigen will, entweder mit der Waffe oder in anderen Blaulichtdiensten."
Das neue Wehrdienstgesetz soll nach Plan der Bundesregierung bereits Anfang 2026 eingeführt werden - die erste Lesung des Gesetzentwurfes im Bundestag soll in diesem Monat stattfinden- die Debatte wird also noch lange anhalten.