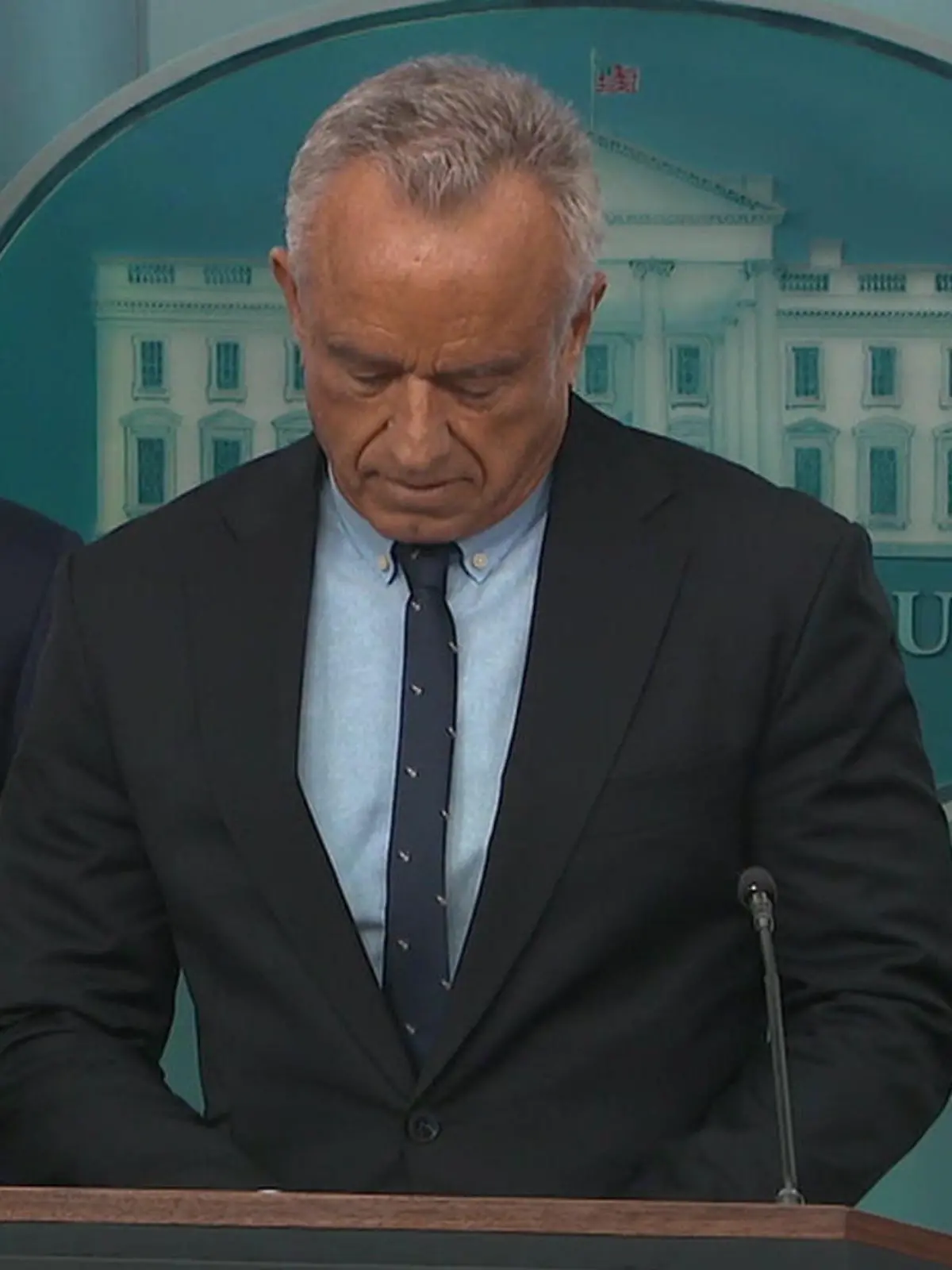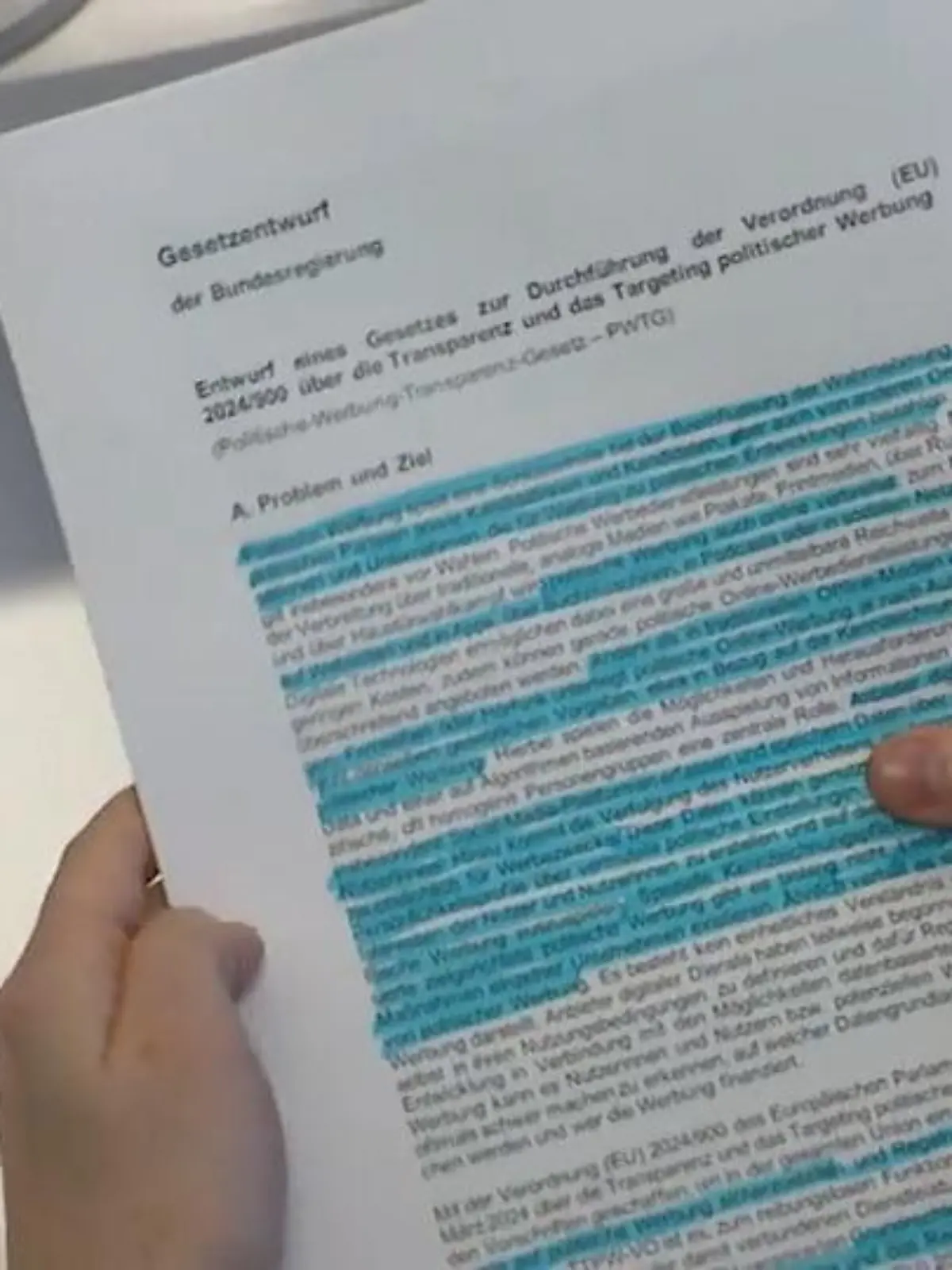Wie zwei Professoren Wohnen auf dem Land verändern wollen! Aus Einfamilienhaus mach Mehrparteienhaus - verrückte Idee oder das Wohnen der Zukunft?

Für das Wohnen der Zukunft muss nicht neu gebaut werden!
Deutschland hat Wohnungsnot, Probleme im Bausektor mit der Klimabilanz und kaum bezahlbaren Wohnraum. Für all das haben zwei Münchner Professoren eine ungewöhnliche Lösung entwickelt. Verrückt oder eine echte Chance? Die beiden haben RTL Rede und Antwort gestanden.
Das Problem
Die Bundesregierung hatte das engagierte Ziel ausgesprochen, 400.000 Wohn-Einheiten pro Jahr zu bauen. Davon ist sie weit entfernt und eine Besserung ist eher nicht in Sicht. Aber noch etwas: Beim Wohnungsbau denkt man vor allem an Städte – dabei berichteten gerade während der Corona-Pandemie viele ländliche Kommunen von einem Neubau-Boom. Die hohen Zinsen haben den aber vorerst abgewürgt.
Lese-Tipp: Villen, Apartments, Häuser: So wohnen Merkel, Spahn & Co.
Aus Einfamilienhaus mach Mehrparteienhaus: Die Idee
Ein Konzept der beiden Professoren Andreas Hild und Thomas Auer von der TU München könnte die Probleme lösen und dabei auch klimafreundlich sein. Ihre Idee hat die Bestandshäuser im Blick und will das Potenzial im ländlichen Raum nutzen. Einfamilienhäuser sollen zu Mehr-Parteien-Häusern werden!
Daraus entsteht aus Sicht der Professoren gleich eine Vielzahl an Vorteilen, wie uns Andreas Hild erklärt: „Es wird die im Altbau enthaltene Graue Energie erhalten, es entsteht weniger Müll und Abfall, es werden - im Vergleich zum Neubau - weniger oder keine zusätzlichen Flächen versiegelt.“ Übrigens: Graue Energie meint dabei die bereits aufgebrachte Energie, die man für den Bau eines Hauses braucht.
Lese-Tipp: Entwurf für Mietpreisbremse: So soll Wohnen billiger werden
Wohnen der Zukunft: Es gibt eine Chance!
Außerdem: Die Kinder der Babyboomer sind ausgezogen und in Deutschland herrscht – zumindest in den Einfamilienhäusern – oft Leerstand. Daraus ergibt sich eine Chance: Diese Bestandsfläche wäre nutzbar und würde den Vorteil mit sich bringen, dass „wichtige Infrastruktur wie Ärzte und Nahversorgung gegebenenfalls - gerade in schwach strukturierten Gegenden - erhalten bleiben“, wie Thomas Auer und Andreas Hild sagen.
In ihrem Positionspapier sprechen die beiden Professoren davon, dass Wohngebiete mehr Einheiten aufnehmen müssen, als sie es heute tun. Wie dem Positionspapier auf marlowes.de weiter zu entnehmen ist, sehen sie dazu viel Potenzial.
Dazu ist aber nicht nur ein Obergeschoss mehr nötig, die Flächen müssten deutlich erweitert werden, auch weil „eine Sanierung häufig nur in Kombination mit einem Flächenzuwachs wirtschaftlich“ wäre, wie ihrem Positionspapier weiter zu entnehmen ist. Aus Einfamilienhaus mach also Reihenhaus? „Ohne eine Verdichtung wird es nicht gehen, ohne dass wir mehr Leute auf die Flächen bekommen, werden wir unsere Probleme nicht lösen“, sagen Auer und Hild.
Es geht darum, die Wohnfläche maximal auszuweiten, ohne neu zu bauen und im Zusammenspiel mit der Bestandsfläche. Damit ist eindeutig auch gemeint, „die Eigentümer dazu zu motivieren, Wohneinheiten zu ergänzen und dabei im Idealfall den eigenen Wohnraum zu verkleinern“, wie es in dem Papier heißt.
Lese-Tipp: Leerstand trotz Wohnungsnot in Deutschland - das steckt dahinter!
Wo liegen die Nachteile?
Doch so gut das klingt, stellt sich die Frage, wo der Nachteil für Hauseigentümer liegt? Natürlich ist den beiden Professoren vollkommen klar, dass nicht jeder sein Haus mit einer weiteren Partei nach einem Umbau teilen möchte. Dafür schlagen die Beiden vor, gute Beispiele voranzustellen, die zeigen, dass eine Erweiterung des Hauses nicht zwangsläufig eine Einschränkung der Privatsphäre ist.
Und Lösungen dafür gibt es. Beispielsweise kann man etwaige Probleme „durch getrennte Eingänge und abgetrennte Außenbereiche lösen. Man muss mit guten Lösungen den Menschen die Sorge nehmen“.
Lese-Tipp: Vermieter saniert - Wie hoch darf die Miete erhöht werden?
Und wo sind die Vorteile für Hauseigentümer?
Für die Bewohner dieser Häuser hätte die Umstrukturierung des Wohnens einige Vorteile. So sprechen die beiden Professoren von nachbarschaftlichem Austausch, bei dem die untere Partei sich beispielsweise um den Garten kümmern könnte, wenn das die obere aus Altersgründen nicht mehr schafft. Auch andere Zusammenspiele sind natürlich denkbar.
Doch auch finanziell ist die sogenannte Nachverdichtung, also die engere Bewohnung von Einfamilienhaus-Gegenden ein Vorteil. Denn wer Leute bei sich einziehen lässt, der kann auch Miete verlangen oder gemeinschaftlich das Haus energetisch sanieren oder auf Solar umstellen.
Lese-Tipp: Bei zu hoher Miete nicht auf Senkung spekulieren
Ein Konzept mit Aussicht auf Verbesserung
„Offensichtlich haben viele Menschen den Wunsch vom Eigenheim im Grünen. Ein Umbau des Bestands könnte ein Ausweg sein“, so Thomas Auer. Die sogenannte Nachverdichtung, also den Ausbau von Wohnfläche auf schon bestehender Fläche bietet nicht nur dem Lebenstraum vieler Deutscher eine Perspektive, sondern ist dabei auch klimafreundlich, weil Energie und Baumaterialien eingespart werden. Zudem könnte sie für einige finanziell lukrativ sein, die ohnehin die Fläche kaum bewohnen. Und dem ländlichen Raum wäre auch geholfen.
Lese-Tipp: Abwrackprämie für alte Heizungen? Diese Fördermaßnahmen plant die Ampelregierung
Spannende Dokus und mehr
Sie lieben spannende Dokumentationen und Hintergrund-Reportagen? Dann sind Sie auf RTL+ genau richtig: Sehen Sie die Geschichte von Alexej Nawalny vom Giftanschlag bis zur Verhaftung in „Nawalny“.
Oder: Die Umstände des mysteriösen Tods von Politiker Uwe Barschel werfen auch heute noch Fragen auf. Sehen Sie auf RTL+ die vierteilige Doku-Serie „Barschel – Der rätselhafte Tod eines Spitzenpolitikers“.
Wie läuft es hinter den Kulissen von BILD? Antworten dazu gibt es in der spannenden Doku „Die Bild-Geschichte: Die geheimen Archive von Ex-Chef Kai Diekmann.“ Er hat Politiker kennengelernt, Skandale veröffentlicht und Kampagnen organisiert. Die Doku wirft einen kritischen Blick auf seine BILD-Vergangenheit.