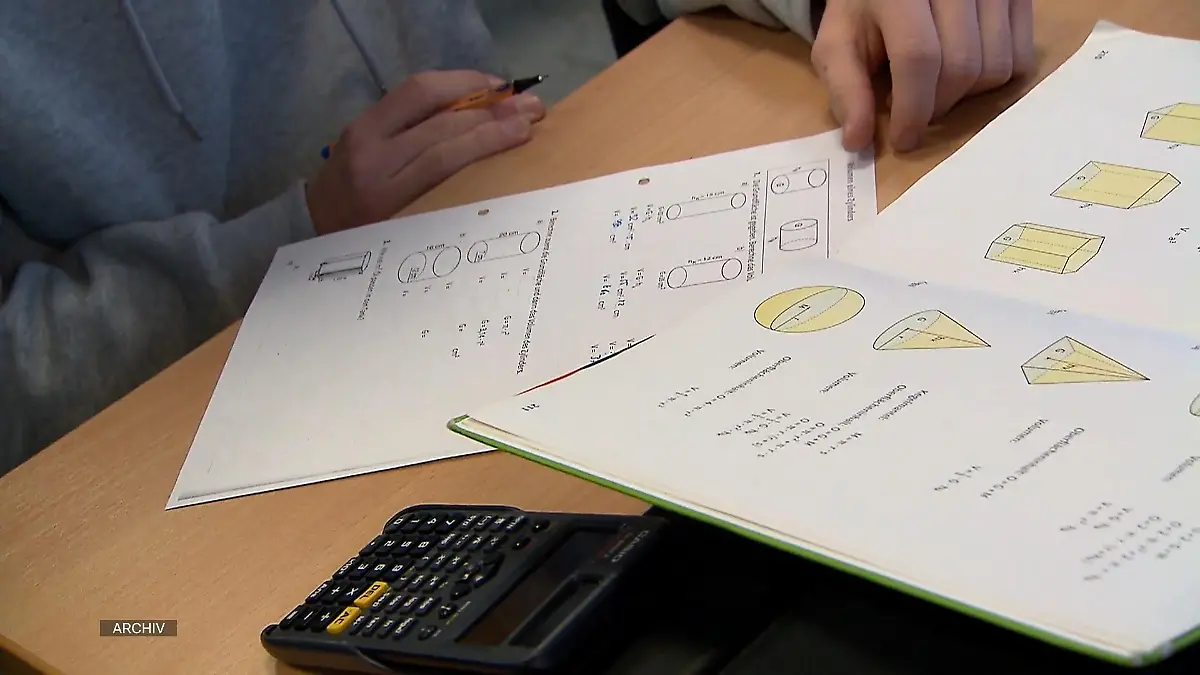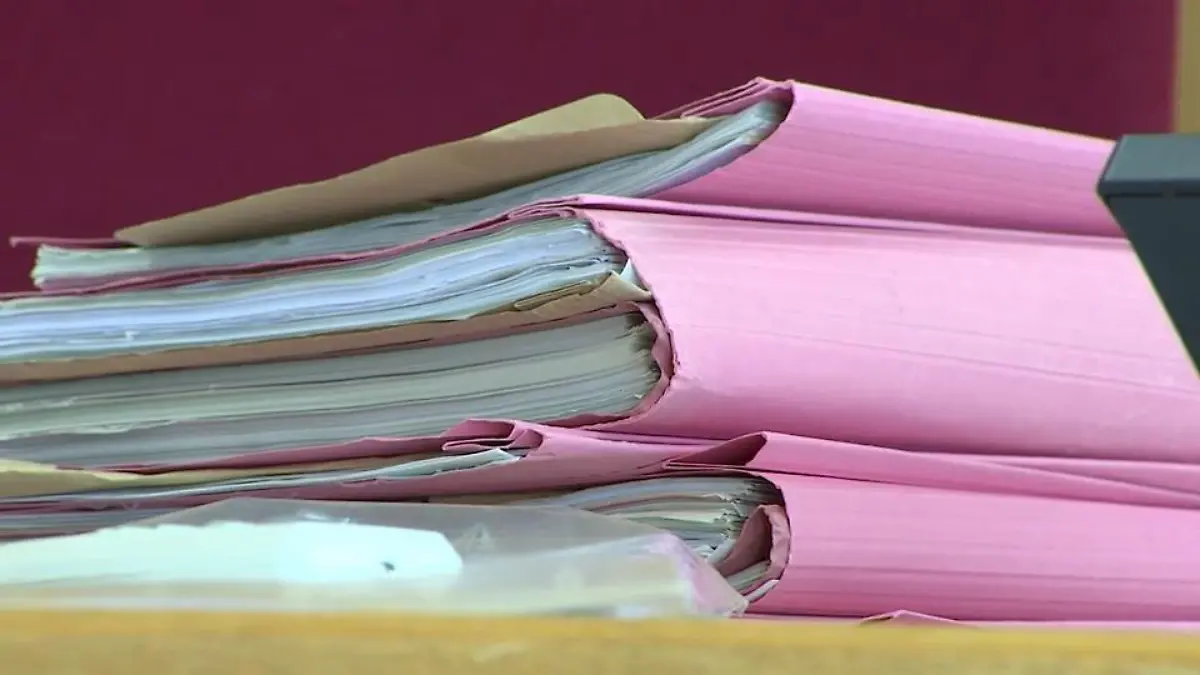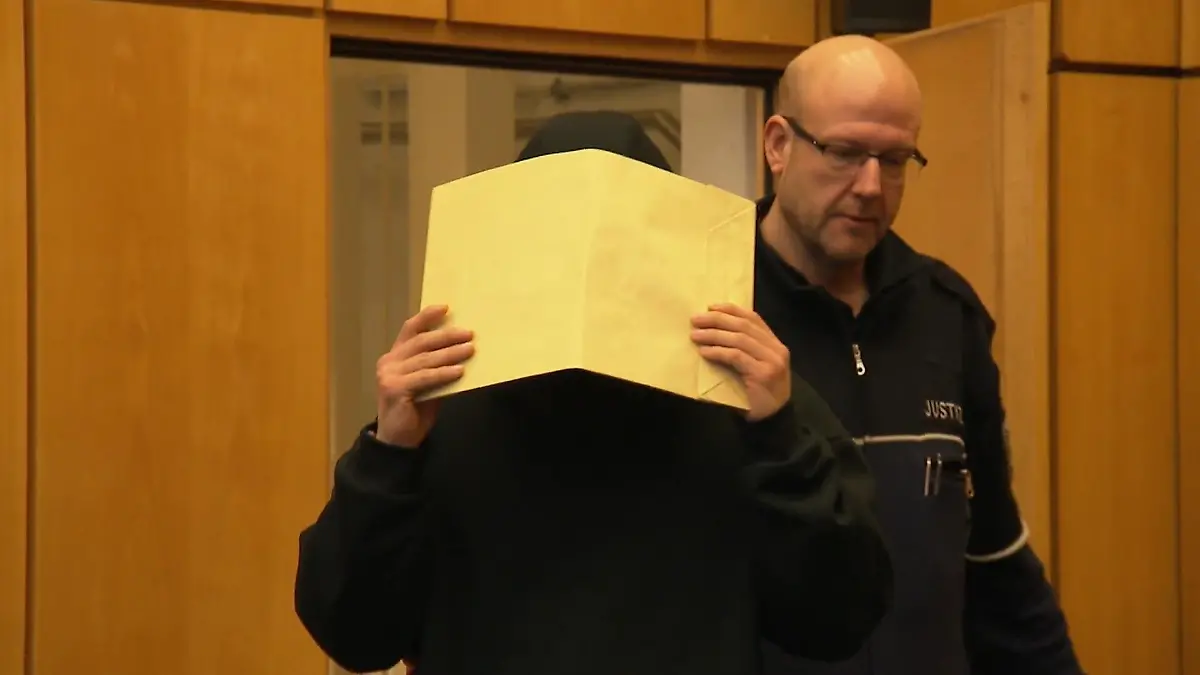Schnittstellen im StromnetzWie funktionieren Umspannwerke?
Immer unter Strom zu stehen, ist ganz schön anstrengend. Das gilt auch für unser Stromnetz. Aber anders geht’s nicht. Denn es muss immer so viel Strom zur Verfügung stehen, wie Verbraucher benötigen. Bei dieser Aufgabe helfen sogenannte Umspannwerke. Sie sind Schnittstellen zwischen den vielen tausend Kilometern an Stromkabeln.
Von der Höchstspannung in die Niederspannung
Ohne Umspannwerke käme kein Strom aus der Steckdose. Die überall im Land verteilten Anlangen sorgen dafür, dass die elektrische Energie von der höchsten Spannung bis zur niedrigsten Spannung umgewandelt werden kann. Der Leiter des Stationsbetriebs für Westfalen bei Westnetz, Olaf Reichling, vergleicht die vielen Leitungen mit dem Autoverkehr. „Man muss ja die Straßen auch erreichen. Und die Auffahrt an der Autobahn zum Beispiel wäre diese Umspannanlage. Ich ermögliche eine Verbindung von der Bundesstraße auf die Autobahn. Von der Kreisstraße auf die Bundesstraße.“ Die verschiedenen Straßen symbolisieren dabei die unterschiedlichen Spannungsebenen in Deutschland. Davon gibt es vier Stück:
Höchstspannungsnetz: 380.000 V
Hochspannungsnetz: 110.000 V
Mittelspannungsnetz: 50.000 V
Niederspannungsnetz: 230 V
Umspannwerke wandeln die elektrische Energie von einer auf die andere Ebene. Sie können das sowohl in eine niedrigere, als auch in eine höhere Spannung. Sie sind also entscheidende Schnittstellen im System.
Neue Anforderung durch Erneuerbare Energien
Durch die Energiewende braucht das Land jetzt aber deutlich mehr Umspannwerke, denn die Energiequellen, wie Windräder oder Solarpanels, stehen im ganzen Land verteilt. Die Anlagen speisen diese Energie ins Netz ein und wandeln sie je nach Bedarf in die verschiedenen Spannungsebenen um. Dann kann die Energie entweder bis zur Steckdose oder per Hochspannung durchs Land transportiert werden.
Umspannwerke funktionieren aber nicht nur wie Auffahrten für Autos. Sie sind auch kleine Ampeln im großen Stromkreislauf. Denn sie können automatisch regeln, wie viel Strom ins Netz eingespeist wird und das bei Bedarf auch regulieren, indem Windräder abgeschaltet werden. Diese Kontrolle ist notwendig, denn da das Netz keinen Strom speichern kann, muss immer genau so viel Energie erzeugt werden, wie verbraucht wird. Gibt es zu viel oder zu wenig Strom kann das Netz zusammenbrechen.
KI und Digitalisierung sollen helfen
Die große Herausforderung in Zukunft ist die Balance zwischen Verbrauch und Erzeugung ständig zu halten. Denn die Erneuerbaren Energien sind wetterabhängig. Dadurch lässt sich kaum mit ihnen planen. Dazu kommt, dass sich der heutige Stromverbrauch bis 2045 voraussichtlich verdoppeln wird. Künstliche Intelligenz und die Digitalisierung sollen dabei helfen, das Stromnetz auch in Zukunft zuverlässig zu steuern.