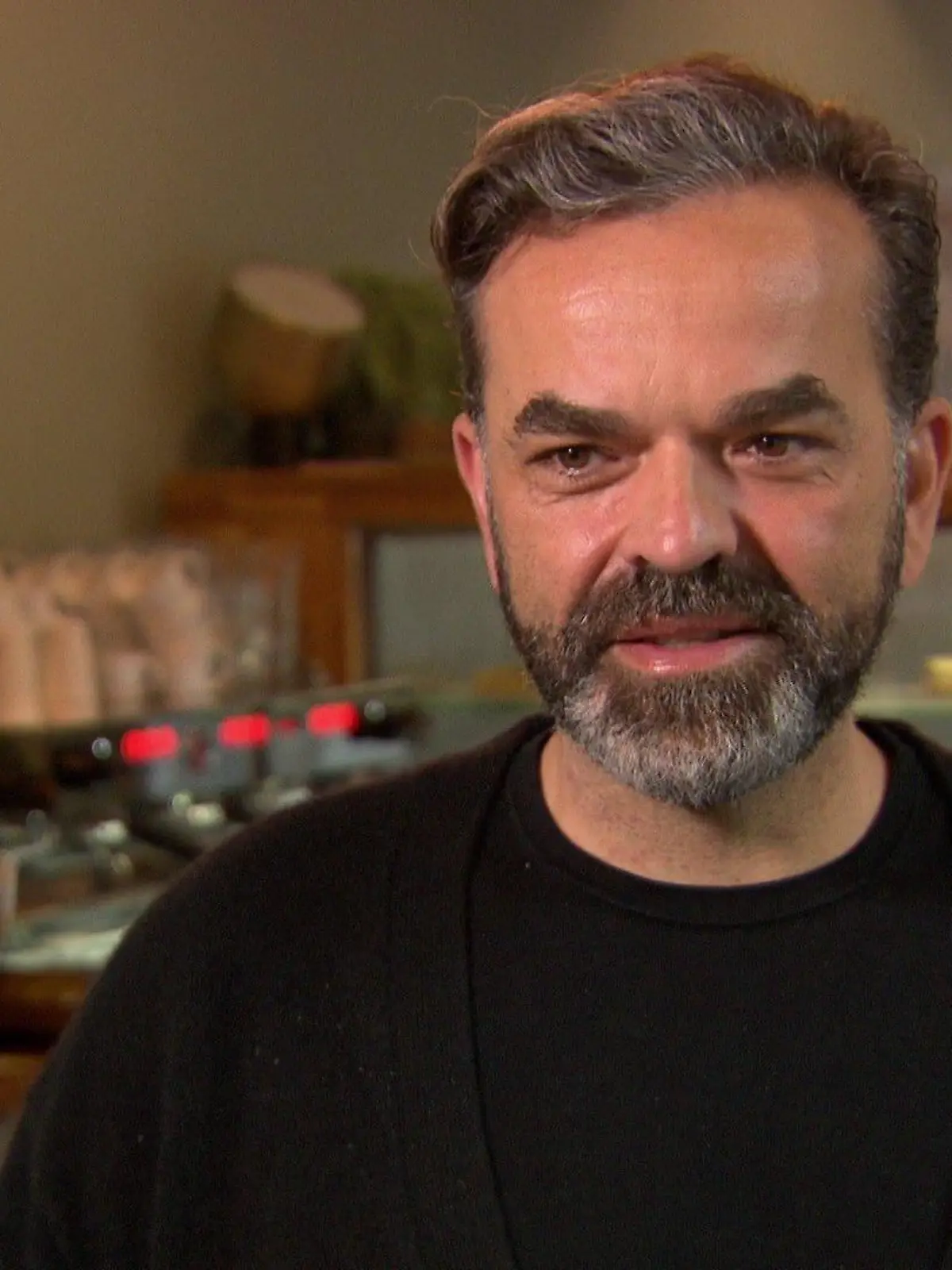DemografieDemografie untersucht die Entwicklung von Bevölkerungen, ihre Ursachen und Folgen. Die Faktoren sind Geburtenrate, Sterberate, Lebenserwartung und Migration.

Die Demografie wird auch Bevölkerungswissenschaft genannt. Sie beschäftigt sich mit Bevölkerungen, ihren Strukturen und Entwicklungen. Der Begriff setzt sich aus den griechischen Wörtern „demos“ (Volk) und „grafe“ (Beschreibung) zusammen. Die wichtigsten Faktoren für die Bevölkerungsentwicklung sind die Geburten- und Sterberate, die Lebenserwartung sowie die Ein- und Auswanderung. Die Bevölkerungsstruktur wird grafisch mit einer Alterspyramide dargestellt. Sie zeigt auch geografische Verteilungen und die Aufteilung auf die Geschlechter.
Die Geschichte der Demografie
Erste demografische Abhandlungen stammen aus dem 17. Jahrhundert. 1662 untersuchten John Graunt und William Petty die Bevölkerungsentwicklung von London. Initiator einer wissenschaftlichen Demografie war der Theologe und Statistiker Süßmilch, der 1741 eine Untersuchung zur Entwicklung der Bevölkerung aufgrund von Familienregistern und Kirchenbüchern vorlegte. Die mathematische Demografie wurde von Alfred James Lotka begründet. Er untersuchte die Beziehung zwischen Geburten- und Sterberate, stellte Gesetze zur Populationsdynamik auf und entwickelte 1939 die Theorie des Bevölkerungsgleichgewichts. Die Prognosen der heutigen Demografie stützen sich auf Volkszählungen, Befragungen, Stichproben und Statistiken. Ursachen und Folgen der Bevölkerungsentwicklung werden seit 1973 vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden untersucht.
Fragen der deutschen Demografie
Die Bevölkerung in Deutschland unterliegt einem demografischen Wandel, der sich durch eine niedrige Geburtenrate und steigende Lebenserwartung älterer Menschen auszeichnet. Laut Statistischem Bundesamt konnte sich die Bevölkerung ab 65 Jahren von 12,0 Millionen (1991) auf 17,9 Millionen (2018) erhöhen. Menschen ab 65 bilden einen wachsenden Anteil an der Gesamtbevölkerung. Die Anzahl der Personen ab 85 Jahren nahm besonders deutlich zu. Sie erhöhte sich von 1,2 Millionen (1991) auf 2,3 Millionen (2018). Der Rückgang des Anteils jüngerer Menschen wurde durch Zuwanderungen aus Europa, Vorderasien und Afrika kompensiert. 2015 wanderten 2.136.954 Menschen nach Deutschland ein.
Kritik an der Demografie
Demografen arbeiten mit Prognosen und Simulationen, die laut dem Kritiker Eversley nicht als Fakten dargestellt werden dürfen. Es seien nur Annahmen. Mit den Prognosen könnten politische Absichten verbunden sein. Die Entwicklung von Bevölkerungen könne man nicht exakt errechnen. Eine ähnliche Kritik äußern die Sozialwissenschaftler Gunnar Heinsohn, Otto Steiger und Rolf Knieper in einer Studie von 1979. Demografie sei ursprünglich wegen eines staatlichen Bedarfs an Arbeitskräften entstanden. Laut den Autoren diente sie dem modernen Staat dazu, eine Kriminalisierung der Geburtenkontrolle zu legitimieren. Geburtenraten von über 2,1 seien nicht naturgegeben, sondern Teil einer gewollten Bevölkerungspolitik.